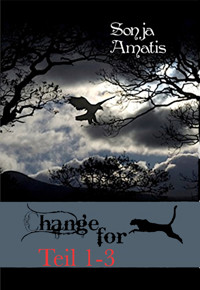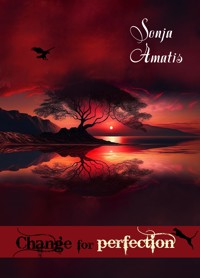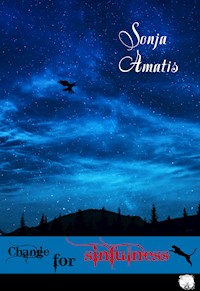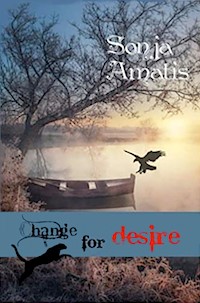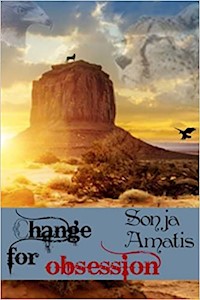6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gay Fantasy-Crime! Elliot schlägt sich als clanloser Gargoyle durch Edinburgh und das Leben. Als Einziger in seiner weitläufigen Familie hat er geringfügige menschliche Erbanteile mitgenommen, was für ihn ausschließlich Fluch statt Segen ist. Ein Fluch scheint es auch zu sein, was zu massenhaften Todesfällen in der Faunengemeinde führt. Unter den Faunen und Nymphen herrscht nackte Angst. Und was hat es mit Joaquin auf sich, dem Vampir, der Elliot neuerdings ständig begegnet? Schon bald steckt er mittendrin in einem Spiel um die Macht, dessen Regeln er nicht kennt, aber unbedingt befolgen muss - andernfalls hat er keine Chance, es zu überleben. Ca. 129.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 650 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gay Fantasy-Crime!
Elliot schlägt sich als clanloser Gargoyle durch Edinburgh und das Leben. Als Einziger in seiner weitläufigen Familie hat er geringfügige menschliche Erbanteile mitgenommen, was für ihn ausschließlich Fluch statt Segen ist.
Ein Fluch scheint es auch zu sein, was zu massenhaften Todesfällen in der Faunengemeinde führt. Unter den Faunen und Nymphen herrscht nackte Angst. Und was hat es mit Joaquin auf sich, dem Vampir, der Elliot neuerdings ständig begegnet? Schon bald steckt er mittendrin in einem Spiel um die Macht, dessen Regeln er nicht kennt, aber unbedingt befolgen muss – andernfalls hat er keine Chance, es zu überleben.
Ca. 129.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 650 Seiten.
von
Sandra Gernt
Für Doris Lösel
Der Anwalt ist ausschließlich für dich.
Inhalt
Prolog: Sic vis pacem, para bellum! Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor!
Kapitel 1: Quem dei diligunt, adulescens moritur! Wen die Götter lieben, den lassen sie jung sterben!
Kapitel 2: Memento vita! Gedenke des Lebens!
Kapitel 3: Officium solum cum morte finitur. Nur im Tod endet die Pflicht.
Kapitel 4: Animus sanctus, qui non dubitare potest! Gesegnet ist der Verstand, der nicht zweifelt.
Kapitel 5: Nulla culpa sine poena. Jede Schuld hat ihre Strafe.
Kapitel 6: Dum spiro, spero. Solange ich atme, hoffe ich.
Kapitel 7: Nihil sine magno labore vita mortalibus dat. Das Leben gibt den Sterblichen nichts ohne harte Arbeit.
Kapitel 8: Victoria laudatur. Cladis meminit. Des Erfolges wird gedacht. Des Versagens wird sich nur erinnert.
Kapitel 9: Poena fuit vita, requies mihi morte parata est. Die Strafe war das Leben, der Tod hat mir Erlösung gebracht.
Kapitel 10: Quies gentium sine armis haberi non potest. Frieden kann unter Menschen nicht ohne Waffen gehalten werden.
Kapitel 11: Carpe noctem. Nutze die Nacht.
Kapitel 12: Amicus certus in re incerta cernitur. Einen wahren Freund erkennt man in unsicherer Lage.
Kapitel 13: Obseqium amicos, veritas odium parit. Fügsamkeit macht Freunde, die Wahrheit schafft Hass.
Kapitel 14: Nemo potest personam diu ferre. Niemand kann für lange Zeit eine Maske tragen.
Kapitel 15: Suae quisque fortunae faber est. Jeder ist seines Glückes Schmied.
Kapitel 16: Da mihi mors aut libertas. Gib mir Freiheit oder den Tod.
Kapitel 17: Medicus nihil aliud est quam animi consolatio. Der Arzt ist nichts anderes als ein Tröster der Seele.
Kapitel 18: Corrige praeteritum, presens rege, discerne futurum. Korrigiere die Vergangenheit, beherrsche die Gegenwart, erkenne die Zukunft.
Kapitel 19: Nihil in terra sine causa fit. Nichts auf Erden geschieht ohne Grund.
Kapitel 20: Veritas filia temporis. Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit.
Kapitel 21: Oderint, dum metuant. Mögen sie mich hassen, solange sie mich fürchten.
Kapitel 22: Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla. Der Tag des Zorns, jener Tag wird die Welt zu Asche zerfallen lassen.
Kapitel 23: Tenebrae super faciem abyssi. Finsternis lag über der Tiefe.
Epilog: Fiat Lux. Es werde Licht.
Ein Jahr voller Fantasy …
Sic vis pacem, para bellum! – Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor!
Edinburgh, 12. Dezember 1793
oaquin betätigte den Türklopfer des edlen, weiß verputzten Herrenhauses. Zwei Gargoyles wandten ihm vom geschwungenen, stuckverzierten weißen Überbau der großen Tür die Köpfe zu und starrten ihn aus gelb leuchtenden Augen misstrauisch an. Er starrte unerschrocken zurück. Man hatte ihn eingeladen, seine Anwesenheit war erwünscht.
Die Wächter grollten leise, versuchten jedoch nichts, um ihn aufzuhalten. Gut so. Es fühlte sich wie ein kleiner Sieg an. Der heutige Abend würde noch sehr anstrengend werden.
Die Tür schwang auf. Ein grau livrierter Diener verneigte sich steif vor ihm. Für einen irrationalen Moment glaubte Joaquin, der alte Mann könnte ein Mensch sein. Das graue Haar, das faltige Gesicht … Doch die Witterung wies ihn eindeutig als Vampir aus. Wenn er derartig alt aussah, musste er entweder seit mehr als tausend Jahren auf dieser Welt überleben, oder er hatte teilweise menschliches Blut in den Adern. Da er niedere Dienste ausführte, war das die wahrscheinlichere Erklärung.
Joaquin beherrschte seine Gesichtszüge und grüßte mit höflichem Respekt. Verachtung oder schlechtes Benehmen würde ihn keinen Schritt voranbringen. Möglicherweise hatte man ihm den Alten als Test entgegengeschickt, um zu sehen, ob der Gesandte der Familie de la Sorbonne sich zu benehmen wusste. Dass Joaquin noch sehr jung war, gerade erst zwanzig Jahre alt, dürfte bekannt sein. Er war schließlich in die Gesellschaft eingeführt worden. Warum sonst sollten sie explizit nach ihm fragen, um die Verhandlungen zu führen?
„Guten Abend, Sir“, sagte der Diener und neigte erneut steif wie verwittertes Holz den Kopf. „Wen darf ich melden?“
Er streckte ihm einen runden, silbernen Teller entgegen, auf den Joaquin seine Namenskarte legte. Eine im Reliefdruck geprägte Besucherkarte, auf der sein Name und seine Familie vermerkt war, zusammen mit dem Wappen und einigen prunkvollen Zierelementen.
„Mr. de la Sorbonne. Ihr werdet erwartet. Bitte folgt mir.“ Ein weiteres steifes Nicken, dann durfte Joaquin das Heiligtum der Familie Russelcourt betreten – die erklärten Erzfeinde seiner Familie, mit der sie seit rund fünfzehn Jahren eine blutige Fehde führten. Er war hier, um Vorgespräche für ernste Verhandlungen über einen sogenannten Toleranzfrieden zu führen. Es würde aus den Feinden keine Verbündeten machen. Erreicht werden sollte ein Ende des Tötens. Im Endeffekt sollten beide Seiten dauerhaft so tun, als gäbe es die andere Familie nicht. Man tolerierte sich, ging sich bestmöglich aus dem Weg und verhielt sich friedlich, wenn ein Ausweichen nicht möglich sein sollte. Es war durchaus üblich, für diese Gespräche sehr junge, unerfahrene Familienmitglieder auszuwählen, gerne auch Frauen oder Jugendliche, als Zeichen, dass man der Gegenseite vertraute, diese verletzlichen Vampire nicht anzugreifen. Unüblich war es allerdings, die Gespräche nicht auf neutralem Boden durchzuführen. Da die Kämpfe in den letzten Jahren zu einem deutlichen Vorteil für die Russelcourts geführt hatten, zugleich das öffentliche Ansehen der de la Sorbonne durch einige Fehlentscheidungen ihres Familienoberhauptes sowohl in der Welt der Menschen als auch der Vampire etwas nachgelassen hatte, mussten sie dankbar sein, dass man ihnen lediglich Verhandlungen auf Hoheitsgebiet aufgezwungen hatte – und es tatsächlich um Toleranzfrieden statt Kapitulation ging.
Der Diener ließ ihn in der großen Vorhalle warten. Weißer Marmor, goldverzierte Gemälderahmen, edles Porzellan aus China in Glasvitrinen, seltsame Pflanzen aus Indien und Amerika. Prunk und Reichtum musste man dezent, aber deutlich zeigen, so wollten es die Regeln.
Joaquin prüfte rasch seine Erscheinung in einem verschnörkelten, bodenlangen Spiegel. Er trug schwarzen Samt. Weste und Mantel waren nach neuester Mode geschneidert, seine Stiefel glänzten, das schwarze Haar war von einer schlichten, weißgepuderten Perücke bedeckt. Es mehrten sich die Stimmen nach mehr Nüchternheit und Natürlichkeit. Protzige, stark gelockte Perücken im Stil des Sonnenkönigs waren längst aus der Mode, aber selbst die einfacheren Perücken wurden von bedeutsamen Männern, Philosophen, Denker, Politiker, als zu verspielt, überteuert und sinnloser Tand kritisiert. Die Revolution in Frankreich befeuerte den Wandel in der Gesellschaft. Ein Wandel, den Joaquin durchaus begrüßte, denn ihm waren Perücken entschieden zuwider. Im Moment gab es keine Alternative, wollte man nicht als Prolet verstoßen werden, darum ertrug er dieses heiße, drückende Gebinde auf dem Kopf mit Würde, wie jeder andere Mann von Adel und Stand auch.
Schritte auf der Treppe ließen ihn aufblicken. Es war nicht Franklin Russelcourt, wie erwartet, sondern ein kleines Mädchen. Drei, vier Jahre alt mochte sie sein und war offenkundig ihrer Amme entwischt, die sich eigentlich um sie kümmern und ein Zusammentreffen mit dem Erzfeind verhindern sollte. Das weiße Kleid, die langen blonden Haare, alles das unterstrich ihre kindliche Niedlichkeit und Unschuld. Es war sehr schwierig, Vampirkinder unerkannt in der Großstadt aufzuziehen. Menschen irritierte es, während der Nachtstunden auf Kleinkinder zu treffen.
„Bist du einer von uns?“, fragte sie ihn und schaute ihn aus veilchenblauen Augen ohne jede Scheu an.
„Ja, das bin ich. Und du bist in Schwierigkeiten, junge Dame, fürchte ich.“
„Nur wenn du mich verrätst.“ Sie kicherte hinter vorgehaltener Hand. Anscheinend war sie doch schon etwas älter, eher fünf Jahre, oder aber sehr frühreif, denn sie zeigte gute Manieren und sprach klar und verständlich.
„Vor wem versteckst du dich?“, fragte er.
„Anna-Maria. Sie ist böse auf mich.“ Ohne Erklärung, wer Anna-Maria sein mochte, oder welchen Namen sie selbst trug, huschte sie an ihm vorbei und verschwand durch eine der vielen Türen, die von der Vorhalle abgingen.
Die unschuldige Begegnung hatte Joaquin zum Lächeln gebracht. Rasch ließ er diese unangemessene Gefühlsregung verschwinden, hielt sich aufrecht, die Hände im Rücken verschränkt. So gebührte es sich für einen jungen Vampir auf feindlichem Boden. Es gab schließlich nicht den geringsten Anlass für Frohsinn – niemand garantierte, dass er am Ende dieser Nacht noch lebending sein würde. Es war selbstverständlich, dass er niemals diese Situation ausgenutzt hätte, um das Kind in seine Gewalt zu bringen. Allein auf feindlichem Gebiet wäre es mehr als unklug gewesen, an solche Dinge auch nur zu denken. Aber auch ganz unabhängig davon würde er Kinder, Frauen, rangniedrige Diener niemals anrühren.
„Cordelie!“ Eine empörte weibliche Stimme erklang. Momente später eilte eine junge Frau die Treppe hinab. Ihr schlichtes Kleid zeigte, dass sie eine rangniedrige Dame sein musste. Keine Dienerin, aber ausgeschlossen vom Leben der hochadligen Vampire. Erschrocken starrte sie Joaquin an, der sich beeilte, ihr freundlich zuzunicken, wie es als Zeichen des Respekts bei ihrem Stand angemessen war. Sie versank in einen überhasteten, sehr tiefen Knicks.
„Verzeiht, mein Herr“, flüsterte sie demütig. „Ich suche ein kleines Mädchen, ist sie vielleicht …?“
Stumm wies er auf die entsprechende Tür. Anna-Maria bedankte sich und folgte dem Kind. Dabei fing Joaquin ihre Witterung auf. Wie er es sich gedacht hatte, sie war genau wie der alte Diener ein Mischling. Halb Mensch, halb Vampir. Das erklärte den niedrigen Stand. Oder Halt – die zweite Hälfte war nicht menschlich. Möglicherweise Gestaltwandler?
Im menschlichen Aberglauben waren Vampire Untote. Blutsaugende Wiedergänger, die einen Menschen mit einem Biss zu einem der ihren machen konnten. Das war natürlich alles Unsinn. Man wurde als Vampir geboren, und je reiner das Blut in der Ahnenreihe, desto höher der Rang innerhalb ihrer vor den Menschen verborgenen Gesellschaft. Egal wie oft sie Menschen beißen würden, zum Vampir wandeln konnte man sie dadurch nicht. Was das Blutsaugen anging, nun, das war ein komplizierteres Thema …
Eine Tür öffnete sich, der alte Diener kehrte zurück.
„Die Herrschaften sind bereit, Sir. Bitte folgen Sie mir hier entlang.“ Er ließ Joaquin vorgehen. Um absoluten Gleichmut bemüht folgte Joaquin dieser Geste. Nun gab es kein Zurück mehr. Diese Nacht würde das Schicksal seiner Familie besiegeln und es lag an ihm, und an ihm allein, welchen Ausgang es nehmen würde.
Ein weiterer Wächter versperrte ihm den Durchtritt in das Studierzimmer, wo sich ein Dutzend Vampire um einen schweren Eichentisch versammelt hatten. Das monströse Gesicht verzerrte sich in drohender Gebärde, die spitzen Hörner waren genau wie die langen Klauen gegen ihn gerichtet. Nichts war hässlicher als ein Gargoyle … Und kein Geschöpf der Nacht war tödlicher. Einer der Vampire vom Tisch räusperte sich leise. Das vornehme, dezente Geräusch genügte, damit der Gargoyle knurrend beiseite wich und Joaquin eintreten ließ.
„Mr. Joaquin de la Sorbonne“, verkündete der Diener, bevor er sich auf einen Wink seines Herrn zurückzog.
Joaquin verneigte sich tief und verharrte in der Verbeugung, bis der Herr des Hauses ihm die Gnade gewährte und ihn aus dieser unbequemen Haltung erlöste.
„Joaquin“, sagte er mit väterlichem Unterton, und marschierte mit ausgestreckten Armen auf ihn zu. Franklin Russelcourt – sein wahrer Name, mit dem er geboren wurde, war Joaquin nicht bekannt – kleidete sich ähnlich wie er selbst. Seine Perücke war etwas aufwändiger gestaltet, sein Goldschmuck protziger und auffälliger. Stechende graue Augen musterten Joaquin kalt und zeigten nichts von der vorgetäuschten Wärme, die er in seine Stimme gezwungen hatte. „Ihr seid pünktlich. Ich schätze es, wenn Männer sich an Anweisungen halten. Nicht zu früh, nicht zu spät. Wie es sich gehört. Setzt Euch doch! Ich stelle Euch die Anwesenden vor.“
Eine Flut von Namen folgte. Joaquin kannte sie alle, es waren hochrangige Familienmitglieder. Darunter die vier überlebenden Söhne Franklins. Die einzige anwesende Frau war Lady Josefine Russelcourt, Franklins Gefährtin. Auch sie war mit einem anderen Namen geboren worden. Alle paar Jahrzehnte mussten Vampire, die in der Menschenwelt hohen Rang einnahmen, sich vollkommen neu erfinden, was häufig einen Scheintod beinhaltete. Die langlebige Jugendlichkeit ließ sich nur schwerlich mit Verkleidungen, Schminke und gelegentlichen Namenswechseln wegtäuschen. Irgendwann wurden die Sterblichen misstrauisch, es ließ sich einfach nicht verhindern.
Lady Russelcourt trug eine riesige, aufwändig hergerichtete Perücke, dazu ein Kleid aus taubenblauer Seide und kostbaren Schmuck. Die Kälte in ihrem Blick, mit dem sie Joaquin musterte, übertraf die ihres Gatten bei weitem. Dabei war er das einzige Mitglied seiner Familie, das noch nie ein Mitglied ihrer Familie getötet hatte … Ein weiterer wichtiger Grund, warum zu solchen Verhandlungen ausschließlich die Jüngsten und Schwächsten ausgewählt wurden. Bei ihnen stand weniger zu befürchten, dass sie jemand aus persönlicher Rache tötete, noch bevor die Gespräche begonnen hatten.
Joaquin setzte sich auf den Stuhl, den man ihm anbot. Zu seiner Rechten befand sich Jonathan Russelcourt, der älteste Sohn der Familie. Zu seiner Linken William, der nur zwei oder drei Jahre älter als er selbst war.
„Wir sind so dankbar, dass du den Mut gefunden hast, zu uns zu kommen, lieber Joaquin“, sagte das Familienoberhaupt und ließ damit die respektvolle Anrede fallen. Joaquin wurde schlagartig kalt. Das war der schlechtestmögliche Auftakt dieser Verhandlungen. Zudem sah er nirgends Schreibmaterialien, vorbereitete Unterlagen, die Dokumente, die sein Vater im Voraus geschickt hatte. Kein Zermonialset mit kleinen Klingen, um Unterschriften mit Blut zu gewährleisten. Nichts als ein Dutzend Vampire, das ihn geschlossen mit eisigem Lächeln bedachte.
Eine Falle! Hier ging es nicht um Verhandlungen. Sie hatten ihn herbeigelockt, um ihn zum Instrument der totalen Vernichtung seiner Familie zu machen! So etwas war seit fünfhundert Jahren nicht mehr vorgekommen! Es widersprach sämtlichen Gesetzen!
Ein Grollen und die flüchtige Witterung von Gestein verriet ihm, dass der Gargoyle hinter ihm Position bezogen hatte. Er würde ihn an der Flucht hindern. Joaquin blieb nichts mehr übrig, als möglichst flach zu atmen und seine Panik zu kontrollieren. Er würde sich nicht vor seinen Mördern blamieren, indem er um Gnade bettelte oder sich vor ihnen entwürdigte, noch bevor sie eine Hand an ihn gelegt hatten.
„Für solch ein junges Männchen hältst du dich sehr tapfer“, zirpte Lady Russelcourt und beugte sich vor, um ihm mit kalten Fingern über die Wange zu streicheln, als wäre er ein weinendes Kleinkind, das sich verlaufen hatte. Mit eiserner Beherrschung nahm er es hin, obwohl es unglaublich demütigend war. Beinahe wünschte er, sie würde ihm die spitzen Fingernägel durch das Gesicht ziehen, das wäre womöglich leichter zu ertragen.
„Er hat begriffen, dass der heutige Abend etwas anders verlaufen soll, als er es sich erhofft hatte“, sagte sie. „Nun, lieber kleiner Joaquin, wir befinden uns natürlich nicht mehr im finsteren Mittelalter. Wir können unsere Feinde nicht einfach offen abschlachten, bloß weil wir Lust dazu haben und es aufgrund der Machtverhältnisse auch leicht tun könnten. Wir benötigen Argumente, um vor dem Hohen Rat der Gilde darlegen zu können, dass der Schritt unausweichlich war. Diese Argumente wirst du uns liefern. Dank deiner pikanten Affäre mit Lord Gummenthrie … Aber sei unbesorgt. Wir sind keine wilden Barbaren und werden dich nicht foltern, bis du uns alle deine Geheimnisse verraten hast. Es gibt so viel einfacherere und weniger … unappetitliche Methoden. William, mein Lieber. Nimm ihn dir. Sei nicht schüchtern.“
William erhob sich ohne Hast, während Joaquin nichts tun konnte, als ihn hilflos anzustarren. Was hatten sie mit ihm vor? Welche Argumente könnte er liefern, um den Tod seiner Familie zu rechtfertigen? Welche verdammte Affäre sollte das sein? Wer war Lord Gummenthrie?
All diese Fragen zerfielen zu Staub, als er sah, wie William seine Fangzähne ausfuhr. Gargoyleklauen hielten ihn nieder, bevor Joaquin instinktiv zurückweichen konnte. Zerrissen ihm den Kragen von Hemd und Weste. Kein Ausweg.
Williams Gesicht näherte sich, als wollte er ihn küssen. Seine Zunge strich über Joaquins Hals.
„Du riechst gut“, raunte er ihm höhnisch zu. „Ich werde dich genießen.“
Joaquin fuhr zurück, konnte, wollte das nicht wehrlos hinnehmen. William lachte nur, hielt ihn fest, ließ ihm keine Möglichkeit zur Verteidigung. Dann biss er zu.
Quem dei diligunt, adulescens moritur! – Wen die Götter lieben, den lassen sie jung sterben
lliot hasste es, wenn die Sonne aufging. Natürlich hasste er es genauso, wenn die Sonne unterging und jeden anderen Zeitpunkt seines Lebens ebenfalls. Aber tatsächlich hasste er den Sonnenaufgang am meisten. Es war die Zeit, die ihn am unerbittlichsten daran erinnerte, was alles falsch an ihm war. Wie wenig er dazugehörte. Für die Menschen war er ein Monster, ihnen durfte er sich nicht nähern. Für die Gargoyles war er eine Missgeburt. Milchgesicht nannten sie ihn, lachten ihn aus, wenn es gut für ihn lief, attackierten ihn, wenn die Nacht schlecht war.
Nachts musste er sich vor den Gargoyles verstecken. Tagsüber, wenn seine Artgenossen versteinerten, verwandelte er sich in einen Menschen und verlor den größten Teil seines Gargoyle-Erbes, statt sich zur Statue zu wandeln. Keine Flügel. Keine überragenden Kräfte, auch wenn er für einen Menschen extrem stark war. Keine Klauen. Kein wunderschönes Gargoylegesicht, aber eben auch keine glatten, zarten, menschlichen Züge. Nach den Maßstäben der Menschen war er unglaublich hässlich, verkrüppelt, entstellt. Die Haut wirkte ungesund grau. Die Nase war wulstig und aufgeworfen, die Kiefer bildeten Ausbuchtungen, die Augenbrauenwülste standen ausgeprägter hervor als bei Neanderthalern. Überflüssig zu erwähnen, dass man ihn für einen Primitivling hielt, der keine drei Worte aneinandergereiht fehlerfrei stammeln konnte. Es half nicht, dass er tatsächlich ein Sprachproblem hatte, auch wenn dies nicht mit seinem Intellekt zusammenhing.
Leider gab es viel mehr Menschen als Gargoyles. Es war kaum möglich, ihnen zu entkommen. Elliot trug stets Hoodies mit tief gezogener Kapuze über den Kopf, wenn er sich durch die Straßen von Edinburgh bewegte. Er fühlte sich als Gargoyle. Immerhin waren seine Eltern beide Gargoyles, seine Geschwister galten ebenfalls als reinrassig. Sein Urgroßvater war ein Mensch gewesen. Ein Abenteuer, auf das seine Urgroßmutter sich eingelassen hatte. Sein Großvater mütterlicherseits, der aus dieser flüchtigen Nacht entstanden war, hatte keinerlei menschliche Merkmale. Elliot war der einzige unter seinen Nachkommen, bei denen dieses Erbe teilweise durchgeschlagen war.
Er musste lediglich alle paar Tage für ein paar Stunden schlafen. Das empfand er tatsächlich als großen Vorteil, da er sich niemals sicher fühlte und beständig auf der Flucht war. Musste er sich niederlegen, verkroch er sich an Orten, die sich für ihn bewährt hatten – Zwischenräume in Brücken, Keller von leerstehenden Gebäuden, Glockentürme von Kirchen.
Die Tage verbrachte er mit Hilfsarbeiten bei einer kleinen Baufirma. Das Geld, das er damit verdiente, genügte, um sich mit Essen und Kleidung zu versorgen. Sein Arbeitgeber und dessen Vorarbeiter ließen ihn bei sich duschen und Vorräte deponieren. So verbrachte er seit über fünfzehn Jahren sein Leben, nachdem seine Familie ihn fortgejagt hatte, als er gerade einmal vierzehn gewesen war. Er kam zurecht.
Und dennoch: Jeden Tag aufs Neue hasste er es, wenn die Sonne aufging.
Elliot landete in einer dunklen, schmalen Gasse. Es stank nach Hundekot, Erbrochenem, Müll, Crystal Meth. Hier kauerte er sich am Boden nieder, legte seine Flügel an, deponierte das Kleiderbündel zu seinen Füßen, das er gleich benötigen würde. Im Schutz einer überquellenden Mülltonne erwartete er den gefürchteten Moment. Diesen elenden Augenblick, in dem sich die Flügel in seinen Rücken zurückzogen und ihn aussehen ließen, als hätte er einen gewaltigen Buckel. Wenn sich seine schwarzlederne Haut in ein ungesundes Grau verwandelte. Sein Gesicht zusammenschrumpfte, seine Ohren rund wurden, die prächtigen Klauen zu harmlosen, schwächlichen Fingernägeln verkümmerten, selbst seine Zähne zur Armseligkeit verkamen.
Es war ein Wunder, dass er nicht in seinen ersten Lebenstagen gestorben war. In der Nachbarschaft zu der entweihten Kirche, in der seine Familie tagsüber als Statuen ausharrten, hatten Nymphen gelebt. Sie hatten sein elendes Weinen gehört und dafür gesorgt, dass er nicht verhungerte oder anderweitig zu Schaden kam. Schon da wollten seine Familie ihn wegschicken – durchaus auch, weil sie tagsüber nicht für ihn sorgen konnten. Sein Großvater hatte sich dagegen ausgesprochen. Nymphen waren nicht in der Lage, sich um ein Gargoyle-Baby zu kümmen. Nicht nachts, wenn Elliot seine Gargoyle-Gestalt besaß, statt die schwache menschliche. Kein anderes mythisches Wesen wäre dazu bereit. Und Menschen sollten und durften selbstverständlich nicht erfahren, dass es Gargoyles gab. Großvater Oscar hatte darum argumentiert, man solle Elliot entweder behalten und sich lediglich tagsüber von Nymphen helfen lassen, bis er alt genug war, um in dieser Zeit allein klarzukommen. Oder sie töteten ihn sofort und ersparten sich und ihm das Elend. Dazu hatte sich seine Mutter nicht durchringen können und bis heute war sich Elliot überhaupt nicht sicher, ob er ihr dafür dankbar sein sollte oder ob er sie hasste.
Da! Es ging los. Die Schmerzen waren vernichtend, doch Elliot ertrug sie bereits sein gesamtes Leben. Er ließ keinen Laut über die Lippen dringen, ballte lediglich die Fäuste. Rund zwei Minuten dauerte es, bis er die Verwandlung durchgestanden hatte und sich erheben konnte. Der Lendenschurz, den er als Gargoyle trug, fiel von seinen nun deutlich schmaleren Hüften, darum musste er sich rasch in die menschliche Kleidung hüllen, die er zuvor aus seinem üblichen Versteck unter dem Dach eines Lagerhauses geholt hatte. Sobald auch die Schuhe geschnürt waren und er sich die Kapuze seines grauen Hoodies tief über sein Gesicht gezogen hatte, machte sich Elliot auf den Weg.
Heute war Montag. An Montagen half er auf Baustellen aus, als Mädchen für alles. Auch in vermenschlichter Gestalt war er deutlich stärker als normale Sterbliche und immer noch etwas kräftiger und ausdauernder als die meisten Mythischen. Sein Chef war ein Faun. Faune, also Walddämonen, fügten sich beneidenswert gut in die menschliche Gesellschaft ein. Ihre Ziegenbeine verbargen sie mittels Illusionen, die sie von Nymphen kauften, zusammen mit den Hörnern. Dass ihre Gesichter recht scharf geschnitten waren, wurde eher als attraktiv wahrgenommen, ohne dass sie durch echte Schönheit auffielen. Im Gegensatz zu den Nymphen, die ihre eigenen Illusionszauber dringend benötigten, um sich hässlicher und gewöhnlicher zu machen, damit sie als Stewardessen, Kindermädchen, Erzieherinnen oder Masseurinnen arbeiten konnten. Nymphen kümmerten sich gerne um Menschen, besonders um Kinder. Da die Illusionen seltsam starken Einfluss auf ihre Libido nahmen, gab es kaum welche unter ihnen, die tatsächlich im Sexgewerbe tätig waren, wie man es eigentlich vermuten könnte.
Manchmal haderte Elliot damit, wie die Welt funktionierte. Sich ständig verstecken zu müssen. Auf die Menschen Rücksicht zu nehmen, die ihnen in jeglicher Hinsicht unterlegen waren, ausgenommen ihrer schieren Anzahl. Natürlich könnten die mythischen Völker, wie sie sich selbst nannten, mit Leichtigkeit in die sibirische Tundra oder eine der Wüsten zurückziehen, oder ins australische Hinterland. Mittels Illusionsmagie könnten sie dort für sich leben, ungestört von den Menschen, ohne jemals von ihnen aufgespürt zu werden. Aber wer wollte da schon hin?
Nein, auf ein solches Leben hatte er noch viel weniger Lust als auf das, was er führen musste. Darum blieb alles, wie es war. Unter Faunen zu arbeiten war definitiv nicht das Schlechteste, was man tun konnte. Sie beschimpften ihn jedenfalls nicht als hässliche Missgeburt und respektierten ihn halbwegs für seine Arbeitskraft.
Elliot erreichte die aktuelle Baustelle und drückte sich vor dem Bauwagen herum, bis Victor auftauchte. Der Vorarbeiter nickte ihm übellaunig zu und reichte ihm stumm den Schlüssel zum Bauwagen. Offenbar hatte er eine schlechte Nacht gehabt. Oder mal wieder Streit mit seinen Mitbewohnern. Faune lebten zumeist in Männer-WGs, und wie es so war mit dämonischen Herrenrunden, da lief es selten glatt. Schon die Frage, ob nicht mal jemand Lust hätte, den Abwasch zu übernehmen, da auf sämtlichen Tellern bereits die dreiundzwanzigste Krustenschicht vertrockneter Essensreste in die Höhe wuchs, konnte zu schweren Krisen und ernstlichem Stress führen.
Elliot wusste es besser, als Victor Fragen zu stellen oder ihm gar Hilfe anzubieten. Stattdessen ging er in den Wagen rein, zog sich um, kochte Kaffee. Victor schaffte es unfehlbar wie stets, genau dann aufzutauchen, als die altersschwache Maschine den letzten Tropfen in die Kanne geröchelt hatte. Selbstverständlich stellte Elliot dem Vorarbeiter die erste gefüllte Tasse hin, bevor er sich selbst einschenkte. Zur Belohnung schob Victor ihm eine Dose mit Sandwiches entgegen, damit Elliot sich eines davon nehmen durfte.
„Eben frisch gekauft“, knurrte er. „Du fängst gleich am Betonmischer an und bringst den Maurern Steine. Der Rest findet sich im Laufe des Tages.“
Elliot nickte stumm zur Bestätigung, dass er verstanden hatte. Derweil kamen die Kollegen nach und nach rein. Das war ihm zu voll, zu viel Getümmel, darum trank er hastig aus und verließ den Wagen, um mit der Arbeit zu beginnen.
Eigentlich war es noch zu früh dafür, jedenfalls laut Arbeitszeitgesetz der Menschen. Erst in einer halben Stunde durfte schweres Gerät eingesetzt werden, da sie sich hier in einem Wohngebiet befanden. Elliot begann deshalb damit, die Paletten mit den Steinen zu räumen und sie für die Maurer passend zu stapeln. Das machte keinen Lärm und weil er dank seiner überlegenen Sicht in der Dämmerung keine Beleuchtung brauchte, störte er auch garantiert keine Anwohner.
Leise summend verrichtete er seine Arbeit. Das war etwas, was er an der Tagesphase wirklich sehr zu schätzen wusste: Er konnte nützlich sein und seine Zeit auf eine Weise verbringen, die es ihm ermöglichte, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wie er sich danach sehnte, dies auch nachts tun zu können! Aber niemand würde eine Missgeburt wie ihn jemals als Wächter engagieren.
Elliot bemerkte auf der Straße eine Gruppe Nymphen, die schnatternd und tratschend unterwegs war. Vermutlich wollten sie zum Bus, um zu ihren Arbeitsstätten zu fahren. Eine von ihnen, eine grünhaarige Birkennymphe, die dank des Illusionszaubers blond und blauäugig zu sein schien, wandte den Kopf und sah ihn an. Als Mystischer musste Elliot lediglich blinzeln, um die Illusionen zu durchschauen. Wobei er auch dann lediglich ihre liebliche, menschenähnliche Gestalt erblickte und nicht die Urform, die an einen wandelnden Baum gemahnen würde. Auf diese Weise präsentierten sich Nymphen allerdings nur, wenn sie kämpfen mussten, um ihr Leben zu verteidigen.
Die Birkennymphe blieb stehen und winkte ihn zu sich heran. Eine Aufforderung, der er mit verhaltener Vorsicht folgte.
„Hallo Elliot!“, rief sie mit ihrer wunderschönen Stimme, die wie flüssiges Gold schmeichelte. „Na, du bist ja ordentlich gewachsen …“ Sie tätschelte ihm durch den Bauzaun hindurch sanft die Wange, als wäre er ein kleiner Junge. „Das ist Elliot, Mädels“, fuhr sie an ihre Begleiterinnen gewandt fort. „Ich habe auf ihn aufgepasst, als er noch klein war.“
„Ach, der Gargoyle, der tagsüber nicht versteinert! Das ist so possierlich!“ Eine Wassernymphe, in Natur mit blauem Haar und grünlicher Haut, dank Illusion brünett gefärbt, klatschte begeistert in die Hände. „Herr Elliot, Sie sind sicherlich auch in Tagesgestalt kräftiger als wir? Uns ist da nämlich gerade ein kleines Missgeschick passiert und wir könnten etwas Hilfe gebrauchen.“
„Awww, wie zauberhaft, dass du daran denkst, River!“ Die Birkennymphe zog am Bauzaun. Rasch griff Elliot ein, damit sie sich nicht ihre winzigen, zarten Finger verletzte, und trat auf die Straße. Es war sowieso noch früh am Morgen und bestimmt würde es nicht lange dauern, den Damen behilflich zu sein. Sollte Victor es ihm übel nehmen, dass er die Baustelle kurz verließ, arbeitete er eben heute Abend länger. Da der Sonnenuntergang im Frühling später erfolgte, war das kein Problem, er musste bloß verschwinden, bevor er Gargoyle-Gestalt annahm.
Die Birkennymphe, ihr Name war offenbar Blanche, hakte sich bei ihm unter und schwatzte fröhlich über Kinder, darüber, wie schnell die Zeit verging und wie stattlich er sich doch herausgemacht hatte. Elliot verzieh ihr diesen Frohsinn von Herzen. Nymphen sahen in allem und jedem nur Gutes, das war ihre Natur. Es gab keinen Grund, ihnen deswegen böse zu sein. Die Damen führten ihn ein Stück die Straße hinab, bis zu einem Gully.
„Fern hat ihr Armband verloren“, erklärte Blanche und wies auf eine ihrer Freundinnen. Offenbar eine Wildwiesen-Nymphe, wenn man nach ihrem grasgrünen Äußeren, dem bunten Blumenkleid und dem Namen ging, der „Farn“ bedeutete.
„Es ist ein Familienerbstück“, sagte Fern. „Einfach in den Gully gefallen. Wir können den Deckel nicht bewegen. Eigentlich wollten wir nach Feierabend einen der Faune um Hilfe bitten, aber wenn du mal nachschauen könntest?“
Elliot nickte verkrampft und bat die Nymphen mit einer Geste, etwas Abstand zu nehmen. Er wollte sie nicht verletzen und konnte nicht garantieren, dass kein Wasser auf ihre schönen Kleider spritzen würde. Wie üblich fiel ihm erst hinterher auf, dass er all diese Dinge bloß gedacht statt laut ausgesprochen hatte. Es geschah einfach so selten, dass er seine Stimme benutzen musste, darum vergaß er es meistens. Victor und die anderen Vorgesetzten auf der Baustelle erwarteten nie, dass er irgendetwas von sich gab. Sie erteilten ihm Anweisungen, praktisch alles ließ sich seinerseits mit Nicken und Kopfschütteln regeln. Anstrengend, das Ganze …
Rasch hob er den Gullydeckel an, was für ihn mühelos mit einer Hand zu erledigen war. Die Nymphen jubelten und klatschten begeistert. Zum Glück wohnten in weitem Umkreis ausschließlich Mystische, die durchaus an Kummer mit Nymphen gewöhnt waren. Die Menschen nahmen sie dank des Illusionsschutzes nicht wahr, wenn es richtig lief. Elliot kauerte sich nieder, starrte in die Finsternis. Ja, er sah das Schmuckstück. Kostbares altes Silber, viele kleine Blüten, die aneinandergereiht waren. Er musste sich mächtig recken, flach auf dem Bauch liegend, um das Armband zu erwischen. Dabei wurde er nass und dreckig, was nichts weiter ausmachte, weil er ja Arbeitskleidung trug. Als er sich aufrichtete, blickte er auf zwei schwere, schmutzstarrende Stiefel, die nichts mit zarten Nymphen zu tun hatten.
Elliot erhob sich, schrumpfte unter dem strengen Blick seines Vorarbeiters zusammen.
„Was machst du da?“, knurrte Victor vorwurfsvoll.
Sofort flatterten die Nymphen aufgeregt um ihn herum, berührten den Faun zärtlich an den Hörnern – gerade dort waren Faune hochsensibel und sie liebten es, wenn geschickte Nymphenfinger sie am Übergang zwischen Horn und Schädel streichelten.
„Nicht schimpfen“, zirpte Blanche. „Das ist alles meine Schuld. Ich habe Elliot gezwungen, uns zu helfen. Fern hatte ihr wunderschönes Armband verloren. Das hätte ihr das Herz gebrochen und er hat alles getan, um das zu verhindern. Nicht wahr, Elliot?“
Er nickte und streckte die Hand vor, in der sich das Schmuckstück winzig ausnahm. Seine Finger bebten leicht, als Fern es mit einem juchzenden Freudenschrei an sich nahm, ihn heftig umarmte und Küsse auf seine Wange drückte. Das war ihm unangenehm, denn er war doch dreckig und das sollte nicht auf ihr Kleid übergehen!
„Danke, Victor, dass wir uns Elliot ausleihen durften. Du bist großartig“, schnurrte Blanche und gönnte dem mittlerweile selig grummelnden Faun noch einige letzte Streicheleinheiten. Dann streckte sie sich, um Elliot ebenfalls einen Kuss auf die Wange zu hauchen. „Und du bist ein Held. Vielen, vielen Dank, dass du meiner Freundin beigestanden hast!“
Hilflos stand er still, wusste nicht, was er sagen oder tun sollte. Dort stand er immer noch, völlig verkrampft, als die Nymphen sich bereits verabschiedet hatten und lachend und plappernd davongezogen waren. Erst als Victor ihm einen deftigen Schlag gegen den Hinterkopf versetzte, fuhr Elliot zusammen und landete wieder in dieser Welt.
„Genug geträumt!“, knurrte der Faun streng. „Den Betonmischer kannst du vergessen. Du machst am Abriss weiter! Und jetzt ab mit dir, bevor ich dir Beine machen muss.“
Elliot nickte unglücklich, legte den Gullydeckel zurück und beeilte sich dann, zurück zur Baustelle zu kommen. Die Abrissstelle war ziemlich sinnlose Plackerei. Aber er würde nicht gegen die Bestrafung aufbegehren. Im Prinzip war er ja gut davongekommen. Das gelang nicht immer, wenn Victor erst einmal zornig auf ihn war.
Elliot beeilte sich, die Spitzhacke zu holen. Heute wollte er nicht mehr in das Blickfeld des Vorarbeiters geraten und ihm irgendeinen Grund liefern, unzufrieden mit ihm zu sein. Darum vergewisserte er sich dreimal, dass es wirklich schon spät genug geworden war, um Lärm machen zu dürfen.
Das Gelände, auf dem hier ein Mehrfamilienhaus hochgezogen wurde, hatte früher einer reichen Vampirfamilie gehört. Er hatte gerade vergessen, welche das gewesen war, und es interessierte ihn auch nicht. Vermutlich waren es die Russelcourt gewesen. Vampire waren ihm unheimlich und das Beste, was man seiner Meinung über sie sagen konnte: Sie hatten Edinburgh bis auf einige Einzelindividuen verlassen und besuchten bloß selten ihre teuren Anwesen in der Stadt, sofern sie noch welche besaßen. Alle Vampirfamilien, die die anhaltenden Blutfehden der Renaissance-Zeit überstanden hatten, waren nach London, Paris oder Amerika umgesiedelt. Seinetwegen brauchten sie niemals mehr in das provinzielle Schottland zurückzukehren.
Der größte Teil des Herrenhauses, das hier seit Ewigkeiten leer gestanden hatte, war abgerissen worden. Die Bausubstanz war nicht mehr zu retten gewesen, es hatte über Jahrzehnte hinweg hineingeregnet, weil sich niemand dafür verantwortlich gefühlt hatte. Zurückgeblieben war lediglich ein Mausoleum aus Marmor und schwerem Granitgestein am Rande des Geländes. Arthur, der Chef der Baufirma, die für das Vorhaben verantwortlich war, hatte bestimmt, dass bei diesem Grab kein schweres Gerät eingesetzt werden durfte. Gerade bei Vampiren wusste man nie, ob nicht Flüche, magische Artefakte oder andere Unanständigkeiten mit im Spiel waren. Faune und Gargoyles waren gleichermaßen hart im Nehmen, was solche Dinge betraf. Teure Gerätschaften hingegen nicht. Darum waren Spitzhacke, Schaufeln und Handarbeit definitiv die richtige Entscheidung, was dieses Ding betraf. Elliot wusste, dass er Victor rufen musste, sollte er auf Pentagramme oder anderweitige Anzeichen von Dämonenbeschwörung stoßen. Das wäre nicht notwendig, würde er in voller Gargoyle-Gestalt arbeiten. Als halber Mensch musste auch er ein wenig vorsichtiger sein. Sollte nichts dazwischenkommen, würde er dieses alte Grab heute noch beseitigen. Mit echten Überraschungen rechnete er nicht. Mausoleen wie dieses waren im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert reine Dekoration gewesen, dazu bestimmt, menschliche Gäste wohlig erschaudern zu lassen, wenn man sie nachts durch den Garten führte und erzählte, dass der Urgroßvater hier beerdigt lag. Diese Gäste ahnten natürlich nicht, dass der hübsche junge Gastgeber selbst dieser Urgroßvater und bereits hundertfünfzig Jahre alt war.
Also dann! Victor sollte ihm heute Abend zufrieden auf die Schulter klopfen und sagen, dass er einen guten Job gemacht hatte. Dann bekam er vielleicht morgen früh wieder ein Sandwich ausgegeben. Das Leben war teuer und er musste mit seinem Verdienst gut haushalten. Irgendwann wollte sich Elliot seinen größten Wunsch von allen erfüllen: Eine eigene Wohnung, in der er sicher leben und schlafen konnte.
Lärm.
Da war … Lärm. Anhaltendes Klopfen. Joaquin öffnete die Augen. Natürlich sah er nichts. Es gab nie etwas zu sehen, darum hatte er vor langer Zeit aufgegeben, es zu versuchen. Egal was. Sehen, hören, riechen, schmecken … Es endete stets in Enttäuschung. Sicher, er hörte sich selbst, wenn er das wollte. Er konnte sich auf die Lippen beißen und Blut schmecken. Manchmal tat er das sogar. Genauso wie er gelegentlich die Hände hob und sich selbst berührte, um die Erinnerungen nicht vollständig zu verlieren. An den meisten Tagen wusste er nicht mehr, woran genau er sich erinnern wollte. Dann dämmerte er wieder vor sich hin, für Tage, Nächte, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte …
… Bis es ihm wieder einfiel.
Das Leben. Er wollte das Leben nicht vollständig vergessen.
William Russelcourt. Er hatte es ihm gestohlen, das Leben.
Joaquin konnte nicht sterben, denn er war nicht getötet worden. Diese Gnade hatte sein Feind ihm nicht gewährt. Nicht einmal so viel Respekt hatte er ihm erweisen wollen, obwohl Joaquin gebettelt, ihn angefleht, sich vollkommen gedemütigt hatte. Nur gelacht hatte er …
Das Klopfen hörte nicht auf. War es womöglich echt? Kein Traum? Unvorstellbar. Oder?
Joaquin biss sich auf die Lippen, bis er Blut schmeckte. Das köstliche, salzig-metallische Geschmackserlebniss entfachte ein Feuerwerk in seinem Körper. Entzündete Nerven, die viele, viele Jahre gedämmert hatten. Weckte Verlangen und Sehnsucht und die Erinnerung, warum genau er sich diesen Genuss bloß sehr, sehr selten gönnte – er wurde mit großem Schmerz bezahlt. Unerfüllbare Sehnsucht, vernichtendes Verlangen. Unvorstellbarer Hunger. Qualen, die das letzte bisschen Verstand bedrohten, das er sich mühsam bewahrt hatte.
Er beschloss, dass er das Klopfen hasste. Nicht leidenschaftlich, denn das würde Kräfte fordern, die er nicht besaß. Dennoch, er hasste es. Es sollte weggehen, ihn in Ruhe lassen. Da er nicht sterben konnte, wollte er wenigstens schlafen dürfen. Im Schlaf gab es keinen Schmerz, keine Hoffnung, kein Verlangen, keine Sehnsucht. Nicht einmal mehr Hunger.
Warum wurde es lauter? Kam näher? War denn da tatsächlich jemand bei ihm? Jemand, der sein Versteck öffnen wollte?
Nein. Undenkbar. William hatte ihm geschworen, dass das Grab für alle Zeiten und Ewigkeiten versiegelt bleiben würde. Versiegelt bleiben müsse, damit er, Joaquin, von der Welt vergessen werden könne.
„Geh weg“, wisperte er tonlos. Sofort schmerzte seine Kehle, protestierte, weil er ihr Arbeit aufzwang.
Stimmen. Stimmen in seiner Nähe! Was sie sagten, konnte er nicht genau verstehen. Es ging um ein Siegel. Seltsam war die Sprache, die diese Leute nutzten. Einerseits Englisch, andererseits … Seltsam. Ob das Menschen waren? Nein. Menschen hätten kein magisches Siegel sehen können, geschweige denn, es als das erkannt, was es war.
Nun gut. Jetzt hatten sie das Siegel bemerkt. Sie würden verstehen, dass sie fortzugehen hatten und ihn in Ruhe lassen. Mehr wünschte er sich nicht. Ruhe. Schlaf. Vergessen. Nachdem man ihm alles andere fortgenommen hatte, konnte das doch nicht zu viel verlangt sein?
„Elliot, ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Mach es kaputt. Sieht wirklich nicht gefährlich aus.“
Worte ohne Bedeutung. Sie schwebten durch sein schwindendes, staubiges, vertrocknetes Bewusstsein. Zusammen mit dem elenden Klopfen, das schon wieder einsetzte.
„Gut machst du das, Junge. Bist ja echt ordentlich vorangekommen. Heb den Brocken da mal weg. Ist nicht zu schwer für dich, oder?“
Noch mehr Worte von einer rauen Stimme. Sie klang nach Wald und schmeckte dämonisch. Sicherlich ein Faun. Er mochte Faune nicht sonderlich, wie er sich zu erinnern glaubte. Primitive Kreaturen, chronisch übelgelaunt und stets bereit, dies an den Schwächeren auszulassen. Als Arbeiter taugten sie, waren fleißig, ausdauernd.
Kratzen. Schnaufen. Ächzen. Staub rieselte auf Joaquins Beine. Das war verwirrend, denn er hatte vollkommen vergessen, dass er Beine besaß.
Und plötzlich war da Licht. Joaquin erstarrte, schrie ohne Stimme, brüllte in das tiefste Innere seiner Seele hinein. Riss die Hände in die Höhe, um sich zu schützen.
Licht. LICHT! Es brach in seinen jahrhundertelangen Dämmerschlaf und weckte ihn ohne Gnade auf. Zerrte Schmerzen hervor, die er so gerne vergessen wollte. Zwang ihm Erinnerungen in das Gedächtnis zurück, die er in den Abgrund geschleudert hatte.
Mit dem Licht kam noch so viel mehr … Geräusche. Gerüche. Oh, so viele Gerüche. Sie betäubten ihn, benebelten, reizten, überforderten ihn.
Er hörte schlagende Herzen. Roch Blut. Gargoyle. Faun. Schweiß. Erde. Blut. Blut …
Joaquin spürte, wie seine Fangzähne ausfuhren. Vampire brauchten fremdes Blut. Nicht häufig. Ein Schluck hier und da. Mehr im Wachstum, später genügten einzelne Tropfen. Blut bedeutete Lebenskraft und für Vampire pure Magie. Ohne Fremdblut starb ein Vampir nicht, doch ohne Blut konnte es kein Leben für sie geben.
Mehr Licht. Die Dunkelheit wurde ihm entrissen, so wie man Joaquin auch alles andere gestohlen hatte. Seine Freiheit. Sein Leben. Alles.
Er starrte in ein Gesicht. Nicht ganz Gargoyle. Natürlich nicht. Es war hellichter Tag. Gargoyles versteinerten am Tag. Dieser hier wusste das vielleicht nicht, denn er roch wie ein reinrassiger Gargoyle und sah dennoch entfernt menschlich aus und bewegte sich im Sonnenschein.
Nein – keine Sonne. Dichte Wolken. Das war gut. Vampire flohen vor der Sonne. Das Licht verletzte sie, ihre empfindlichen Augen. Der Schmerz, den das Licht über Joaquin brachte, war grausig und dennoch kein Vergleich zu dem, was er bereits durchlitten hatte.
Schwarze Gargoyle-Augen, die ihn ernst und aufmerksam musterten. Es war das Erste, was Joaquin zu Gesicht bekam nach Äonen in der Dunkelheit. Gerne hätte er länger hineingeblickt, in der Seele gelesen, die sie spiegelten. Der intensive Geruch von Blut weckte nun allerdings endgültig seinen Körper, brachte sein Herz zum Schlagen, seine Instinkte zum Brennen.
Er katapultierte sich ohne eigenen Willen aus seinem Grab heraus, stieß den Gargoyle zu Boden und versenkte seine Zähne in dem Hals seines wehrlosen Opfers.
Blut sprudelte ihm entgegen. Es schmeckte nach Stein und gab ihm nur wenig Kraft. Gargoyles waren keine geeignete Vampirnahrung. Darum ließ Joaquin nach zwei, drei hastigen Schlucken von diesem seltsamen Geschöpf ab. Der Gargoyle schrie nicht einmal, er starrte ihn bloß an. Beinahe, als wollte er ihn anflehen weiterzumachen. Ihm alles zu nehmen. Jeden Tropfen Blut. Jedes bisschen Kraft. Das Leben, das er anscheinend nicht wollte.
Knurrend wischte sich Joaquin über den Mund und wandte den Kopf ab. Es kostete ihn merkwürdig viel Willen, diese einfache Bewegung auszuführen. Sein Körper musste sich erst daran erinnern, wie er zu funktionieren hatte. Und dieser Gargoyle …
Er war unwichtig. Was zählte, war ausschließlich Blut. In seiner Nähe gab es lediglich Faune. Auch sie waren ungeeignet, aber etwas besser als Gargoyles. Darum sprang er ins Freie, ignorierte die Dinge, die er nicht verstand. Kästen aus Metall standen herum, bewegten sich, stanken nach Feuer und fremden Stoffen. Unwichtig. Was zählte, war Blut. Ein Faun. Er brüllte, als Joaquin ihn attackierte, ihm direkt in die Kehle biss, sich einige Schlucke des kostbaren Elixiers raubte. Dieses Blut war falsch, schlecht für ihn. Es verstärkte die Qualen seines gepeinigten Leibes. Gleichgültig. Es sollte ihn aufrechthalten, bis er Menschen fand. Menschen waren nicht zu weit entfernt. Vielleicht zwei-, dreihundert Meter, mehr konnte es nicht sein. Er musste dringend in den Schatten und dann auf die Jagd gehen.
Joaquin schlug den Faun nieder, überrannte drei weitere, die ihn mit Hacken und gesenkten Hörnern angreifen wollten. Floh vor der Sonne, die zwischen den Wolken hervorzubrechen drohte. Eilte dem Blut entgegen, das nach ihm rief.
Das Leben rief ihn. Ob er es haben wollte, darüber musste er nachdenken, wenn er wieder Kraft dafür hatte. Bis dahin musste er … Joaquin sank in die Knie, als Krämpfe ihn mit nie gekannter Macht überrollten. Er spuckte alles aus, was er zuvor getrunken hatte, was unbekömmlich, ja, giftig für ihn war. Er brauchte bessere Nahrung. Er brauchte …
Ein Mensch! Einsam, allein, in einer dunklen Gasse, die erbärmlich stank. Der Mensch stank noch erbärmlicher. Es kümmerte ihn nicht. Joaquin versenkte die Fangzähne brutal in den Hals des alten Mannes. Nahm ihm Blut und Leben, bis von beidem nichts mehr übrig war. Es stillte den Hunger. Nicht jedoch das Verlangen, die Sehnsucht. Es war nicht genug!
Es würde womöglich niemals mehr genug sein.
Memento vita! – Gedenke des Lebens
ie ein Wahnsinniger, wenn ich es dir doch sage! Billy hat es schwer erwischt. Glaubst du mir etwa nicht?“
Victor empörte sich. Das tat er sowieso am liebsten und Arthur bot ihm gerade die bestmögliche Angriffsfläche dafür. Elliot war einfach froh, dass er in seiner Ecke sitzen und sich einen fast sauberen Lappen gegen den Hals drücken konnte. Die Selbstheilungskräfte waren am Werk, wie üblich am Tag recht verlangsamt. Wäre es Nacht, könnte man längst nichts mehr von der Wunde sehen.
Arthur tauchte vor ihm auf und kauerte sich leise seufzend zu ihm nieder. Er war nicht mehr auf dem Höhepunkt von Jugend und Kräften, obwohl er nach wie vor ein stattlicher Faun war. In der Hierarchie der Hölle standen Faune trotz ihrer dämonischen Herkunft sehr weit unten auf der Liste der machtvollen Kreaturen. Ein wichtiger Grund, warum die Walddämonen freiwillig unter Menschen lebten.
„Lass mal sehen, Junge“, sagte er und zupfte ihm den Lappen aus den Fingern. Mit ernster Miene begutachtete er den Schaden, den der Vampir hinterlassen hatte. „In etwa einer Stunde sollte das hoffentlich gut sein“, murmelte er. „Bis dahin bleibst du still hier sitzen. Ich schicke jemanden, der dir Essen und Wasser besorgt. Und jetzt erzähl mal. Victor sagte, dass du den Vampir freigesetzt hast.“
Elliot stöhnte innerlich. Reden war mühsam. Die schönen Gedanken, die er stets hatte, die wunderbar ausgefeilten Sätze in seinem Kopf, sie verkrüppelten und verkümmerten jedes Mal, bevor er den Mund öffnen und sie in die Freiheit entlassen konnte. Das machte die Leute unruhig und ungeduldig, darum vermied er es, irgendetwas laut auszusprechen, wann immer es möglich war. Da er einsah, dass Arthur erfahren musste, was genau geschehen war und der Faun nun einmal nicht Gedankenlesen konnte, blieb ihm leider nichts anderes übrig.
„Das … Grab“, stammelte er, den Blick fest zu Boden gewandt. „Magisches Siegel. Kannte es nicht. Victor. Sagte, soll weitermachen. Kannte es auch nicht. Da war … dachte, es ist … Leiche. Tote Augen.“ Er schauderte bei der Erinnerung an das Gesicht, das nur noch pergamentdünne Haut gewesen war, die sich fahl und gelb über den Schädel spannte. An Augen, in denen der Schmerz der ganzen Welt zu brennen schien, als sie plötzlich zum Leben erwachten. Totenweiße Finger, vertrocknet und ausgezehrt wie der Rest des Körpers, hatten sich auf ihn zubewegt. Und dann lag Elliot plötzlich am Boden, der Vampir kauerte auf ihm und Schmerzen durchzuckten ihn am Hals. Das Gefühl, als der Vampir von seinem Blut trank, dieses gierige, schlürfende Geräusch – er würde es für den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen. „Ließ schnell los. Gargoyles können Vampire nicht nähren. Sah mich an.“ Er wedelte hilflos mit den Händen, versuchte dieses Meer aus Gefühlen zu beschreiben, in dem er in diesem Moment ertrunken war, als sein Blick erneut dem des Vampirs begegnete. Da war eindeutig Wahnsinn gewesen, verzweifelte Gier. Und noch etwas. Eine Art von Erkennen. Verlorene Seelen erkannten einander, das wusste Elliot. Und wenn dieser Vampir keine verlorene Seele war, dann wohl niemand. Wie lange hatte er wohl in diesem Grab gelegen, von einem magischen Siegel an der Flucht gehindert?
„Danach ist er einfach weitergelaufen, ja?“, fragte Arthur. Als Elliot stumm nickte, seufzte sein Chef. „Hat sich Billy geschnappt, aber auch sofort bemerkt, dass der ihn nicht weiterbringt. Faunenblut ist für Vampire genauso schädlich und übel wie Gargoyleblut. Zum Glück hat er Billy nicht die Luftröhre rausgerissen, wie Victor zuerst behauptet hat, sonst wäre der arme Kerl jetzt hin. Er wird es überleben, aber frühstens morgen wieder arbeiten können. Ein Ärgernis ist das!“ Er wies in Richtung des fast zerstörten Mausoleums. „Soweit ich weiß, hat das alte Herrenhaus über hundert Jahre leergestanden. Mindestens so lange hat der Vampir also unter der Grabplatte gelegen, unfähig zu sterben. Ich ruf am besten mal in London bei der Vampirgilde an und sag Bescheid, dass hier ein Problem durch Edinburgh läuft. Die müssen den Kerl erledigen, bevor der in seinem Wahnsinn, für den er noch nicht mal was kann, reihenweise Menschen leersaugt. Sobald sie ihn umgebracht haben, ist die Stadt wieder sicher und ein echt armer Teufel erlöst. Stell dir das mal vor, du bist da hundert Jahre und mehr gefangen, kannst dich nicht bewegen, nicht leben, nicht sterben … Brutal.“
Absolut brutal, ja. Elliot wollte sich das gar nicht näher vorstellen.
Arthur hielt sein Wort und versorgte ihn mit Essen. Es war nicht unbedingt üblich für Faune, sich an solche Versprechungen lange genug zu erinnern, um sie tatsächlich erfüllen zu können. Arthur gehörte zu der aufmerksamen Sorte. Sicherlich hatte das etwas mit seinem Erfolg als Firmenbesitzer in der Menschenwelt zu tun. Für Faune war es durchaus normal, Streitigkeiten mit einem Flötenwettbewerb zu bereinigen. Wer vom Publikum zum Sieger erklärt wurde, weil er die schönsten und seelenvollsten Klänge aus der Flöte herausgeholt hatte, gewann auch alles das, worum es im Streit gegangen war. Das konnte ein Erdbeertörtchen sein, das Recht über die Fernsehfernbedienung oder der gesamte Besitz des Fauns – Grenzen gab es da keine. Nun waren die Schotten vielleicht offener für Merkwürdigkeiten als die meisten anderen Menschen, und sicherlich würden sie sich zu einem Dudelsackwettbewerb überreden lassen, wenn der Einsatz tatsächlich bloß ein Erdbeertörtchen war. Geschäftsbeziehungen hingegen klärten sie doch lieber auf anderer Basis.
Für solche Dinge besaß Arthur ein Händchen und das war wundervoll für Elliot. Schon weil er heute kein Geld für Essen ausgeben musste und eine ganze Stunde regungslos in einer Ecke sitzen durfte, bevor er nach einer weiteren Inspektion für arbeitstauglich erklärt wurde.
Seine Gedanken blieben bei dem Vampir. Ob er wohl wirklich von seinen Artgenossen umgebracht werden würde? Und ob er das als Erlösung empfand? Elliot war sich nicht ganz sicher. Nur weil das Leben eine einzige Qual war, eine Aneinanderreihung von Schmerz, Elend und noch mehr Schmerz, bedeutete das nicht, dass man sich zwangsläufig nach dem Tod sehnen musste. Es gab keinen logischen Grund, leben zu wollen. Rein von der Logik her war Leben stets zerstörerisch, quälend, gefährlich. Um überleben zu können, musste man andere Existenzen vernichten, gleichgültig, ob man sich von Tieren oder Pflanzen ernährte – auch Pflanzen waren Lebewesen. Die Gefahr, dass man irgendwann getötet wurde, um einer Kreatur als Nahrung zu dienen, war umso größer, je weiter man den Begriff „Kreatur“ zog. Auch Viren, Bakterien, Pilze waren Kreaturen … Nein, das Leben barg keine Logik als solches in sich. Im Gegensatz zum Tod. Der Tod war das natürliche Ende einer Existenz, zwangsläufig und unabdingbar. Selbst für mystische Geschöpfe wie Vampire und Dämonen. Manchmal dauerte es vielleicht länger, aber irgendwann endete es für jeden.
In genau dieser Unabdingbarkeit hatte Elliot bislang noch stets den besten Grund gefunden, weitermachen zu wollen. All das Chaos, alles Leid, aller Schmerz, es würde enden, gleichgültig was er tat. Warum also nicht weiterleben, entgegen jeglicher Logik? Es war ja nicht so, als wäre Logik zwingend erforderlich, um leben zu können. Er für seinen Teil lebte ganz hervorragend ohne das geringste bisschen Logik.
Wenn es dem Vampir ähnlich wie ihm erging, dann würde er sich jedenfalls nicht willig an die nächste Wand stellen und dort glücklich darauf warten, dass seine Artgenossen ihm das Lebenslicht ausbliesen. Er würde sich wehren, um das kämpfen, was ihm gehörte, was ihm hundert Jahre oder länger erhalten geblieben war. Weil er sich entgegen jeder Logik nach dem Leben sehnte.
Elliot saß auf den kläglichen Überresten des Mausoleums und betrachtete das zerstörte magische Siegel. Heute war auf seltsame Weise sein Glückstag, oder vielmehr seine Glücksnacht, denn Arthur hatte ihn gebeten, heute Nacht die Baustelle zu bewachen. Normalerweise wurde von ihm stillschweigend erwartet, dass er nach Sonnenuntergang und seiner Rückverwandlung in seine natürliche Gestalt das Gebiet der Faune und Nymphen verließ und ins Gargoyle-Viertel von Edinburgh wechselte. An dieses ungeschriebene Gesetz hielt er sich. Dass er heute bleiben durfte, ersparte ihm eine ganze Nacht voll Demütigungen und Schlimmeres seitens der Gargoyles. Im Gegenzug hielt er Wache, die natürlichste Aufgabe für einen Gargoyle, der er in seinem Leben kaum je hatte nachkommen dürfen.
Laut Arthur sollte die Gefahr, dass der Vampir zurückkehrte, verschwindend gering sein. Dennoch wollte er lieber kein Risiko eingehen und hatte ihn darum gebeten, bis nach Mitternacht Wache zu halten. Danach durfte er in den Bauwagen und dort schlafen, bis Victor kam und ihn weckte. Zwar war es genauso viel oder wenig wahrscheinlich, dass der Vampir in genau dieser Zeit vorbeischaute, aber es war die einzige Möglichkeit, wie Arthur sich einen Gehaltsaufschlag für Elliot ersparen und ihn morgen früh auf der Baustelle einsetzen konnte. Es war also ein Kampf gewesen, ein bisschen Sicherheit zu bekommen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Solche Konflikte waren für Elliot amüsant zu beobachten, auch wenn er das niemals offen zeigen oder gar aussprechen würde. Armer Arthur!
Die Nacht war ruhig. Gelegentlich trug der Wind Wortfetzen aus den umliegenden Häusern heran. Streitende Faune. Müde Kinder. Junge Nymphen auf der Suche nach Männern. Liebende. Menschliche Spaziergänger mit ihren Hunden, die nichts von den Mythischen in ihrer Nähe ahnten. Dazwischen streunende Katzen, Ratten und …
Etwas ließ Elliot aufmerken. Es war mehr ein Gefühl als ein Geräusch oder eine Witterung. Da! Ein Rascheln. Stoff, der aneinanderrieb, vom Wind bewegt. Eine Präsenz, die sich vorsichtig näherte.
Elliot grollte drohend, richtete sich hoch auf, um sich sichtbar zu machen. Er atmete tief durch, machte sich bereit zum Kampf, auf den er sich tatsächlich freute. Von einer Horde jugendlicher Gargoyles gejagt zu werden war armselig. Einem Gegner die Klauen zu zeigen, während er seiner Pflicht als Wächter nachkam, das war die Erfüllung eines Lebenstraums.
Eine hoch aufgerichtete Gestalt trat in das Licht der Straßenlaterne, dessen Kegel bis weit in die Baustelle hineinreichte. Es war der Vampir! Elliot erkannte seine Witterung sofort wieder. Inzwischen war sie deutlich kräftiger und gesünder.
Er spreizte die Flügel, segelte zu der regungslosen Gestalt hinüber und baute sich vor ihr auf.
„Was willst du?“, grollte er dumpf, stolz auf sich selbst, dass er diese Worte vollständig und ohne zu stammeln hervorgebracht hatte.
„Dich wiedersehen“, entgegnete der Vampir leise. Er hatte sich Kleidung besorgt, trug einen schwarzen Mantel aus edlem Stoff statt der staubigen Überreste altmodisch geschnittenem Samtes. „Du bist also tatsächlich ein Gargoyle, obwohl du am Tag laufen konntest?“
Schweigend schob sich Elliot ein Stück weiter an das Licht heran, präsentierte sein Gesicht. Das sollte sämtliche Fragen beantworten. Interessiert beugte sich der Vampir näher zu ihm heran, ohne ihn zu berühren – so dumm war er nicht.
„Deine Eltern waren reinblütig, da bin ich sicher. Der Mensch hat sich also noch weiter zurück in den Stammbaum eingeschlichen.“ Ruhig sprach er, der Vampir. Er hatte eine altmodische Art, die Worte zu betonen, manche Laute auszusprechen. Nichts war mehr von dem loderndem Wahnsinn zu spüren, der ihn heute Nachmittag nahezu vollständig beherrscht hatte. Schmerzen litt er dennoch, er hatte nach wie vor etwas Ausgezehrtes an sich und allzu tief unter der Oberfläche würde der Wahn wohl nicht verborgen sein. War es da ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass er sich für einen entstellten Gargoyle interessierte?
„Was willst du?“, wiederholte Elliot.
„Dich sehen … Ich wusste nicht, wohin. Ich habe einige Stunden damit zugebracht, im Archiv zu lesen, um zu begreifen, was mit der Welt geschehen ist in diesen über zweihundert Jahren, in denen ich eingesperrt war. Ich begreife es leider nicht, muss ich gestehen. Alles ist fremd.“
Das Archiv war ein magischer Ort. Es kam immer wieder vor, dass mystische Kreaturen für einige Jahre Dämmerschlaf hielten. Bei manchen Nymphenarten gehörte es zum natürlichen Lebenszyklus, auch bei Wurzelgnomen kam dies häufiger vor. Damit sie nicht den Anschluss verloren, wurden von den Musen, namentlich die Muse Klio, Archive in sämtlichen Metropolen und größeren Städten der Welt betrieben. Hier waren in der Regel ein bis zwei Dutzend Schreiberinnen eingestellt, sogenannte Musenbeauftragte, die den lieben langen Tag nichts anderes taten, als die Ereignisse und Entwicklungen sowohl der Welt als auch der lokalen Umgebung festzuhalten. Geschlecht und mythische Rasse der Schreiber waren nicht per Gesetz festgelegt, gelegentlich waren es niedere Wissensdämonen, die dankbar waren, kein elendes Dasein in der Hölle fristen zu müssen. In den meisten Fällen jedoch handelte es sich um rekrutierte menschenstämmige Frauen, die von den Musen handverlesen ausgewählt und mit imposanten Kräften ausgestattet wurden. Ausschließlich Mythische konnten diese Archive aufsuchen. Es waren neutrale Orte, an denen man vollkommen sicher vor Verfolgung war.
Der Vampir zitterte mittlerweile leicht, er wirkte schrecklich schwach und ausgezehrt, schien Schwierigkeiten zu haben, sich zu fokussieren. Elliot machte sich bereit, sollte eine plötzliche Attacke erfolgen. Doch sein Gegenüber fing sich wieder, wischte sich ruhelos über das Gesicht, als wollte er sich vergewissern, dass es noch da war, wo es hingehörte.
„Es ist seltsam zu sehen, was mit der Welt geschehen ist in der Zeit, in der ich schlief. Die Menschen sind weit gekommen. Alles ist anders. Wie konnte das geschehen?“
Das wusste niemand genau. Elliot dachte an eine Theorie, die er vor einiger Zeit gelesen hatte – hunderte Jahre lang hatten die Menschen von früh bis spät verdünntes Bier getrunken, weil das Wasser in den Städten von Exkrementen verseucht war. Vom Säugling bis zum Greis standen die Leute also stets unter Alkoholeinfluss und hatten gar nicht den Ehrgeiz, geschweige denn die Kraft für revolutionäre Gedanken und große Erfindungen. Dann begannen sie Tee und Kaffee zu trinken, die Kanalisationen wurden saniert, die Wasserleitungen in allen Städten erneuert, um die ewigen Typhus- und Ruhrepidemien in den Griff zu bekommen. Und schwupps! Schon schlug die französische Revolution los, alles redete von Demokratie, das Zeitalter der Industrialisierung begann, die Kirche wurde abgesägt … Vielleicht war es ein kühner Gedanke, dass der Zugang zu gutem Wasser und der Massenkonsum von Kaffee etwas mit dem Quantensprung in der Geschichte der Menschheit zu tun haben könnte, aber es war zumindest eine nette Idee. Statt sie ausführlich zu erklären, wie Elliot es eigentlich vorhatte, platzte bloß ein: „Kaffee?“ aus ihm heraus, wofür der Vampir ihn anstarrte, als würde er gerade erst erkennen, mit was für einem Dorftrottel er es hier zu tun hatte. So gerne würde Elliot diesen Fehler korrigieren, ihm beweisen, dass er keineswegs dämlich war. Leider gingen ihm sämtliche Worte verloren, wie meistens, wenn er sich aufregte.
Der Vampir lächelte seltsam. Es betonte seine dunklen Augen, gab ihm einen traurigen Ausdruck.
„Kaffee will ich gerne probieren, ja. Ich muss so viel wie möglich essen, damit ich keinen anderen Menschen mehr erlege. Ich habe einen Bettler getötet. Es ging nicht anders.“
Er bebte erneut heftig. Es galt als unanständig und Zeichen von Kontrollverlust, wenn ein Vampir eines seiner Opfer tötete. Für gewöhnlich benötigten die Kinder der Nacht, wie sie sich selbst gerne nannten, bloß wenige Tropfen des Lebenselixiers.
„Man sucht nach dir“, stieß Elliot nervös hervor. „Die Gilde. Sie wurde benachrichtigt.“
„Ja, das dachte ich mir … Sie werden feststellen, dass ich meinen Unrat aufgeräumt habe. Den Bettler habe ich sorgfältig zugerichtet und an einem schattigen Ort unter einer Brücke am Ufer der Leith abgelegt. Dort, wo viele Ratten und streunende Katzen sind. Wenn man ihn morgen früh findet, wird sein Leichnam gewiss stark genug angefressen und verwüstet sein, dass die Todesursache nicht mehr festzustellen ist. Das Geheimnis bleibt bewahrt. Mehr interessiert die Gilde nicht. Mehr hat sie nie interessiert.“ Das Beben wurde stärker und Elliot spürte, dass er Mitleid für diesen Mann hegte. Was er durchgemacht hatte, ließ sich kaum in Worte fassen. Wie er sich an diese neue Welt anpassen sollte, war ein Rätsel.
„Es ist schön, wie viele alte Häuser noch stehen. Ich habe einiges wiedererkannt, während ich mit dem Toten in meinen Armen über die Dächer eilte, von Schatten zu Schatten, ungesehen von den Menschen. Dieser Teil meiner Fähigkeiten hat nicht gelitten, es war erstaunlich … Die Maschinen machen mir im Moment noch Angst. So viele Maschinen. Ich … Ich muss essen.“ Er wandte sich halb um. Bevor er enteilen konnte, fragte Elliot rasch:
„Wie heißt du? Wer bist du?“ Unbehaglich wurde ihm bewusst, dass er den Vampir besser respektvoll angesprochen hätte, denn mit absoluter Sicherheit war er eine hochgestellte Persönlichkeit. Mit rangniedrigen Vampiren wäre nicht so wie mit ihm verfahren worden. Jetzt war es wohl zu spät, damit zu beginnen und es schien den Vampir glücklicherweise auch nicht weiter zu interessieren.
„Mein Name … Ich war Joaquin. Joaquin de la Sorbonne.“ Er lachte, als wäre dies ein Scherz, dabei war seine Familie einst extrem machtvoll gewesen. „Der Familienbesitz steht noch. Weißt du, was mit den de la Sorbonne geschehen ist? Wobei, heute würden sie natürlich vollkommen andere Namen tragen …“
„Es tut mir leid“, stammelte Elliot. „Die de la Sorbonne wurden vollständig vernichtet. Genau wie die Russelcourt, die dafür verantwortlich waren. Deine Familie gibt es nicht mehr.“ Er wich sicherheitshalber einen Schritt zurück, für den Fall, dass diese Worte einen Gewaltausbruch zur Folge haben sollten. Doch Joaquin blieb unbewegt, äußerlich zumindest.
„Ich dachte es mir. Dachte es mir schon, als ich die leeren Fenster und den verwilderten Grund sah … Dass die Russelcourt fort sind, wusste ich. Dies sind schließlich die Überreste von dem, was einst groß und bewundernswert war.“ Ein neuerliches Lachen, das wie ein Schluchzen klang. „Wie ist dein Name, Gargoyle? Du hast keinen Clan, vermute ich?“ Er streckte die Hand nach ihm aus.
Erschrocken wich Elliot zurück, fürchtete sich vor dem Schlag, den er erwartete. Erst als Joaquin mit trauriger Miene die Hand sinken ließ, wurde ihm klar, dass es eine freundliche Geste gewesen war. So etwas kannte er nicht. Niemand berührte ihn freundlich, alle wollten ihn bloß schlagen oder von sich stoßen … Oder für ihre eigenen Zwecke missbrauchen, wie die Nymphen.
„Elliot“, stammelte er. „Ich bin Elliot. Kein Clan. Meine Familie musste mich fortschicken.“ Seine Mutter hatte es bedauert. Das hatte er in ihrem Blick gesehen. Sie hatten ihn nicht aus Hass fortgeschickt, sondern zu seinem eigenen Schutz. Innerhalb des Clans hatte er damals keine Überlebenschancen mehr gehabt, zu groß war die Verachtung und sein Welpenschutz als Junggargoyle verloren gewesen. Allein auf sich gestellt waren seine Chancen besser, was sich bewahrheitet hatte, da er es bis heute geschafft hatte, durchzukommen.
„Ich danke dir, Elliot ohne Clan“, sagte Joaquin und verneigte sich vor ihm. „Es mag nicht deine Absicht gewesen sein. Dennoch hast du mir zurück ins Leben geholfen. Sowohl mit deiner Spitzhacke als auch gerade mit deinen Worten. Ich wünsche dir Glück und ein zufriedenes Leben.“