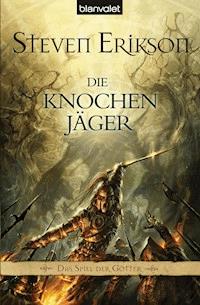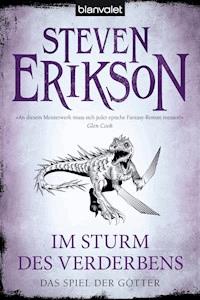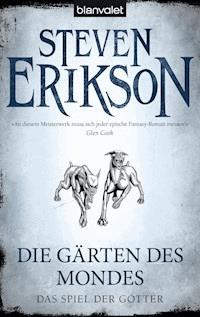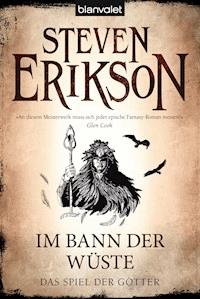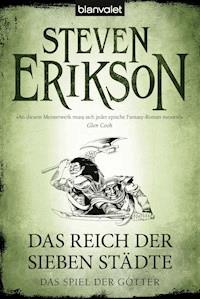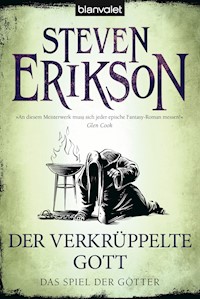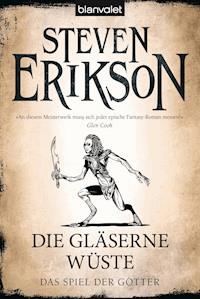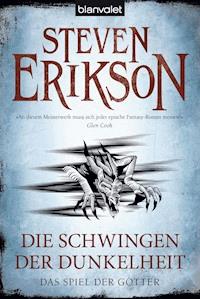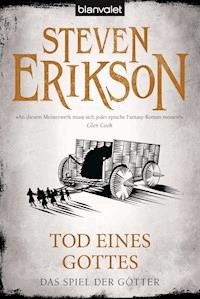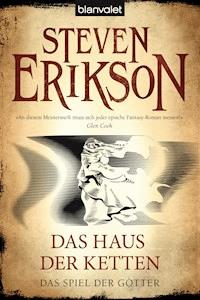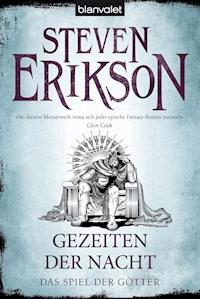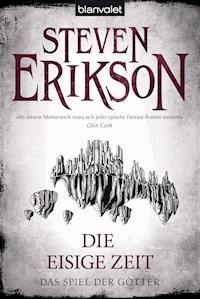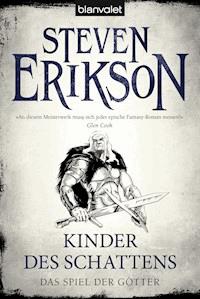9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Spiel der Götter
- Sprache: Deutsch
Rutt und Badalle sind auf der Flucht vor den Inquisitoren, und mit ihnen noch Tausende weiterer Kinder. Irgendwie sind Rutt und Badalle die Anführer der Flüchtlinge geworden, und sie geben ihr Bestes. Dennoch müssen sie jeden Tag mit ansehen, wie einige ihrer Freunde und Schützlinge sterben. Da erreichen sie endlich die Glaswüste, das Ziel ihrer Hoffnung – oder ihres endgültigen Untergangs.
Mit dieser komplexen epischen Fantasy-Saga wurde Steven Erikson zu einem der bedeutendsten Vertreter der modernen Fantasy.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 946
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Rutt und Badalle sind auf der Flucht vor den Inquisitoren, und mit ihnen noch Tausende weiterer Kinder. Irgendwie sind Rutt und Badalle die Anführer der Flüchtlinge geworden, und sie geben ihr Bestes. Dennoch müssen sie jeden Tag mit ansehen, wie einige ihrer Freunde und Schützlinge sterben. Da erreichen sie endlich die Glaswüste, das Ziel ihrer Hoffnung – oder ihres endgültigen Untergangs.
Autor
Steven Erikson, in Kanada geboren, lebt heute in Cornwall. Der Anthropologe und Archäologe feierte 1999 mit dem ersten Band seines Zyklus Das Spiel der Götter nach einer sechsjährigen akribischen Vorbereitungsphase seinen weltweit beachteten Einstieg in die Liga der großen Fantasy-Autoren.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Steven Erikson
Die Flucht der Kinder
Das Spiel der Götter 16
Deutsch von Tim Straetmann
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Dust of Dreams, Part 1« bei Bantam Press, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2009 by Steven Erikson
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Sigrun Zühlke
Umschlaggestaltung und -illustration: Inkcraft
Karte: © Andreas Hancock
HK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-20272-9V003www.blanvalet.de
Karte
Vor zehn Jahren wurde mir von ganz unerwarteter Seite – nämlich von einem Autor, den ich immer respektiert und bewundert habe – Unterstützung zuteil. Die Freundschaft, die aus jenem Augenblick entstand, weiß ich sehr zu schätzen. Und so widme ich diesen Roman voller Zuneigung und Dankbarkeit Stephen R. Donaldson.
Vorbemerkung des Autors
Obwohl ich natürlich nicht gerade dafür bekannt bin, superdicke Bücher zu schreiben, war mir immer klar, dass der Umfang des Bandes, mit dem »The Malazan Book of the Fallen« eines Tages enden würde, mit moderner Buchbindetechnologie nicht zwischen zwei Buchdeckel zu pressen sein würde. Bis heute habe ich es vermieden, mit Cliffhangern zu arbeiten, in erster Linie, weil ich es als Leser immer gehasst habe, warten zu müssen, bis ich herausfinden konnte, wie es weitergeht. Doch leider ist Dust of Dreams die erste Hälfte eines zweibändigen Romans, der mit The Crippled God abgeschlossen werden wird. Das heißt, dass diejenigen, die nach der Auflösung diverser Handlungsstränge suchen, nicht fündig werden. Außerdem gibt es keinen Epilog, und von seiner Struktur her folgt Dust of Dreams nicht dem bei einem Roman üblichen Handlungsbogen. Alles, was ich meinen Lesern und Leserinnen dazu sagen kann, ist: Bitte, habt Geduld. Ich weiß, dass ihr das könnt: Immerhin habt ihr es schon geschafft, bis jetzt zu warten, oder?
Steven EriksonViktoria, B. C.
Prolog
Ebene von Elan, westlich von Kolanse
Erst kam das Licht und dann die Hitze.
Er kniete auf dem Boden und legte den brüchigen Stoff vorsichtig in immer neue Falten, denn er wollte sichergehen, dass der Säugling nicht der Sonne ausgesetzt war. Er zupfte die Kapuze zurecht, bis schließlich ein kaum mehr als faustgroßes Loch blieb, in dem das Gesicht des kleinen Mädchens nur ein grauer Fleck in der Dunkelheit war. Dann hob er sie sanft auf und legte sie sich in die linke Armbeuge. Nichts von dem, was er tat, bereitete ihm Mühe.
Sie lagerten in der Nähe des einzigen Baums weit und breit, aber nicht darunter. Es war ein Gamleh-Baum, und die Gamlehs waren zornig auf Menschen. Gestern in der Abenddämmerung hatten unzählige aufgeregt flatternde graue Blätter an seinen Zweigen gehangen, zumindest, bis sie näher herangekommen waren. Heute Morgen waren die Zweige kahl.
Rutt stand da und blickte nach Westen, während er den Säugling festhielt, den er Gehalten genannt hatte. Die Gräser waren farblos. An manchen Stellen waren sie vom trockenen Wind weggescheuert worden, einem Wind, der den Staub um ihre Wurzeln weggeweht und die blassen Knollen freigelegt hatte, so dass die Pflanzen verdorrten und starben. Manchmal blieb Geröll zurück, wenn der Staub und die Knollen verschwunden waren. Und manchmal auch nur Grundgestein, schwarz und zerfurcht. Die Ebene von Elan verlor die Haare, aber das war etwas, das Badalle vielleicht sagen würde, die grünen Augen auf die Worte in ihrem Kopf gerichtet. Sie verfügte über eine besondere Gabe, das stand außer Frage, aber wie Rutt wusste, war manche Gabe in Wirklichkeit ein Fluch.
Badalle kam auf ihn zu; ihre sonnenverbrannten Arme waren so dünn wie Storchenhälse, die herunterhängenden Hände mit Staub überzogen; sie wirkten neben ihren dürren Oberschenkeln übergroß. Sie pustete die Fliegen weg, die ihren Mund verkrusteten, und sagte in ihrem typischen Singsang:
»Rutt hält Gehalten
Wickelt sie gut
Am frühen Morgen
Und steht dann auf …«
»Badalle«, sagte er, obwohl er wusste, dass sie mit ihrem Gedicht noch nicht fertig war, und genauso wusste er, dass sie sich nicht drängen lassen würde. »Wir leben noch.«
Sie nickte.
Diese wenigen Worte von ihm waren zu einem Ritual geworden, auch wenn in diesem Ritual immer noch ein bisschen Überraschung, eine leichte Ungläubigkeit mitschwang. Die Necker waren letzte Nacht besonders schlimm gewesen, aber die gute Nachricht war, dass sie die Väter vielleicht endlich hinter sich gelassen hatten.
Rutt rückte den Säugling, den er Gehalten genannt hatte, auf seinem Arm zurecht, dann setzte er sich auf geschwollenen Füßen humpelnd in Bewegung. Nach Westen, ins Herz der Ebene von Elan.
Er brauchte sich nicht umzudrehen, um zu sehen, dass die anderen ihm folgten. Zumindest die, die es noch konnten. Die anderen würden von den Neckern geholt werden. Er hatte nicht darum gebeten, der Kopf der Schlange zu sein. Er hatte um überhaupt nichts gebeten, aber er war der Größte und vielleicht auch der Älteste. Vielleicht war er dreizehn, es könnte aber auch sein, dass er vierzehn war.
Hinter ihm sagte Badalle:
»Und er fängt an zu gehen
An diesem Morgen
Mit Gehalten in den Armen
Und sein gerippter Schwanz
Der schlängelt sich
Wie eine Zunge
Von der Sonne.
Du brauchst die längste
Zunge
Wenn du nach Wasser
Suchst
Wie es die Sonne so gerne macht …«
Badalle beobachtete ihn einige Zeit, beobachtete, wie die anderen sich ihm anschlossen. Sie würde sich schon bald zum gerippten Schwanz gesellen. Sie pustete die Fliegen weg, aber natürlich kamen sie gleich wieder zurück, sammelten sich um die Geschwüre, die ihre Lippen dick machten, hopsten nach oben, um an ihren Augenwinkeln zu lecken. Früher einmal war sie eine Schönheit gewesen, mit ihren grünen Augen und den langen blonden Haaren, die wie goldene Tressen ausgesehen hatten. Aber mit Schönheit kann man sich nur für gewisse Zeit ein Lächeln erkaufen. Wenn die Speisekammer leer ist, wird die Schönheit schmutzig. »Und die Fliegen«, flüsterte sie, »verleihen dem Leiden ein Muster. Und Leiden ist hässlich.«
Sie beobachtete Rutt. Er war der Kopf der Schlange. Und er war auch ihre Reißzähne, aber Letzteres war nur ihr ganz persönlicher Witz.
Diese Schlange hatte vergessen, wie man aß.
Sie war bei denen gewesen, die aus dem Süden heraufgekommen waren, aus Korbanse, Krosis und Kanros. Sogar von den Otpelas-Inseln. Sie alle hatten ihr Zuhause verlassen – Häuser und Wohnungen, die nur noch leere Hüllen waren. Manche waren genau wie sie an der Küste des Pelasischen Meeres entlanggewandert und dann zum westlichen Rand von Stet, das einst ein großer Wald gewesen war, und dort hatten sie die hölzerne Straße gefunden, die sie manchmal Stumpfstraße nannten. Bäume waren in flache Scheiben geschnitten und die Scheiben dann in den Boden gehämmert worden, in Reihen, die weiter und immer weiter führten. Andere Kinder kamen aus Stet selbst; sie waren den alten Flussbetten gefolgt, die sich durch den grauen Wirrwarr aus zerschmetterten umgestürzten Bäumen und kranken Sträuchern wanden. Es gab Anzeichen dafür, dass Stet einst ein Wald gewesen war und sein alter Name – Stetwald – zu ihm gepasst hatte, aber Badalle war nicht gänzlich überzeugt – alles, was sie sehen konnte, war ein zerfurchtes Ödland, zerstört und verwüstet. Nirgendwo standen noch Bäume. Sie nannten die Straße Stumpfstraße, aber zu anderen Zeiten war sie die Waldstraße, und auch das war ein persönlicher Witz.
Natürlich hatte irgendjemand jede Menge Bäume gebraucht, um die Straße zu machen, also war da früher vielleicht wirklich ein Wald gewesen. Aber jetzt war er weg.
Am nördlichen Rand von Stet, dort, wo es an die Ebene von Elan grenzte, waren sie auf eine weitere Kolonne aus Kindern gestoßen, und einen Tag später war noch eine zu ihnen gestoßen, von oben aus dem Norden, direkt aus Kolanse, und an der Spitze dieser Kolonne war Rutt gewesen. Der Gehalten getragen hatte. Er war groß, mit herausstehenden Schultern, Ellbogen, Knien und Knöcheln, und die Haut um die Gelenke herum war schlaff und gedehnt. Er hatte große, leuchtende Augen. Er hatte immer noch alle Zähne, und wenn der Morgen dämmerte, war er da, jeden Morgen – am Kopf der Schlange. Die Reißzähne – der Rest folgte ihm einfach.
Sie alle glaubten, dass er wusste, wo er hinging, aber sie fragten ihn nicht, denn der Glaube war wichtiger als die Wahrheit, die besagte, dass er genauso verloren war wie alle anderen.
»Jeden Tag hält Rutt Gehalten
Und hält sie
Eingewickelt
In seinem Schatten.
Es ist schwer,
Rutt nicht zu lieben
Aber Gehalten tut es nicht
Und niemand außer Rutt
Liebt Gehalten.«
Visto war aus Okan gekommen. Als die Hungernden und die knochenhäutigen Inquisitoren auf die Stadt zumarschiert waren, hatte seine Mutter ihm gesagt, dass er weglaufen sollte, Hand in Hand mit seiner Schwester, die zwei Jahre älter war als er, und sie waren die Straßen entlanggerannt, zwischen brennenden Gebäuden hindurch, und Schreie hatten die Nacht erfüllt, und die Hungernden hatten Türen eingetreten und Leute nach draußen gezerrt und schreckliche Dinge mit ihnen gemacht, während die Knochenhäutigen zugeschaut und gesagt hatten, es sei notwendig, das alles sei notwendig.
Sie hatten seine Schwester von ihm weggerissen, und ihr Schrei hallte immer noch durch seinen Schädel. Seit damals plagte er ihn jede Nacht auf der Straße des Schlafs, von dem Augenblick, da ihn die Erschöpfung übermannte, bis zu dem Moment, wenn er im bleichen Angesicht der Morgendämmerung aufwachte.
Er war eine Ewigkeit lang gerannt, so kam es ihm vor, nach Westen und weg von den Hungernden. Hatte gegessen, was er konnte, und war immer durstig gewesen, und als er die Hungernden abgehängt hatte, waren die Necker aufgetaucht, große Meuten ausgezehrter Hunde mit rotgeränderten Augen, die sich vor überhaupt nichts fürchteten. Und dann die Väter, ganz in Schwarz gehüllt, die über die zerlumpten Lager auf den Straßen herfielen und Kinder stahlen, und einmal waren er und ein paar andere auf einen ihrer älteren Übernachtungsplätze gestoßen und hatten mit eigenen Augen die kleinen, geborstenen, grau und blau gesprenkelten Knochen in den Kohlen der Feuerstelle gesehen und auf diese Weise begriffen, was die Väter mit den Kindern machten, die sie sich holten.
Visto erinnerte sich daran, wie er den Stetwald zum ersten Mal gesehen hatte, eine Reihe kahler Hügel voller herausgerissener Baumstümpfe und Wurzeln, die ihn an einen der Friedhöfe erinnerten, die die Stadt umgaben, die seine Heimat gewesen war, und die aufgegeben worden war, nachdem das letzte Stück Vieh geschlachtet worden war. Und genau in jenem Moment, als Visto auf das geblickt hatte, was einst ein Wald gewesen war, war ihm klar geworden, dass die ganze Welt jetzt tot war. Es war nichts mehr übrig, und es gab keinen Ort mehr, wohin man gehen konnte.
Und dennoch trottete er weiter, einfach nur noch eins von vielen Kindern; es mussten Zehntausende sein, vielleicht sogar noch mehr, eine Straße aus Kindern, viele Meilen lang, und für alle, die unterwegs starben, kamen neue hinzu, die ihren Platz einnahmen. Er hätte nie gedacht, dass es so viele Kinder gab. Sie waren wie eine große Herde, die letzte große Herde, die einzige Nahrung und Nahrungsquelle für die letzten, verzweifelten Jäger auf der Welt.
Visto war vierzehn. Er hatte seinen Wachstumsschub noch nicht gehabt, und jetzt würde er niemals mehr einen bekommen. Sein Bauch war rund und steinhart, und er stand so weit vor, dass sein Rücken ein einziges Hohlkreuz war. Er ging wie eine schwangere Frau, breitbeinig und mit schmerzenden Knochen. Er war voller Satrareiter, die Würmer in seinem Körper schwammen und wurden von Tag zu Tag größer. Wenn sie – schon bald – bereit waren, würden sie aus ihm hervorquellen. Aus seiner Nase, seinen Augenwinkeln, aus seinen Ohren, seinem Bauchnabel, aus seinem Penis und seinem Poloch und aus seinem Mund. Und für diejenigen, die Zeuge des Ganzen wurden, würde es aussehen, als würde die Luft aus ihm herausgelassen, seine Haut würde sich runzeln, würde in vielen, über seinen ganzen Körper verlaufenden Falten in sich zusammensacken. Er würde sich schlagartig in einen alten Mann verwandeln. Und dann würde er sterben.
Visto wartete fast schon ungeduldig darauf, dass es so weit war. Er hoffte, die Necker würden seinen Leichnam fressen und damit auch die von den Satrareitern zurückgelassenen Eier verschlingen, sodass auch sie sterben würden. Noch besser wäre es, wenn die Väter … aber die waren nicht so dumm, dessen war er sich sicher – nein, die würden ihn nicht anrühren, und das war zu blöd.
Die Schlange ließ den Stetwald hinter sich, und die hölzerne Straße wurde von einem Händlerpfad aus staubigem, von Furchen durchzogenem Dreck abgelöst, der sich auf die Ebene von Elan hinaus wand. Also würde er auf der Ebene sterben, und sein Geist würde das verschrumpelte Ding, das einmal sein Körper gewesen war, hinter sich lassen und die lange Reise zurück nach Hause beginnen. Um seine Schwester zu suchen. Um seine Mutter zu suchen.
Und schon jetzt war sein Geist des Gehens müde, so müde …
Am Ende des Tages zwang sich Badalle, ein altes elanesisches Hünenbett zu erklimmen, an dessen hinterem Ende sich ein uralter Baum mit grauen, flatternden Blättern erhob. Oben angekommen drehte sie sich um und schaute zurück auf die Straße, nach Osten, so weit sie die endlose Reise dieses Tages mit den Augen zurückverfolgen konnte. Jenseits des ausgedehnten Lagers sah sie eine schwankende Linie aus Körpern, die sich bis zum Horizont erstreckte. Dies war ein besonders schlechter Tag gewesen – zu heiß, zu trocken, das einzige Wasserloch ein Tümpel aus fauligem, mit Ungeziefer verseuchtem Schlamm und voller verrottender Insektenpanzer, die wie toter Fisch schmeckten.
Sie stand da und schaute eine sehr lange Zeit auf den gerippten Schwanz der Schlange. Diejenigen, die auf der Straße zusammenbrachen, wurden nicht beiseitegeschoben, man trampelte einfach auf ihnen herum oder stieg über sie hinweg, und daher war die Straße jetzt eine Straße aus Fleisch und Knochen, flatternden Haarsträhnen, und – wie sie wusste – blicklos starrenden Augen. Die Schlange der Rippen. Chal Managal auf Elanesisch.
Sie pustete Fliegen von den Lippen.
Und sprach ein weiteres Gedicht:
»An diesem Morgen
Haben wir einen Baum gesehen
Mit grauen Blättern
Und als wir näher kamen
Sind die Blätter weggeflogen.
Um die Mittagszeit ist der namenlose Junge
Mit der angefressenen Nase
Hingefallen und hat sich nicht mehr bewegt
Und herunter kamen die Blätter
Um zu fressen.
In der Abenddämmerung war da ein anderer Baum
Mit grau flatternden Blättern
Die sich für die Nacht niederließen
Wenn der Morgen kommt
Werden sie wieder fliegen.«
Ampelas Verwurzelt, die Ödlande
Die Maschinerie war mit öligem Staub bedeckt, der in der Dunkelheit glänzte, als der schwache Schimmer des Laternenlichts über ihn hinwegglitt und das Gefühl von Bewegung vermittelte, wo es keine gab – die Illusion eines lautlosen Gleitens, wie von reptilischen Schuppen, was – wie immer – grausam passend wirkte. Sie atmete schwer, während sie den schmalen Korridor entlangeilte und sich dabei dann und wann duckte, um den klobigen schwarzen Kabeln auszuweichen, die von der Decke hingen. Ihre Nase und ihre Kehle brannten von dem widerlichen metallischen Geruch der eingeschlossenen, stehenden Luft. Hier, inmitten der entblößten Eingeweide von Wurzel, fühlte sie sich vom Unbegreiflichen belagert, den unermesslichen Geheimnissen grässlicher Arkana. Doch sie hatte diese unbeleuchteten, verlassenen Korridore zu ihrem Lieblingsplatz erkoren und war sich dabei all der selbstanklagenden Beweggründe, die zu dieser Entscheidung geführt hatten, vollauf bewusst.
Die Wurzel lud all diejenigen ein, die sich verirrt hatten, und Kalyth hatte sich in der Tat verirrt. Es war nicht so, dass sie sich in den zahllosen, sich windenden Korridoren oder den riesigen Räumen voll schweigender, erstarrter Maschinen nicht zurechtfand oder den Löchern im Fußboden, über die niemals Platten gelegt worden waren, nicht ausweichen oder sich nicht von dem Chaos aus Metall und Kabeln fernhalten konnte, das aus unverkleideten Wänden quoll – nein, nachdem sie monatelang hier umhergewandert war, kannte sie sich inzwischen sehr gut aus. Der Fluch hilfloser, hoffnungsloser Verwirrung betraf ihren Geist. Denn sie war nicht diejenige, die sie in ihr sehen wollten, und nichts, was sie sagte, konnte sie davon überzeugen.
Sie war als Mitglied eines Stammes auf der Ebene von Elan geboren worden. War dort herangewachsen, vom Kind zum Mädchen, vom Mädchen zur Frau geworden, und es hatte nichts gegeben, was sie zu etwas Besonderem gemacht hätte, nichts, was hätte erkennen lassen, dass sie einzigartig war oder über unerwartete Begabungen verfügte. Sie hatte einen Monat nach ihrer ersten Blutung geheiratet. Sie hatte drei Kinder geboren. Sie hatte ihren Ehemann beinahe geliebt und gelernt, damit zu leben, dass er ein wenig enttäuscht von ihr war, als ihre jugendliche Schönheit der beschwerlichen Mutterschaft Platz gemacht hatte. Sie hatte ein Leben gelebt, das sich nicht von dem ihrer Mutter unterschied und hatte daher – auch ohne besondere Begabung – den vor ihr liegenden Lebensweg klar erkannt: dass ihr Körper Jahr um Jahr verfallen und sie ihre Geschmeidigkeit verlieren würde, während sich die Falten in ihrem Gesicht vertieften, ihre Brüste schlaffer wurden, ihre elende Blasenschwäche schlimmer wurde. Und eines Tages würde sie feststellen, dass sie nicht mehr gehen konnte, und der Stamm würde sie zurücklassen. Um in Einsamkeit zu sterben, weil sterben etwas war, das in der Einsamkeit geschah, wie es schon immer gewesen war und immer sein würde. Denn die Elan waren nicht so dumm wie die sesshaften Völker von Kolanse mit ihren Grüften und Schatzkammern für die Toten, wo den Sklaven und Ratgebern der Familie die Kehlen durchgeschnitten wurden, damit man sie in den Korridor vor der Grabkammer stopfen konnte, als Diener, die über das Leben hinaus dienten, Diener auf ewig.
Am Ende starb jeder für sich allein. Eine wirklich schlichte Wahrheit. Eine Wahrheit, die niemand zu fürchten brauchte. Die Geister warteten, bevor sie ein Urteil über eine Seele fällten, warteten darauf, dass diese Seele – sterbend und allein und abgeschieden – über sich selbst urteilte, über das Leben, das sie gelebt hatte, und wenn Friede über sie kam, dann würden die Geister Erbarmen zeigen. Und wenn Qual die Wilde Stute ritt, tja, dann wussten die Geister sich anzupassen. Wenn die Seele sich selbst gegenübertrat, war es unmöglich zu lügen. Täuschende Ausreden klangen falsch, ihre banale Schwäche war zu offensichtlich, um sie übersehen zu können.
Es war ein Leben gewesen. Alles andere als vollkommen, aber nur ein bisschen unglücklich. Ein Leben, das man auf so etwas wie Zufriedenheit zusammenstutzen konnte, auch wenn sich das Ergebnis als formlos, als bedeutungslos erweisen sollte.
Sie war keine Hexe gewesen. Sie hatte nicht den Atem einer Schamanin besessen und würde daher das Gefleckte Pferd niemals reiten. Und als an einem Morgen voller Entsetzen und Gewalt das Ende jenes Lebens für sie und ihr Volk gekommen war, hatte sie nichts als verdammende Selbstsucht an den Tag gelegt – indem sie sich geweigert hatte zu sterben, indem sie von all dem weggelaufen war, was sie gekannt hatte.
Das waren keine Tugenden.
Sie besaß keine Tugenden.
Als sie die zentrale Wendeltreppe erreichte – deren Stufen zu flach, zu breit für menschliche Schritte waren – , stieg sie nach oben; ihr Atem ging aufgrund der Anstrengung flacher und schneller, während sie Stockwerk um Stockwerk höher stieg, hinauf und hinaus aus Wurzel und in die unteren Räume von Futter, wo sie die Rampe mit den Gegengewichten benutzte, die sie an einer senkrechten Achse entlang über die brodelnden Fässer mit Pilzen und die aufgestapelten Gehege voller Orthen und Grishol hob und anschließend auf der Grundsohle von Schoß knirschend und zitternd zum Halt kam. Hier schlug das kakofonische Gebrüll der Jungen über ihr zusammen, die zischenden Schmerzensschreie derer, an denen grässliche Operationen durchgeführt wurden – denen bitter schmeckende Schicksale verordnet wurden – , und nachdem sie wieder einigermaßen zu Atem gekommen war, beeilte sie sich, an den Stockwerken der schrecklichen Gräueltaten vorbeizusteigen und damit auch dem Gestank nach Abfällen und Panik zu entkommen, der wie Öl auf der weichen Haut von Gestalten schimmerte, die sich zu allen Seiten wanden – Gestalten, die sie bewusst vermied anzusehen, während sie sich die Ohren zuhielt und weiterhastete.
Vom Schoß zum Herz, wo sie jetzt an hoch aufragenden Gestalten vorbeiging, die ihr keinerlei Beachtung schenkten und denen sie ausweichen musste, wenn sie nicht einfach von klauenbewehrten Füßen zertrampelt werden wollte. Ve’Gath-Soldaten flankierten die zentrale Rampe; sie waren doppelt so groß wie sie und erinnerten in ihren arkanen Rüstungen an die gewaltige Maschinerie von Wurzel tief unter ihnen. Reich verzierte vergitterte Visiere verbargen ihre Gesichter – abgesehen von den Schnauzen mit den Fängen –, und der Schwung ihrer Kieferlinie verlieh ihnen ein grässliches Grinsen, als würde ihnen das, wozu sie gezüchtet worden waren, Freude bereiten. Mehr noch als die J’an oder die K’ell erschreckten die wahren Soldaten der K’Chain Che’Malle Kalyth bis ins Mark. Die Matrone produzierte sie in riesiger Zahl.
Ein weiterer Beweis war nicht erforderlich – ein Krieg stand bevor.
Dass die Ve’Gath der Matrone schreckliche Schmerzen bereiteten, da jeder von ihnen in einer Woge aus Blut und ätzender Flüssigkeit ausgestoßen wurde, war bedeutungslos geworden. Notwendigkeit war der grausamste aller Herren, wie Kalyth sehr wohl wusste.
Keiner der Soldaten, die die Rampe bewachten, hielt sie auf, als sie weiterging. Der ebene Stein unter ihren Füßen war mit Löchern übersät, an denen sich Klauen festhalten konnten und aus denen kalte Luft nach oben und um sie herum wehte; die deutlich niedrigere Umgebungstemperatur auf der Rampe sollte offensichtlich dazu dienen, irgendwie die instinktive Furcht zu unterdrücken, die die K’Chain befiel, wenn das Beförderungsmittel sich unter Quietschen und Ächzen über die Ebene von Herz hinaushob und auf der Höhe von Augen endete, der inneren Festung, dem Acyl-Nest und Heim der Matrone. Da sie sich allein auf der Rampe befand, wurde der Mechanismus nicht allzu sehr belastet, und sie hörte wenig mehr als das Rauschen der Luft, das ihr jedes Mal ein Gefühl der Desorientierung und des Fallens vermittelte, obwohl sie doch nach oben raste, und der Schweiß auf ihren Gliedern und ihrer Stirn kühlte schnell ab. Als die Rampe langsamer wurde und schließlich auf der Grundsohle von Augen zum Halten kam, zitterte sie.
J’an-Wächter beobachteten ihre Ankunft vom Fuß der halben Wendeltreppe aus, die zum Nest führte. Genau wie die Ve’Gath schienen sie ihr keine sonderliche Beachtung zu schenken – zweifellos war ihnen bewusst, dass sie herbeibefohlen worden war, doch selbst wenn dem nicht so gewesen wäre, würden sie in ihr keine wie auch immer geartete Bedrohung für die Matrone sehen, zu deren Schutz sie gezüchtet worden waren. Kalyth war nicht einfach nur harmlos, sie war nutzlos.
Die heiße, ranzige Luft umhüllte sie, widerlich wie ein feuchter Umhang, als sie sich auf den Weg zu den Stufen machte und ihren ungeschickten Aufstieg zur Domäne der Matrone begann.
Auf dem oberen Absatz stand ein letzter Wächter. Bre’nigan war mindestens tausend Jahre alt, hager und groß – sogar größer als ein Ve’Gath – , und seine vielschichtigen Schuppen wiesen eine silberne Patina auf, die ihn geisterhaft aussehen ließ, als wäre er aus sonnengebleichtem Glimmer gehauen. In seinen geschlitzten Augen war weder eine Pupille noch eine Iris zu sehen; sie waren einfach nur schmutzig gelb und verunziert durch Trübungen. Kalyth vermutete, dass der Leibwächter blind war, aber in Wahrheit war das unmöglich zu sagen, denn wenn Bre’nigan sich bewegte, tat er dies mit vollkommener Sicherheit und ja, tatsächlich, voller Anmut und geschmeidiger Eleganz. Das lange, leicht gekrümmte Schwert, das durch einen halb in seine Haut eingelassenen Bronzering an seiner Hüfte geschoben war, war so groß wie Kalyth; die Klinge bestand aus einer Art Keramik, von der ein ganz schwacher magentafarbener Schimmer ausging, wobei die makellose Schneide silbern glänzte.
Sie grüßte Bre’nigan mit einem Nicken, das keinerlei Reaktion hervorrief, und ging an dem Wächter vorbei.
Kalyth hatte gehofft – nein, sie hatte gebetet – , doch als sie die beiden K’Chain sah, die vor der Matrone standen, und als sie außerdem sah, dass niemand bei ihnen war, sank ihre Stimmung. Verzweiflung wallte in ihr auf, drohte sie zu verschlingen. Die Brust wurde ihr eng – so eng, dass sie kaum noch Luft bekam.
Hinter den Neuankömmlingen thronte Gunth’an Acyl, die Matrone, riesig auf dem erhöhten Podest. Wogen quälenden Schmerzes gingen von ihr aus. Was das anging, war sie unverändert und unveränderlich, doch Kalyth spürte bei der gewaltigen Königin dieses Mal noch etwas anderes, eine bittere Unterströmung von … irgendetwas.
Verstört wie sie war, bemerkte sie erst jetzt den Zustand, in dem sich die beiden K’Chain Che’Malle befanden, die tiefen, halb verheilten Wunden, die chaotischen Narben an Flanken, Hals und Hüften. Die beiden sahen halb verhungert aus, als wären sie zu entsetzlichen, extremen Entbehrungen und Gewalttaten getrieben worden, und es versetzte ihr einen Stich im Herzen.
Doch dieses Mitgefühl hielt nicht lange. Was blieb, war die Wahrheit: der K’ell-Jäger Sag’Churok und die Eine Tochter Gunth Mach hatten versagt.
Die Matrone sprach in Kalyths Gedanken, auch wenn es keine wie auch immer geartete Sprache war, sondern einfach nur ein unabänderliches Aufzwingen von Wissen und Bedeutung. »Destriant Kalyth, ein Irrtum bei der Entscheidung. Wir bleiben gebrochen, ich bleibe gebrochen. Du kannst es nicht heilen, nicht allein, du kannst es nicht heilen.«
Weder das Wissen noch die Bedeutung erwiesen sich als Geschenk. Zwischen den Worten konnte Kalyth Gunth’an Acyls Wahnsinn spüren. Die Matrone war unbestreitbar wahnsinnig. Genau wie die Aktionen, zu denen sie ihre Kinder und Kalyth gezwungen hatte. Sie zu beeinflussen war unmöglich.
Gunth’an Acyl erfasste wahrscheinlich Kalyths Überzeugung – dass die Matrone wahnsinnig war –, aber auch das spielte keine Rolle. In der uralten Königin war nichts außer Schmerz und der Qual verzweifelter Not.
»Destriant Kalyth, sie werden es noch einmal versuchen. Was gebrochen ist, muss geheilt werden.«
Kalyth glaubte nicht, dass Sag’Churok und die Eine Tochter eine weitere Queste überleben würden. Und auch das war eine Wahrheit, die keinerlei Auswirkungen auf den Befehl hatte, den Acyl für notwendig hielt.
»Destriant Kalyth, du wirst diese Suche begleiten. K’Chain Che’Malle sind blind gegenüber der Erkenntnis.«
Und so hatten sie schließlich den Punkt erreicht, von dem sie trotz ihrer Hoffnungen, ihrer Gebete immer gewusst hatte, dass er unausweichlich kommen würde. »Ich kann nicht«, flüsterte sie.
»Du wirst es tun. Die Wächter sind erwählt. K’ell Sag’Churok, Rythok, Kor Thuran. Shi’gal Gu’Rull. Eine Tochter Gunth Mach.«
»Ich kann nicht«, wiederholte Kalyth. »Ich habe keine … Begabungen. Ich bin kein Destriant – ich bin blind für das, was ein Destriant braucht, was auch immer es sein mag. Ich kann kein Todbringendes Schwert finden, Matrone. Und auch keinen Schild-Amboss. Es tut mir leid.«
Das gewaltige Reptil verlagerte sein massives Gewicht; es hörte sich an, als würden sich Felsblöcke in Kies senken. Funkelnde Augen richteten sich auf Kalyth, unausweichlich, unerbittlich.
»Ich habe dich erwählt, Destriant Kalyth. Meine Kinder sind diejenigen, die blind sind. Es ist ihr Versagen und meines. Wir haben in jedem Krieg versagt. Ich bin die letzte Matrone. Der Feind sucht mich. Der Feind wird mich vernichten. Deine Art gedeiht auf dieser Welt – das können selbst meine Kinder erkennen. Unter euch werde ich neue Meisterkämpfer finden. Mein Destriant muss sie finden. Mein Destriant bricht im Morgengrauen auf.«
Kalyth sagte nichts mehr, denn sie wusste, dass jede Antwort sinnlos war. Einen Moment später verbeugte sie sich und verließ kraftlos – benommen, als wäre sie betrunken – das Nest.
Ein Shi’gal würde sie begleiten. Was das bedeutete, war nicht zu leugnen. Dieses Mal würde es kein Versagen geben. Zu versagen bedeutete, den Unmut der Matrone zu spüren zu bekommen. Ihr Urteil zu empfangen. Drei K’ell-Jäger und die Eine Tochter und Kalyth. Wenn sie versagten … würden sie den tödlichen Zorn eines Shi’gal-Assassinen nicht lange überleben.
Sie wusste, dass im Morgengrauen ihre letzte Reise beginnen würde.
Hinaus in die Ödlande, um Meisterkämpfer zu finden, die nicht einmal existierten.
Und ihr wurde plötzlich klar, dass dies die Strafe war, die ihrer Seele auferlegt worden war. Sie musste leiden, weil sie feige gewesen war. Ich hätte mit den anderen sterben sollen. Mit meinem Mann. Meinen Kindern. Ich hätte nicht weglaufen dürfen. Jetzt muss ich für meine Selbstsüchtigkeit bezahlen.
Die einzige Gnade war, dass das letzte Urteil schnell vollstreckt werden würde. Sie würde den Todesstoß des Shi’gal nicht einmal spüren, geschweige denn kommen sehen.
Eine Matrone produzierte niemals mehr als drei Assassinen zur gleichen Zeit, und da sie ihre jeweiligen Aromen absolut nicht ausstehen konnten, war jedes wie auch immer geartete Bündnis unmöglich. Sollte einer von ihnen zu der Entscheidung kommen, dass die Matrone ausgelöscht werden musste, würden sich ihm die beiden anderen von Natur aus entgegenstellen. So schützte jeder Shi’gal die Matrone vor den beiden anderen. Einen mit auf die Suche zu schicken war ein großes Risiko, denn dann wären nur noch zwei Assassinen da, um sie jederzeit zu verteidigen.
Ein weiterer Beweis für den Wahnsinn der Matrone. Sich selbst diesem Risiko auszusetzen und zur gleichen Zeit ihre Eine Tochter wegzuschicken – ihr einziges Kind, das über Potenzial zur Fortpflanzung verfügte – , widersprach jeglicher Vernunft.
Andererseits war Kalyth selbst kurz davor, in den Tod zu marschieren. Warum machte sie sich also Gedanken um diese furchterregenden Kreaturen? Sollte der Krieg doch kommen. Sollte der geheimnisvolle Feind doch Ampelas Verwurzelt und all die anderen Verwurzelten überfallen und sämtliche K’Chain Che’Malle bis zum letzten Individuum niederhauen. Die Welt würde sie nicht vermissen.
Außerdem kannte sie sich mit Auslöschung aus. Der einzige echte Fluch besteht darin festzustellen, dass du der oder die Letzte deiner Art bist. Ja, sie verstand ein solches Schicksal gut, und sie kannte die wahren Tiefen der Einsamkeit – nein, damit meinte sie nicht das armselige, geistlose, selbstmitleidige Spiel, das die Menschen überall spielten, sondern die grausame Erkenntnis, dass es ein Alleinsein gab, für das es kein Heilmittel und keine Hoffnung auf Erlösung gab.
Ja, jeder stirbt für sich allein. Möglicherweise voller Bedauern. Voller Sorgen. Aber das ist nichts verglichen mit dem, was dem oder der Letzten einer Art widerfährt. Denn in so einer Situation kann niemand der Wahrheit ausweichen, dass ein Versagen vorliegt. Ein absolutes, schreckliches Versagen. Das Versagen der eigenen Art, das von allen Seiten heranrauscht und diese letzten Schultern findet, auf denen es sich mit einem Gewicht niederlässt, das keine einzelne Seele ertragen kann.
Mit der Sprache der K’Chain Che’Malle war eine Art Gabe auf sie gekommen, und sie quälte Kalyth jetzt. Ihr Geist war erwacht, weit über das hinaus, was sie in dem Leben, das sie zuvor geführt hatte, gewusst hatte. Wissen war kein Segen, Bewusstsein ein Leiden, das den gesamten Geist befleckte. Sie könnte sich die Augen aus dem Kopf drücken und würde doch immer noch zu viel sehen.
Fühlten die Schamanen ihres Stammes sich auch so schrecklich schuldig, wenn in ihnen die Erkenntnis heranreifte, dass alles zu Ende war? Sie erinnerte sich wieder an ihre trostlosen Blicke und verstand sie nun auf eine Weise, die sie früher, in dem Leben, das sie einst gelebt hatte, nicht begriffen hatte. Nein, sie konnte nichts anderes tun als die tödlichen Segnungen dieser K’Chain Che’Malle zu verfluchen. Sie von ganzem Herzen, mit all ihrem Hass zu verfluchen.
Kalyth machte sich an den Abstieg. Sie brauchte die Enge von Wurzel, sie brauchte die altersschwache Maschinerie zu allen Seiten, das Tropfen von zähflüssigem Öl und die üble, abgestandene Luft. Die Welt war zerbrochen. Sie war die letzte Elan, und ihre letzte auf dieser Erde verbliebene Aufgabe bestand darin, die Vernichtung der letzten Matrone der K’Chain Che’Malle zu beaufsichtigen. Verschaffte ihr das Befriedigung? Falls ja, war es eine böse Art von Befriedigung – und schmeckte daher nur umso verführerischer.
Für ihr Volk war der Tod vor dem Angesicht der sinkenden Sonne angeflogen gekommen, ein schwarzes, zerfleddertes Omen tief am Himmel. Sie würde diese grässliche Vision sein, dieser Splitter des ermordeten Mondes. Der letztlich – wie alle Dinge – zur Erde getrieben wurde.
Dies ist alles wahr.
Seht meinen trostlosen Blick.
Shi’gal Gu’Rull stand am äußersten Rand der Stirn, die Nachtwinde heulten um seine große, schlanke Gestalt. Als ältester Shi’gal hatte der Assassine, der Acyl schon so lange diente, gegen sieben andere Shi’gal gekämpft und sie besiegt. Einundsechzig Jahrhunderte lang lebte und wuchs er bereits und war nun doppelt so groß wie ein ausgewachsener K’ell-Jäger, denn im Gegensatz zu den Jägern – die nach zehn Jahrhunderten mit dem Aroma unvermittelter Sterblichkeit versehen wurden – besaßen die Shi’gal keinen solchen Geburtsfehler. Sie konnten theoretisch sogar länger als die Matrone leben.
Auf Schläue gezüchtet, machte Gu’Rull sich über die geistige Gesundheit von Mutter Acyl keine Illusionen. Die peinliche Übernahme gottesfürchtiger Glaubensstrukturen passte schlecht zu ihr und den K’Chain Che’Malle. Die Matrone suchte menschliche Gläubige, menschliche Diener, aber Menschen waren zu zerbrechlich, zu schwach, um wirklich nützlich zu sein. Diese Frau – Kalyth – war dafür Beweis genug, trotz des Aromas der Wahrnehmung, das Acyl ihr gegeben hatte – einer Wahrnehmung, die Sicherheit und Stärke hätte vermitteln sollen, aber von ihrem schwachen Verstand zu einem weiteren Werkzeug der Selbstbeschuldigung und des Selbstmitleids verunstaltet worden war.
Das Aroma würde im Laufe der Suche verblassen, da Kalyths rasch fließendes Blut Acyls Gabe immer mehr verdünnte und keine tägliche Wiederauffüllung mehr möglich war. Destriant Kalyth würde auf ihre angeborene Intelligenz zurückfallen, und die war nach jeglichem Standard dürftig. Nach Gu’Rulls Ansicht war sie bereits jetzt nutzlos. Und während dieser sinnlosen Queste würde sie zu einer Last, zu einer Bürde werden.
Es wäre besser, sie so bald wie möglich zu töten, aber solche Flexibilität ließ Mutter Acyls Befehl leider nicht zu. Destriant Kalyth musste ein Todbringendes Schwert und einen Schild-Amboss aus ihrer eigenen Art erwählen.
Sag’Churok hatte vom Versagen desjenigen berichtet, den sie als Erstes ausgewählt hatten. Von der Masse an Fehlern, die ihr Auserwählter gewesen war: Rotmaske von den Ahl. Gu’Rull glaubte nicht, dass Destriant Kalyth es irgendwie besser machen würde. Es mochte sein, dass die Menschen in der Welt da draußen gediehen, aber nur, weil sie es genauso machten, wie die wilden Orthen es tun würden – nämlich weil sie sich in verschwenderischer Zahl fortpflanzten. Über weitere Begabungen verfügten sie nicht.
Der Shi’gal hob die kurze Schnauze und öffnete die Nasenschlitze, um die Nachtluft zu riechen. Der Wind kam von Osten, und wie üblich stank er nach Tod.
Gu’Rull hatte die armseligen Erinnerungen von Destriant Kalyth geplündert und wusste daher, dass im Osten, auf der Ebene, die als die Elan bekannt war, keine Erlösung zu finden war. Sag’Churok und Gunth Mach hatten sich nach Westen begeben, in die Ahldan, und waren dort ebenfalls gescheitert. Der Norden war eine abschreckende, leblose Sphäre aus Eis, gepeinigten Meeren und bitterer Kälte.
Also mussten sie nach Süden reisen.
Der Shi’gal hatte Ampelas Verwurzelt seit acht Jahrhunderten nicht mehr verlassen, sich nicht mehr nach draußen gewagt. Es war unwahrscheinlich, dass sich in dieser kurzen Zeit in der Region, die die Menschen als die Ödlande kannten, viel geändert hatte. Nichtsdestotrotz war es taktisch vernünftig, die Gegend im Voraus ein bisschen auszukundschaften.
Mit diesem Gedanken entfaltete Gu’Rull seine monatealten Schwingen, spreizte die verlängerten Federschuppen, sodass sie sich glätten und unter dem Winddruck füllen konnten.
Und dann ließ sich der Assassine über die steile Kante der Stirn fallen. Die Schwingen breiteten sich aus, so weit sie konnten, und gleichzeitig stieg das Lied vom Fliegen auf, ein leises klagendes Pfeifen, das für den Shi’gal die Musik der Freiheit war.
Gu’Rull verließ Ampelas Verwurzelt … es war viel zu lange her, seit er so ein … so ein Hochgefühl verspürt hatte.
Die beiden neuen Augen unter der Kieferlinie des Assassinen öffneten sich zum ersten Mal, und kurzfristig verwirrten ihn die vermischten Bilder des Himmels über ihm und des Bodens unter ihm, aber nach einiger Zeit war er in der Lage, beide Ausblicke voneinander zu trennen, sodass sie die passende Beziehung zueinander erhielten und ein gewaltiges Panorama der ihn umgebenden Welt erschufen.
Acyls neue Aromen waren ehrgeizig und in der Tat brillant. Gehörte eine solche Kreativität zum Wahnsinn dazu? Vielleicht.
Erzeugte diese Möglichkeit Hoffnung in Gu’Rull? Nein. Hoffnung war nicht möglich.
Der Assassine segelte durch die Nacht, hoch über einer öden, praktisch leblosen Landschaft. Wie ein Splitter des ermordeten Mondes.
Die Ödlande
Er war nicht allein. Tatsächlich konnte er sich nicht erinnern, jemals allein gewesen zu sein. Im Grunde war die Vorstellung unmöglich, das zumindest begriff er. Soweit er sagen konnte, war er körperlos und besaß das bizarre Privileg, beinahe willentlich von einem Gefährten zum anderen wechseln zu können. Wenn sie sterben sollten oder irgendwie eine Möglichkeit fanden, ihn abzuweisen, tja, dann – so glaubte er – würde er aufhören zu existieren. Und dabei wollte er so sehr am Leben bleiben, wollte weiter im euphorischen Wunder seiner Freunde, seiner bizarren, uneinigen Familie dahintreiben.
Sie durchquerten eine zerklüftete, verlassene Wildnis, eine Landschaft aus zerbrochenen Felsen, vom Wind geriffelten Fächern aus grauem Sand und Geröllhalden aus vulkanischem Glas, die mit ebenso zufälliger Gleichgültigkeit begannen, wie sie endeten. Hügel und Grate krachten in launischer Verwirrung gegeneinander, und kein einziger Baum unterbrach den welligen Horizont. Die Sonne oben am Himmel war ein verschwommenes Auge, das einen Pfad durch dünne Wolken schmierte. Die Luft war heiß, und der Wind wehte unablässig.
Alles, was die Gruppe bislang zu essen gefunden hatte, waren merkwürdige Schwärme schuppiger Nagetiere, deren zähes Fleisch nach Staub schmeckte, und übergroße Rhizan, unter deren Flügeln sich mit milchigem Wasser gefüllte Taschen befanden. Tag und Nacht wurden sie von Kapmotten verfolgt, die stets geduldig warteten, dass einer von ihnen fiel und nicht wieder aufstand, aber das schien nicht sehr wahrscheinlich. Da er von einer Person zur anderen flitzte, konnte er ihre angeborene Entschlossenheit, ihre unerschöpfliche Kraft spüren.
Leider konnte diese innere Stärke die anscheinend endlose Litanei des Elends nicht verhindern, aus der der größte Teil ihrer Gespräche zu bestehen schien.
»Was für eine Verschwendung«, sagte Sheb und kratzte sich den juckenden Bart. »Schlag ein paar Brunnen und bau aus diesen Steinen Häuser und Läden und was weiß ich sonst noch. Dann hätte man was, das was wert wäre. Leeres Land ist nutzlos. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem alles, wirklich alles auf der Oberfläche dieser Welt nutzbar gemacht wird. Städte, die zu einer verschmelzen …«
»Dann würde es keine Bauernhöfe mehr geben«, hielt Letzt ihm entgegen, aber wie immer war die Entgegnung sanft und zaghaft. »Ohne Bauernhöfe kriegt niemand was zu essen …«
»Sei kein Idiot«, blaffte Sheb ihn an. »Natürlich würde es Bauernhöfe geben. Nur kein nutzloses Land mehr wie dieses hier, wo nichts außer verdammten Ratten lebt. Ratten in der Erde, Ratten in der Luft, und Käfer und Knochen – kannst du dir die ganzen Knochen vorstellen?«
»Aber ich …«
»Sei still, Letzt«, sagte Sheb. »Du hast noch nie irgendwas Brauchbares gesagt. Noch nie.«
Asane meldete sich zu Wort, und wie immer klang ihre Stimme schwach und zittrig. »Bitte keinen Streit. Es ist auch so schon schlimm genug, ohne dass du mit deinen Streitereien anfängst, Sheb …«
»Sei bloß vorsichtig, Hexe – oder du bist die Nächste.«
»Traust du dich auch, es mit mir zu versuchen, Sheb?«, fragte Nappet. Er spuckte aus. »Glaub ich nicht. Du quatschst, Sheb, und das ist alles, was du tust. Irgendwann mal werde ich dir nachts, wenn du schläfst, einfach die Zunge rausschneiden und sie an die verdammten Kapmotten verfüttern. Wer würde sich beklagen? Asane? Hauch? Letzt? Taxilier? Rautos? Niemand würde sich beklagen, Sheb – nein, wir würden alle tanzen.«
»Lass mich da raus«, sagte Rautos. »Ich hab mehr als genug für ein Leben gelitten, als ich noch mit meiner Frau zusammen war, und natürlich vermisse ich sie nicht.«
»Jetzt geht das schon wieder los, Rautos«, zischte Hauch. »Meine Frau hat dies getan, meine Frau hat das gesagt. Ich habe die Nase voll davon. Deine Frau ist nicht hier, oder? Wahrscheinlich hast du sie ertränkt, und deshalb bist du auf der Flucht. Du hast sie in deinem tollen Springbrunnen ertränkt, hast sie einfach nur runtergedrückt und zugeschaut, wie ihre Augen groß wurden, wie sie den Mund aufgerissen und im Wasser geschrien hat. Du hast zugesehen und gelächelt, ja, das hast du getan. Ich vergesse es nicht, ich kann es nicht vergessen, es war schrecklich. Du bist ein Mörder, Rautos.«
»Da haben wir’s wieder«, sagte Sheb. »Sie redet schon wieder vom Ertränken.«
»Ich könnte ihr ja auch die Zunge rausschneiden«, sagte Nappet grinsend. »Und dir auch, Rautos. Schluss mit diesem ganzen Scheiß vom Ertränken und von Ehefrauen und den ganzen Klagen … ihr anderen seid in Ordnung. Letzt, du sagst nichts, und wenn du was sagst, ärgert es niemand. Asane, du weißt meistens, wann’s besser ist, den Mund zu halten. Und Taxilier sagt sowieso kaum jemals was. Nur wir, und das …«
»Ich sehe etwas«, sagte Rautos.
Er spürte, wie ihre Aufmerksamkeit sich auf etwas Neues richtete, und er sah mit ihren Augen einen verwaschenen Fleck am Horizont, etwas, das sich himmelwärts reckte und zu schmal war, um ein Berg zu sein, aber zu groß für einen Baum. Immer noch viele Meilen entfernt, ragte es wie ein Zahn auf.
»Ich will das sehen«, verkündete Taxilier.
»Scheiße«, sagte Nappet. »Wo sollten wir sonst auch hingehen?«
Die anderen stimmten schweigend zu. Sie waren, wie es schien, seit einer Ewigkeit unterwegs, und die Streitereien darüber, wo sie hingehen sollten, waren schon lange erstorben. Niemand von ihnen hatte eine Antwort, niemand von ihnen wusste auch nur, wo sie überhaupt waren.
Und daher machten sie sich in Richtung jenes fernen, geheimnisvollen Bauwerks auf.
Er war zufrieden damit. Zufrieden, mit ihnen zu gehen, und er stellte fest, dass er Taxiliers Neugier teilte, die immer weiter wuchs und sich – sollte es notwendig werden – mit Leichtigkeit gegen Asanes Ängste und die Heerschar der Obsessionen durchsetzen würde, die die anderen bedrängten: Hauchs Fantasien vom Ertränken, Rautos’ elende Ehe, Letzts sinnloses Leben ohne Selbstvertrauen, Shebs Hass und Nappets Freude an Grausamkeiten. Und jetzt verstummten die Gespräche, sodass nichts weiter zu hören war als die Schritte nackter Füße auf dem rauen Boden und das leise Seufzen des unablässigen Windes.
Weit oben verfolgten knapp zwei Dutzend Kapmotten die einsame Gestalt, die durch die Ödlande wanderte. Sie waren von Stimmen angelockt worden und hatten nur diese einsame, hagere Gestalt gefunden. Mit staubgrüner Haut und einem Mund, der von Hauern eingerahmt wurde. Sie war nackt und trug lediglich ein Schwert. Ein einsamer Wanderer, der mit sieben Stimmen sprach, die jeweils einen eigenen Namen hatten. Er war viele und doch nur einer. Sie hatten sich alle verirrt, und das hatte er auch.
Die Kapmotten warteten sehnsüchtig darauf, dass sein Leben endete. Allerdings schon seit Wochen. Seit Monaten. In der Zwischenzeit hungerten sie einfach.
Es gab Muster, über die es nachzudenken galt. Die Elemente blieben allerdings zerstückelt, schwebende Ranken und verwaschene schwarze Schlieren, die wie Flecken durch sein Blickfeld schwammen. Aber zumindest konnte er jetzt sehen, und das war ja schon mal was. Der verfaulte Stoff vor seinen Augen war von Luftströmungen, die er nicht spüren konnte, weggezogen worden.
Der Schlüssel, mit dem alles gelöst werden konnte, war in den Mustern zu finden. Dessen war er sich sicher. Wenn er sie nur zusammenziehen könnte, würde er verstehen, würde alles erfahren, was er erfahren musste. Er würde in der Lage sein, einen Sinn in den Visionen zu erkennen, die ihn zerrissen.
So wie die von der seltsamen zweibeinigen, ganz in eine glänzende schwarze Rüstung gekleideten Echse, deren Schwanz nur noch ein Stummel war. Sie stand auf einer Art steinerner Plattform, während zu beiden Seiten Ströme aus Blut in Rinnen flossen. Ihre unmenschlichen Augen waren starr auf den Ursprung all des Blutes gerichtet – einen Drachen, der mit rostüberzogenen Nägeln, von denen Kondenswasser tropfte, an ein Gerüst aus gewaltigen Holzbalken genagelt war. Leiden wogte aus dieser Kreatur, ein verweigerter Tod, ein Leben, das in eine Ewigkeit aus Schmerz verwandelt worden war. Und die davorstehende Echse strahlte kalte Befriedigung aus.
In einer anderen Vision schienen ihn zwei Wölfe von einem grasbewachsenen felsigen Grat aus zu beobachten. Vorsichtig, voller Unbehagen, als würden sie einen Rivalen abschätzen. Hinter ihnen fiel Regen aus schweren Wolken. Und er stellte fest, dass er sich abwandte, als wäre ihm ihr Blick gleichgültig, und über eine kahle Ebene zu wandern begann. In der Ferne erhoben sich irgendwelche Dolmen, viele Dutzend, die ohne ein erkennbares System angeordnet waren und doch alle identisch zu sein schienen – vielleicht waren es Statuen. Er ging näher heran, betrachtete stirnrunzelnd die Gestalten, die auf so merkwürdige Weise von ausladenden Kutten überragt wurden, die buckligen schmalen Rücken ihm zugewandt, die Schwänze um sich herumgelegt. Der Boden, auf dem sie kauerten, glitzerte, als wäre er mit Diamanten oder zermahlenem Glas bestreut.
Als er dicht an diese schweigenden, reglosen Wächter herankam, den ersten schon fast erreicht hatte, glitt ein großer Schatten über ihn hinweg, und die Luft war plötzlich kalt. Beunruhigt und verzweifelt blieb er stehen und schaute nach oben.
Nichts als Sterne, die alle dahintrieben, als hätten sie sich von ihren Zügeln losgerissen, wie Staubflecken auf einem langsam auslaufenden Teich. Schwache Stimmen drangen herab, berührten seine Stirn wie Schneeflocken, schmolzen binnen eines Augenblicks, verloren alle Bedeutung. Argumente im Abgrund, aber er verstand keines davon. Nach oben zu starren bedeutete sich zu drehen, ohne das Gleichgewicht halten zu können, und er spürte, wie sich seine Füße von der Erde hoben, bis er schwebte. Sich herumdrehend, blickte er nach unten.
Noch mehr Sterne, aber von ihrer Mitte ausgehend ein Dutzend lodernde Sonnen aus grünem Feuer, die das schwarze Gewebe des Raums zerfetzten, sodass Risse entstanden, durch die Licht strömte. Je näher sie kamen, desto wuchtiger wurden sie, machten ihn für alles andere blind, und der Mahlstrom aus Stimmen wurde zu Geschrei, und was sich zuvor wie Schneeflocken angefühlt hatte, die rasch auf seiner erhitzten Stirn geschmolzen waren, brannte jetzt wie Feuer.
Wenn er doch die Fragmente heranziehen, das Mosaik heil machen und so die wahre Bedeutung der Muster erkennen könnte. Wenn er doch …
Wirbel. Ja, das sind Wirbel. Die Bewegung täuscht nicht, die Bewegung enthüllt die Form dahinter.
Wirbel, in Locken aus Fell.
Tätowierungen – sieh sie dir jetzt an – sieh sie an!
Schlagartig ordneten sich die Tätowierungen richtig an – und er wusste wieder, wer er war.
Ich bin Heboric Geisthand. Destriant eines gestürzten Gottes. Ich sehe ihn …
Ich sehe dich, Fener.
Die Gestalt, so wuchtig, so verloren. Unfähig, sich zu bewegen.
Sein Gott war gefangen und genau wie Heboric nur ein stummer Zeuge, während die glühenden Jadesonnen sich schnell näherten. Er und sein Gott waren ihnen im Weg, und dies waren Mächte, die man nicht so leicht beseiteschieben konnte. Es gab keinen Schild, der stark genug war, um aufzuhalten, was da kam.
Dem Abgrund sind wir gleichgültig. Der Abgrund kommt, und er bringt seine eigenen Argumente mit, denen wir nicht standhalten können.
Fener, ich habe dich zum Untergang verdammt. Und du, alter Gott, hast mich zum Untergang verdammt.
Doch ich bedaure das nicht mehr. Denn es ist so, wie es sein sollte. Schließlich kennt der Krieg nur diese eine Sprache. Durch den Krieg fordern wir zu unserer eigenen Vernichtung auf. Durch den Krieg bestrafen wir unsere Kinder mit einem blutigen Erbe.
Er verstand das jetzt. Die Götter des Krieges und was sie bedeuteten, was ihre Existenz an sich besagte. Und als er auf die Jadesonnen starrte, die brennend immer näher kamen, wurde er von der Sinnlosigkeit, die sich hinter all dieser Arroganz, diesem hohlen Dünkel verbarg, schier überwältigt.
Seht nur, wie wir unsere Banner des Hasses schwingen.
Seht nur, wo uns das hinführt.
Ein letzter Krieg hatte begonnen. Und auf der anderen Seite stand ein Feind, gegen den es keine Verteidigung gab. Dieser scharfsichtige Schiedsrichter ließ sich weder durch Worte noch durch Taten täuschen. Er war gegen Lügen gefeit und interessierte sich ebenso wenig für Entschuldigungen wie für geistlose Reden über irgendwelche Notwendigkeiten, das Abwägen zwischen zwei Übeln und die oberflächliche Rechtschaffenheit, das geringere der beiden zu wählen – und ja, das waren die Argumente, die er hörte, und sie waren ebenso leer wie der Äther, durch den sie reisten.
Wir standen erhobenen Hauptes im Paradies. Und haben dann die Götter des Krieges herbeigerufen, um Vernichtung über uns selbst und über unsere Welt zu bringen – über die Erde an sich, ihre Luft, ihr Wasser, ihr vieltausendfaches, vielfältiges Leben. Nein, tut nicht so überrascht, so unschuldig und verblüfft. Ich sehe jetzt mit den Augen des Abgrunds. Ich sehe jetzt mit den Augen meines Feindes, und deshalb werde ich auch mit seiner Stimme sprechen.
Seht, meine Freunde, ich bin die Gerechtigkeit.
Und wenn wir uns schließlich begegnen, wird euch das nicht gefallen.
Und wenn am Ende in euch die Ironie erwacht, seht, wie ich Jadetränen weine, und antwortet mit einem Lächeln.
Wenn ihr den Mut habt.
Habt ihr diesen Mut, meine Freunde?
BUCHEINS
Die See träumt nicht von euch
Ich werde den ewig beschrittenen Pfad beschreiten
Einen Schritt vor dir
Und einen Schritt hinter dir
Ich werde vom Staub husten, den du aufgewirbelt hast
Und dir mehr davon ins Gesicht schleudern
Es schmeckt alles gleich
Auch wenn du so tust, als ob es anders wäre
Aber hier auf diesem ewig beschrittenen Pfad
Wird sich das Alte aufs Neue selbst belügen
Wir können seufzen wie Könige
Wie Imperatrices auf Karren voller Geschenke
Prächtig in eingebildetem Wert
Ich werde den ewig beschrittenen Pfad beschreiten
Auch wenn meine Zeit knapp ist
Als wenn die Sterne
Hierher in meine geöffneten Hände gehören
Diese Freuden vergießend
Die so in der Sonne funkeln
Wenn sie zu Boden sinken
Um diesen ewig beschrittenen Pfad zu bahnen
Hinter dir, hinter mir
Zwischen dem letzten Schritt und dem nächsten
Schau auf, schau einmal auf
Bevor ich dahin bin
GeschichtenerzählerFASTANVONKOLANSE
Kapitel eins
Jämmerliches Elend liegt nicht in dem, was die Decke enthüllt, sondern in dem, was sie verbirgt.
König Tehol der Einzige von Lether
Auf dem überwucherten Gelände in Letheras, auf dem sich der tote Azath-Turm erhob, herrschte Krieg. Eidechsen waren in Schwärmen vom Flussufer her eingewandert. Als sie Unmengen seltsamer Insekten entdeckten, begannen sie wie rasend zu fressen.
Von all den obskuren Insekten war eine Spezies zweiköpfiger Käfer zweifellos die merkwürdigste. Vier Eidechsen beobachteten so eine Kreatur und kesselten sie ein. Das Insekt bemerkte die Bedrohung aus zwei Richtungen und machte eine vorsichtige halbe Drehung, nur um zwei zusätzliche Bedrohungen vorzufinden, woraufhin es sich zusammenkauerte und tot stellte.
Das funktionierte nicht. Eine der Eidechsen – eine von der Sorte, wie sie an Mauern herumflitzen, mit einem breiten Maul und goldfleckigen Augen – machte einen Satz nach vorn und verschlang das Insekt.
Solche Szenen spielten sich überall auf dem Gelände ab, ein entsetzliches Gemetzel, ein Rausch, an dessen Ende die Auslöschung zu stehen pflegte. An diesem Abend schien es das Schicksal nicht gut mit den zweiköpfigen Käfern zu meinen.
Allerdings waren nicht alle Beutetiere so hilflos, wie es ursprünglich aussehen mochte. In der Natur ist die Rolle des Opfers kurzlebig, und das, was gefressen wird, könnte im Laufe der Zeit im ewigen Drama des Überlebenskampfes sehr wohl die Fresser fressen.
Eine einsame Eule, die sich bereits an den Eidechsen satt gefressen hatte, war die Einzige, die Zeugin der plötzlichen Woge sich windenden Sterbens auf der aufgewühlten Erde da unten wurde, als aus den Mäulern sterbender Eidechsen groteske Gestalten hervorkrochen. Es erwies sich, dass die Auslöschung der zweiköpfigen Käfer nicht so unmittelbar drohte, wie es noch kurz zuvor ausgesehen hatte.
Aber Eulen, die zu den am wenigsten klugen Vögeln zählen, schenken solchen Lektionen keine Aufmerksamkeit. Diese hier sah nur zu, mit großen Augen und leerem Verstand. Bis sie ein merkwürdiges Rumoren in ihren Eingeweiden verspürte, das ausreichte, um sie von dem jämmerlichen Sterben unter ihr, den unzähligen fahlen Eidechsenbäuchen, die den dunklen Boden sprenkelten, abzulenken. Sie dachte nicht an die Eidechsen, die sie gefressen hatte. Ihr wurde nicht einmal im Nachhinein bewusst, wie schwerfällig und träge sich einige von ihnen bei dem Versuch, ihren herabstoßenden Krallen zu entgehen, bewegt hatten.
Sie hatte eine lange Nacht qualvollen Hochwürgens vor sich. Dumm, wie sie war, waren von diesem Augenblick an und für alle Zukunft Eidechsen von ihrem Speiseplan gestrichen.
Die Welt erteilt ihre Lektionen auf subtile Weise – oder aber, wenn es denn nötig sein sollte, auch grausam und direkt, sodass selbst die Dümmsten sie verstehen. Wenn nicht, sterben sie. Was die Schlauen angeht, ist es natürlich unentschuldbar, wenn sie sie nicht begreifen.
Eine heiße Nacht in Letheras. Selbst die Steine schwitzten. Die Kanäle sahen zähflüssig und reglos aus, und ihre mit Wirbeln aus Staub und Abfällen gesprenkelte Oberfläche wirkte seltsam abgeflacht und undurchsichtig. Insekten tanzten über das Wasser, als würden sie nach ihrem Spiegelbild suchen, aber diese glatte Patina reflektierte nichts, verschluckte nicht nur die Sterne, sondern verschlang auch den grellen Fackelschein der Straßenpatrouillen, und so wirbelten die geflügelten Insekten ohne Ruhepause umher wie im Fieberwahn.
Unter einer Brücke, auf einer gestuften, in Dunkelheit verborgenen Uferböschung, krabbelten Grillen umher wie Tropfen aus versickerndem Öl – glänzend, aufgedunsen und unglücklich zermalmt unter den Füßen von zwei Gestalten, die aufeinander zugingen und sich in der Düsternis hinkauerten.
»Da wäre er niemals reingegangen«, sagte eine von ihnen im heiseren Flüsterton. »Das Wasser stinkt, und sieh doch, keine Wellen, gar nichts. Er ist rüber auf die andere Seite und jetzt irgendwo auf dem Nachtmarkt, wo er schnell verschwinden kann.«
»Verschwinden«, brummte die andere Gestalt, eine Frau, die jetzt den Dolch hob, den sie in einer behandschuhten Hand hielt, und prüfend die Schneide betrachtete. »Der war gut. Als wenn er verschwinden könnte. Als wenn irgendjemand von uns verschwinden könnte.«
»Du glaubst, dass er sich nicht einmummeln kann – so wie wir?«
»Dafür war keine Zeit. Er ist gerannt. Ist auf der Flucht. In Panik.«
»Ja, es hat ganz nach Panik ausgesehen, was?«, stimmte ihr Begleiter ihr zu. Und dann schüttelte er den Kopf. »Ich habe noch nie etwas so … Enttäuschendes gesehen.«
Die Frau schob ihren Dolch wieder in die Scheide. »Sie werden ihn aufstöbern. Er wird wieder hier rüberkommen, und dann schnappen wir ihn uns.«
»Ganz schön dumm zu glauben, dass er einfach abhauen könnte.«
Kurz darauf zog Lächeln erneut ihren Dolch und sah sich die Schneide genau an.
Gurgelschlitzer neben ihr verdrehte die Augen, sagte aber nichts.
Buddl richtete sich auf und winkte Koryk zu sich. Dann beobachtete er erheitert, wie sich das breitschultrige Seti-Halbblut mithilfe seiner Ellbogen durch die Menge schob und in seinem Kielwasser düstere Blicke und halb verschluckte Flüche hinter sich herzog – das Risiko, dass es Ärger geben würde, war natürlich nicht sonderlich groß, denn das war ganz offensichtlich genau das, worauf der verdammte Fremde aus war, und da Instinkte nun einmal überall auf der Welt ziemlich ähnlich waren, hatte niemand Lust, sich mit Koryk anzulegen.
Zu dumm aber auch; Buddl lächelte in sich hinein. Zu erleben, wie ein Haufen wütender Letherii, die eigentlich nur einkaufen wollten, über den finster dreinblickenden Barbaren herfiel und mit knusprigen Brotlaiben und dicken Wurzelknollen auf ihn einprügelte, wäre wirklich sehenswert gewesen.
Andererseits waren solche Ablenkungen wenig sinnvoll. Zumindest nicht jetzt, da sie ihre Beute gefunden hatten und Starr und Corabb sich zum hinteren Teil der Schenke bewegten, um den Fluchtweg in die Gasse zu versperren, während Vielleicht und Masan Gilani inzwischen auf dem Dach sein sollten – nur für den Fall, dass ihr Opfer besonders einfallsreich sein sollte.
Koryk kam nassgeschwitzt bei ihm an. Er machte ein finsteres Gesicht und knirschte mit den Zähnen. »Erbärmliche Scheißhaufen«, murmelte er. »Was ist das bloß mit dieser Lust am Geldausgeben? Märkte sind dumm.«
»Es macht die Menschen glücklich«, sagte Buddl. »Oder wenn schon nicht richtig glücklich, dann … vorübergehend zufrieden. Was den gleichen Zweck erfüllt.«
»Und der wäre?«
»Es hält sie davon ab, Ärger zu machen. Das bedeutet, Unruhe zu stiften«, fügte er hinzu, als er Koryks Stirnrunzeln und dessen unruhig umherwandernden Blick sah. »Die Art von Ärger, zu der es kommt, wenn eine Bevölkerung genug Zeit hat, um nachzudenken … Ich meine, richtig nachzudenken – wenn sie anfangen zu begreifen, was für eine Scheiße das alles ist.«
»Das klingt wie eine von den Reden des Königs – die bringen mich zum Einschlafen, so wie du jetzt gerade, Buddl. Wo genau ist er denn jetzt?«
»Eine von meinen Ratten hockt am Fuß eines Treppengeländers …«
»Welche?«
»Klein Lächeln – die ist die Beste für so was. Wie auch immer, sie hat ihre Knopfaugen auf ihn gerichtet. Er sitzt an einem Tisch in der Ecke, direkt unter einem Fenster mit geschlossenen Läden … aber das sieht nicht gerade danach aus, als ob da wirklich jemand durchklettern könnte. Im Grunde genommen«, fügte er hinzu, »sitzt er in der Falle.«
Koryks Stirnrunzeln vertiefte sich. »Das ist zu einfach, oder?«
Buddl kratzte sich das stoppelige Kinn, trat von einem Bein aufs andere und seufzte schließlich. »Ja, klar, viel zu einfach.«
»Da kommen Balsam und Gesler.«
Die beiden Sergeanten traten zu ihnen.
»Was machen wir hier?«, fragte Balsam mit großen Augen.
»Kümmert euch nicht um ihn, der hat schon wieder Schiss«, sagte Gesler. »Ich denke, wir müssen uns auf einen Kampf gefasst machen. Einen ziemlich üblen Kampf. Er wird es uns bestimmt nicht leicht machen.«
»Also – wie ist der Plan?«, fragte Koryk.
»Stürmisch geht voran. Er wird ihn aufscheuchen. Wenn er die Hintertür nimmt, werden eure Freunde ihn sich schnappen. Genauso, wenn er nach oben abhaut. Ich gehe davon aus, dass er sich an Stürmisch vorbeidrücken und versuchen wird, durch den Vordereingang zu verschwinden. Das würde ich zumindest tun. Stürmisch ist groß und fies, aber er ist nicht sehr schnell. Und darauf zählen wir. Wir vier werden auf den Scheißkerl warten – wir werden ihn uns schnappen. Während Stürmisch hinter ihm herkommt und die Tür blockiert, sodass er nirgends mehr hinkann.«
»Er sieht nervös aus, wie er so da drin hockt – und außerdem scheint er schlechte Laune zu haben«, sagte Buddl. »Warne Stürmisch – es ist gut möglich, dass er einfach aufsteht und kämpft.«
»Wenn wir irgendwas von ’ner Prügelei hören, gehen wir sofort rein«, sagte Gesler.
Der Sergeant mit der goldgetönten Haut ging davon, um Stürmisch letzte Anweisungen zu geben. Balsam blieb neben Koryk stehen. Er sah verwirrt aus.
Menschen strömten in die Schenke und dann wieder heraus, als wäre sie ein Bordell für schnelle Nummern. Dann tauchte Stürmisch auf, der so ziemlich alle anderen überragte. Sein Gesicht war rot und sein Bart sogar noch röter, als stünde sein ganzer Kopf in Flammen. Während er zum Eingang stapfte, machte er den Lederriemen los, mit dem sein Schwert normalerweise gesichert war. Die Menschen, die ihn sahen, stoben vor ihm zur Seite. Auf der Türschwelle begegnete er einem weiteren Gast, packte den Mann am Hemd und schleuderte ihn hinter sich – der arme Trottel schrie kurz auf, als er mit dem Gesicht voran keine drei Schritte von den Malazanern entfernt auf den Pflastersteinen landete, wo er sich windend sein blutiges Kinn betastete.
Als Stürmisch in der Schenke verschwand, kam Gesler wieder zu ihnen; er trat über den gestürzten Bürger hinweg und zischte: »Los, macht schon – alle Mann zur Tür!«
Buddl ließ Koryk vorgehen und ließ auch Balsam vor, der beinahe in die andere Richtung losmarschiert wäre – wenn Gesler ihn nicht zurückgerissen hätte. Buddl zog es vor, die Drecksarbeit größtenteils den anderen zu überlassen, falls es zu einer Prügelei kommen sollte. Er hatte seinen Teil getan, indem er die Beute gesucht und aufgespürt hatte.
In der Schenke brach schlagartig Chaos aus; Mobiliar zersplitterte, überraschte Rufe und entsetztes Geschrei erhoben sich. Dann machte irgendetwas bumm!, und plötzlich quoll weißer Rauch aus dem Eingang. Noch mehr Mobiliar zersplitterte, ein lautes Getöse, und dann kam eine Gestalt aus dem Rauch gerannt.
Ein Ellbogen krachte hart gegen Koryks Kinn, der umfiel wie ein gefällter Baum.
Gesler duckte sich unter einem Schwinger weg – genau passend, um nähere Bekanntschaft mit einem hochgerissenen Knie zu machen; es klang, als wären zwei Kokosnüsse zusammengeprallt. Während Gesler sich mit glasigen Augen rücklings auf die Pflastersteine setzte, wirbelte ihr Opfer in einer wilden Pirouette herum.
Kreischend wich Balsam zurück und griff nach seinem Kurzschwert. Buddl machte einen Satz nach vorn, um den Arm des Sergeanten festzuhalten – und ihr Zielobjekt schoss an ihnen vorbei, rannte schnell, aber irgendwie unrund in Richtung der Brücke davon.
Stürmisch kam aus der Schenke gestolpert. Er blutete aus der Nase. »Ihr habt ihn nicht erwischt? Ihr verdammten Idioten – schaut euch mein Gesicht an! Das hab ich mir für nichts und wieder nichts eingehandelt!«
Andere Gäste schoben sich hustend und mit tränenden Augen an dem riesigen Falari vorbei nach draußen.