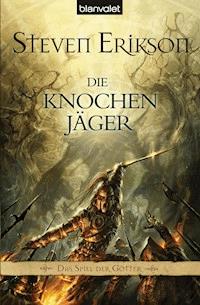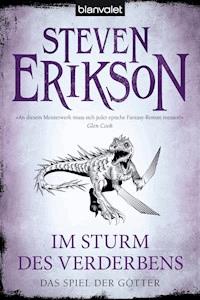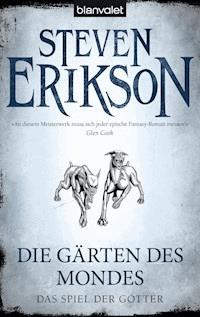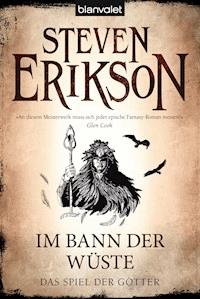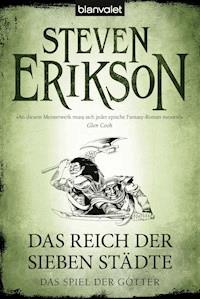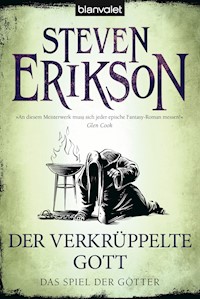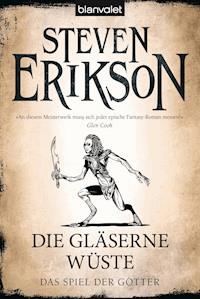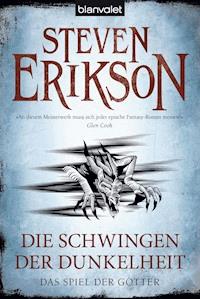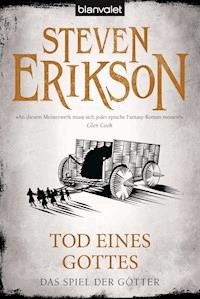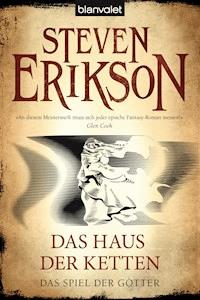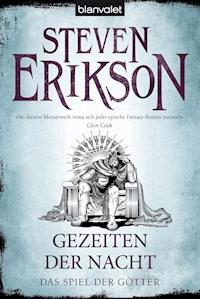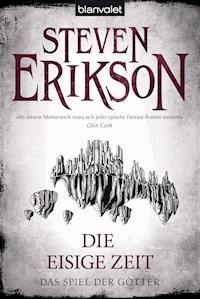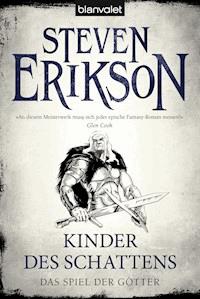9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Spiel der Götter
- Sprache: Deutsch
Das furiose Fantasy-Epos einer dunklen Anderswelt!
Der Aufstand im Reich der Sieben Städte ist vorüber, Sha’ik ist tot. Aber die Rebellion ist nicht gänzlich besiegt, noch immer schwelt die Glut des Widerstands. Sha’iks Feldherr und rechte Hand, der Wüstenkrieger Leoman, hat sich nach Y’Ghatan zurückgezogen, in eine Stadt, deren Namen für die malazanischen Soldaten einen unheilvollen Klang besitzt. Denn vor den Mauern dieser Stadt wurde Dassem Ultor, das egendäre Erste Schwert des Imperiums, getötet. Doch die neue Mandata Tavore hat keine andere Wahl: Sie muss Y’Ghatan erobern, wenn sie die Feuer der Rebellion endgültig austreten will ...
Ein Meisterwerk von unübertroffener mythologischer Tiefe!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 969
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Der Aufstand im Reich der Sieben Städte wurde niedergeschlagen; Dryjna, die Göttin des Wirbelwinds, wurde besiegt, Sha’ik ist tot. Doch das heißt nicht, dass die Rebellion vollkommen vorbei ist. Vor allem, da sich Leoman von den Dreschflegeln, Sha’iks Feldherr und rechte Hand, mit seinen letzten Getreuen nach Y’Ghatan zurückgezogen hat – in eine Stadt, die in der Geschichte des malazanischen Imperiums schon einmal eine verhängnisvolle Rolle gespielt hat. Denn an den Wällen dieser alten Stadt ist das Schwert des Imperiums – Dassem Ultors Eliteeinheit – zerbrochen, und das Erste Schwert selbst wurde dort tödlich verwundet. Keine guten Aussichten für die junge, noch unerfahrene Mandata Tavore und ihre ebenso unerfahrenen, größtenteils aus Rekruten und Soldaten ohne Kampferfahrung bestehenden Truppen. Doch Tavore hat keine andere Wahl – sie muss Y’Ghatan erobern, wenn sie verhindern will, dass die schwelende Glut rebellischer Gedanken wieder zu offenen Flammen wird. Und es ist fast unausweichlich, dass sie dabei Kräften in die Quere kommt, die ihrerseits bestimmte Vorstellungen vom Geschehen im Reich der Sieben Städte haben – Wesen wie dem mächtigen Toblakai-Krieger Karsa Orlong oder den beiden uralten geheimnisvollen Wanderern Icarium und Mappo Trell ...
Autor
Steven Erikson, in Kanada geboren, lebte viele Jahre in der Nähe von London, ehe er vor einiger Zeit in seine Heimat nach Winnipeg zurückkehrte. Der Anthropologe und Archäologe feierte 1999 mit dem ersten Band seines Zyklus »Das Spiel der Götter« nach einer sechsjährigen akribischen Vorbereitungsphase seinen weltweit beachteten Einstieg in die Liga der großen Fantasy-Autoren.
Inhaltsverzeichnis
Bei allem, was wirklich ist In diesem sich herabsenkenden Zeitalter Da Helden nichts hinterlassen Als den ehernen Klang ihrer Namen In den Kehlen von Barden Stehe ich in diesem stummen Herzen Und sehne mich nach dem verklingenden Herzschlag Von Leben, das zu Staub zerfallen ist Während das durchdringende Flüstern Vom Vergehen des Ruhms kündet Und die Lieder In ersterbenden Echos versiegen Bei allem, was wirklich ist Gähnen meinen Schreien Leere Zimmer und Hallen entgegen – Denn irgendjemand muss Antwort geben Antwort geben Auf all das Irgendjemand
Das Sich Herabsenkende Zeitalter TORBORA FETHENA
DAS REICH DER SIEBEN STÄDTE
Das malazanische Imperium etwa im Jahr 1160 von Brands Schlaf
Prolog
Im Jahre 1164 von Brands SchlafIstral’fennidahn, die Jahreszeit D’reks, des Wurms des HerbstesVier Tage nach Sha’iks Hinrichtung in der Raraku
Die Netze zwischen den Türmen waren weit oben als glänzende Schleier zu sehen, und der schwache Wind, der vom Meer herüberwehte, ließ die Fäden erzittern, so dass wie jeden Morgen in der Klaren Jahreszeit ein nebelfeiner Nieselregen auf Kartool herabfiel.
An die meisten Dinge gewöhnte man sich irgendwann, und da die gelbgebänderten Paraltspinnen die Ersten gewesen waren, die die einst berüchtigten Türme im Gefolge der Eroberung der Insel durch die Malazaner in Besitz genommen hatten – und das nun schon Jahrzehnte her war –, war wirklich Zeit genug gewesen, sich an solche Kleinigkeiten zu gewöhnen. Selbst der Anblick der Möwen und Tauben, die jeden Morgen reglos zwischen den knapp zwei Dutzend Türmen schwebten, ehe die faustgroßen Spinnen ihre Schlupfwinkel in den oberen Stockwerken verließen, um ihre Beute zu holen, sorgte bei den Einwohnern der Stadt für kaum mehr als gelinde Abscheu.
Leider war Sergeant Hellian aus der Garde des Septarchenviertels in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Sie vermutete, dass es Götter gab, denen ihr erbärmliches Schicksal – für das besagte Götter zweifellos verantwortlich waren – einen andauernden Lachkrampf bescherte. Für sie selbst hingegen, die sie in der Stadt geboren und mit dem Fluch beladen war, sich vor allen Arten von Spinnen zu fürchten, hatten die ganzen neunzehn Jahre ihres bisherigen Lebens nichts als pausenloses Entsetzen bedeutet.
Und warum gehst du nicht einfach? Diese Frage hatten ihr Kameraden und Bekannte schon so häufig gestellt, dass sie sich gar nicht mehr die Mühe machte, es zu zählen. Aber so einfach war das nicht. Genau betrachtet, war es sogar unmöglich. Das trübe Wasser des Hafens war von abgeworfenen Häuten, Netzteilen und aufgedunsenen, an manchen Stellen noch mit einem Büschel Federn versehenen Kadavern verdreckt, die hier und da auf den Wellen tanzten. Im Landesinnern wurde alles nur noch schlimmer. Die jungen Paraltspinnen flohen vor ihren älteren Artgenossen aus der Stadt zu den Kalksteinfelsen, die Kartool umgaben, um dort mühselig heranzuwachsen. Doch dass sie jung waren, bedeutete keineswegs, dass sie deswegen weniger angriffslustig oder giftig gewesen wären. Zwar erzählten Händler und Bauern, man könnte den ganzen Tag die Pfade und Straßen entlanggehen, ohne auch nur einer einzigen Spinne zu begegnen, doch das war Hellian vollkommen gleichgültig. Sie wusste, dass die Götter warteten. Genauso wie die Spinnen.
Wenn sie nüchtern war, nahm sie die Dinge um sich herum so ordentlich und gewissenhaft wahr, wie es sich für einen Sergeanten der Stadtwache gehörte. Nun war sie zwar nicht pausenlos betrunken, doch wirklich nüchtern zu sein bedeutete, hysterische Anfälle geradezu zu provozieren, und daher war Hellian stets bestrebt, auf dem schwankenden Seil des Noch-nicht-ganz-betrunken-Seins zu balancieren. Folglich hatte sie auch nichts von dem merkwürdigen Schiff mitbekommen, das vor Sonnenaufgang in den Hafen eingelaufen war und nun in den Freien Docks vertäut lag, und dessen Wimpel darauf hinwiesen, dass es von der Insel Malaz gekommen war.
Schiffe aus Malaz waren an und für sich weder besonders ungewöhnlich noch bemerkenswert; allerdings war es mittlerweile Herbst, und die in der Klaren Jahreszeit herrschenden Winde machten es zumindest in den nächsten zwei Monaten praktisch unmöglich, die Schifffahrtsrouten in den Süden zu benutzen.
Wäre nicht alles so verschwommen gewesen, hätte sie vielleicht auch bemerkt – wenn sie sich denn die Zeit genommen hätte, zu den Docks hinunterzugehen, was sie vielleicht hätte schaffen können, wenn man ihr ein Schwert an die Kehle gehalten hätte –, dass das Schiff weder eine gewöhnliche Bark, noch ein Handelsschiff und auch keine Dromone war, sondern ein schlankes, zierliches Ding, in einem Stil gebaut, den kein Schiffsbauer des Imperiums in den letzten fünfzig Jahren verwendet hatte. Geheimnisvolle Schnitzereien zierten den klingengleichen Bug – winzige Gestalten, die Schlangen und Würmer darstellten – und setzten sich am Dollbord über die halbe Länge des Rumpfes fort. Das Heck war quadratisch und merkwürdig hoch, mit einem seitlich befestigten Steuerruder. Die zwölfköpfige Mannschaft war für Seeleute erstaunlich ruhig, und anscheinend hatte keiner von ihnen Interesse, das Schiff zu verlassen, das sanft am Kai schaukelte. Nur eine einzige Gestalt war von Bord gegangen, sobald das Fallreep kurz vor Sonnenaufgang das Ufer berührt hatte.
All diese Dinge erfuhr Hellian erst später. Der Läufer, der sie fand, war ein einheimischer Bengel, der – wenn er nicht gerade irgendwelche Gesetze übertrat – immer bei den Docks herumlungerte, in der Hoffnung, von Besuchern als Führer angeheuert zu werden. Das Stückchen Pergament, das er ihr gab, war, wie sie sofort spürte, von guter Qualität. Darauf stand eine knappe Botschaft, die sie die Stirn runzeln ließ.
»Na gut, mein Junge – beschreibe mir den Mann, der dir das hier gegeben hat.«
»Das kann ich nicht.«
Hellian warf einen Blick zurück auf die vier Wachen, die hinter ihr an der Straßenecke standen. Einer der Männer trat hinter den Jungen, packte ihn mit einer Hand am Rückenteil seiner zerlumpten Tunika und hob ihn hoch. Ein kurzes Schütteln.
»Na, hat das deine Erinnerungen ein bisschen gelockert?«, fragte Hellian. »Ich hoffe es, denn ich werde nichts bezahlen.«
»Ich kann mich nicht erinnern! Ich habe ihm genau ins Gesicht gesehen, Sergeant! Nur ... ich kann mich nicht erinnern, wie es ausgesehen hat!«
Sie musterte den Jungen ein, zwei Herzschläge lang, brummte dann etwas Unverständliches und drehte sich um.
Der Wächter setzte den Jungen wieder ab, ließ ihn aber nicht los.
»Lass ihn gehen, Urb.«
Der Junge machte, dass er wegkam.
Mit einer unbestimmten Handbewegung forderte sie ihre Leute auf, ihr zu folgen, und setzte sich in Bewegung.
Das Septarchenviertel war das friedlichste Viertel der Stadt, was allerdings nichts mit besonderem Eifer von Seiten Hellians zu tun hatte. Hier gab es kaum Gebäude, in denen irgendwelche Geschäfte gemacht wurden; stattdessen dienten die vorhandenen Häuser als Heim für die Akolythen und das Personal der gut ein Dutzend Tempel, die die Hauptstraße des Viertels beherrschten. Diebe, die am Leben bleiben wollten, bestahlen keine Tempel.
Sie führte ihren Trupp auf die breite Straße, wobei ihr einmal mehr auffiel, wie baufällig viele Tempel mittlerweile waren. Die Paraltspinnen liebten die verschnörkelte Architektur und die Kuppeln und die kleineren Türme, und es schien, als würden die Priester den Kampf verlieren. Leere, zerfetzte Chitinpanzer knisterten und knirschten bei jedem Schritt unter ihren Stiefelsohlen.
Früher hätte die erste Nacht von Istral’fennidahn – die gerade vergangen war – im Zeichen eines die ganze Insel umfassenden Fests gestanden, mit Opfern aller Arten für Kartools Schutzgöttin D’rek, den Wurm des Herbstes, und der Halbdrek, der Erzpriester des Großen Tempels, hätte eine Prozession durch die Stadt geführt, auf einem Teppich aus fruchtbarem Abfall, wäre barfuß durch von Maden und Würmern wimmelnde Reste gestapft. Kinder hätten lahme Hunde die Straßen entlanggejagt und diejenigen gesteinigt, die sie in eine Ecke treiben konnten, und dabei hätten sie den Namen ihrer Göttin geschrien. Zum Tode verurteilten Verbrechern hätte man öffentlich die Haut abgezogen und die Knochen gebrochen, und dann wären die unglücklichen Opfer in Gruben geworfen worden, in denen es von aasfressenden Käfern und roten Feuerwürmern wimmelte, die sie binnen vier oder fünf Tagen verzehrt hätten.
All dies war natürlich gewesen, bevor die Malazaner die Insel erobert hatten. Das Hauptziel des Imperators war der Kult von D’rek gewesen. Er hatte begriffen, dass der Große Tempel das Zentrum von Kartools Macht war, und dass die Priester und Priesterinnen D’reks unter der Führung des Halbdrek die Meisterzauberer der Insel gewesen waren. Und so war es kein Zufall, dass in dem nächtlichen Gemetzel, das der Seeschlacht und der anschließenden Invasion vorangegangen war – eine Aktion, die der berüchtigte Tanzer und Hadra, die Meisterin der Klaue geplant und durchgeführt hatten –, die Zauberer des Kults vollständig ausgelöscht worden waren, einschließlich des Halbdrek. Denn der Erzpriester des Großen Tempels hatte seine Position erst vor kurzem durch eine Art Handstreich errungen, und der vertriebene Rivale war niemand anderer als Tayschrenn gewesen, der zum damaligen Zeitpunkt neue Hohemagier des Imperators.
Hellian kannte die Feierlichkeiten nur aus Geschichten, denn sie waren für gesetzeswidrig erklärt worden, sobald die malazanischen Eroberer den imperialen Mantel über die Insel ausgebreitet hatten, doch man hatte ihr oft genug von jenen ruhmreichen Tagen vor langer Zeit erzählt, als Kartool sich auf dem Gipfel der Zivilisation befunden hatte.
Am gegenwärtigen schäbigen Zustand waren die Malazaner schuld, darin waren sich alle einig. Der Herbst war tatsächlich auf der Insel und bei ihren mürrischen Bewohnern angekommen. Schließlich war mehr als nur der Kult von D’rek zerschlagen worden. Die Sklaverei war abgeschafft, die Hinrichtungsgruben waren gesäubert und dauerhaft versiegelt worden. Es gab sogar ein Gebäude, in dem ein paar fehlgeleitete Altruisten lebten, die lahme Hunde bei sich aufnahmen.
Sie gingen am bescheidenen Tempel der Königin der Träume und dem auf der gegenüberliegenden Straßenseite kauernden, höchst verhassten Tempel der Schatten vorbei. Einst waren auf Kartool nur sieben Götter erlaubt gewesen – sechs, die D’rek untergeordnet waren –, daher auch der Name des Viertels. Soliel, Poliel, Beru, Brand, der Vermummte und Fener. Seit der Eroberung waren weitere hinzugekommen: die beiden Vorgenannten, sowie Dessembrae, Togg und Oponn. Und der Große Tempel von D’rek, immer noch das größte Gebäude der Stadt, war auf höchst erbärmliche Weise baufällig.
Der Mann, der vor den breiten, zum Eingang hinaufführenden Stufen stand, trug die Kleidung eines malazanischen Seemanns – verblichenes, wasserdichtes Leder und ein abgetragenes Hemd aus dünnem, ausgefranstem Leinen. Seine langen, schwarzen Haare waren zu einem schlichten, schmucklosen Zopf geflochten, der ihm bis auf den Rücken hing. Als er sich umdrehte – vielleicht, weil er bemerkt hatte, dass jemand kam –, blickte Sergeant Hellian in das Gesicht eines Mannes mittleren Alters mit gleichmäßigen, freundlichen Zügen; nur seine Augen waren irgendwie merkwürdig, hatten etwas Fiebriges.
Hellian holte tief Luft, um ihre alkoholgetränkten Gedanken zu klären, und streckte ihm dann das Pergament entgegen. »Das hier kommt von Euch, nehme ich an?«
Der Mann nickte. »Ihr seid die Kommandantin der Garde in diesem Viertel?«
Sie lächelte. »Ich bin Sergeant Hellian. Der Hauptmann ist letztes Jahr an einem abgefaulten Fuß gestorben. Wir warten immer noch auf Ersatz.«
Seine Brauen hoben sich, was ihm einen sehr ironischen Gesichtsausdruck verlieh. »Keine Beförderung, Sergeant? Also nimmt man anscheinend an, dass ein Hauptmann vor allem nüchtern zu sein hat.«
»In Eurer Nachricht steht, dass es Ärger beim Großen Tempel gibt«, sagte Hellian, ohne auf die unverschämten Worte des Mannes einzugehen. Sie drehte sich um und musterte das riesige Gebäude. Die Doppeltüren waren geschlossen, wie sie stirnrunzelnd feststellte. Das war – ausgerechnet an diesem Tag – noch nie vorgekommen.
»Ich nehme es an, Sergeant«, sagte der Mann.
»Seid Ihr gekommen, um D’rek Euren Respekt zu bezeugen?«, fragte Hellian, während trotz des Alkoholschleiers ein leichtes Unbehagen in ihr aufstieg. »Sind die Türen verschlossen? Wie heißt Ihr, und wo kommt Ihr her?«
»Ich heiße Banaschar, und ich komme von der Insel Malaz. Wir sind heute Morgen hier angekommen.«
Ein Grunzen von einer der Wachen hinter ihr erklang, und Hellian dachte nach. Dann betrachtete sie Banaschar genauer. »Mit dem Schiff? Um diese Jahreszeit?«
»Wir sind so schnell wie möglich gekommen. Sergeant, ich fürchte, wir müssen die Türen des Großen Tempels aufbrechen.«
»Warum nicht einfach klopfen?«
»Das habe ich versucht«, erwiderte Banaschar. »Aber es kommt niemand.«
Hellian zögerte. Die Türen des Großen Tempels aufbrechen? Dafür wird die Faust meine Titten in einer Bratpfanne rösten.
»Da liegen tote Spinnen auf den Stufen«, sagte Urb plötzlich.
Sie drehten sich um.
»Beim Segen des Vermummten«, murmelte Hellian, »und zwar jede Menge.« Sie war jetzt neugierig geworden und trat näher. Banaschar folgte ihr, und nach einem kurzen Augenblick tat ihr Trupp es ihm gleich.
»Sie sehen ...« Sie schüttelte den Kopf.
»... zerfallen aus«, sagte Banaschar. »Als ob sie verwesen. Sergeant, die Tür, bitte.«
Sie zögerte immer noch. Ihr kam ein Gedanke, und sie starrte den Mann düster an. »Ihr habt gesagt, Ihr seid so schnell wie möglich hierhergekommen. Warum? Seid Ihr ein Akolyth von D’rek? – Nein, so seht Ihr nicht aus. Was hat Euch hergeführt, Banaschar?«
»Eine Vorahnung, Sergeant. Ich war ... vor vielen Jahren ... D’rek-Priester. Im Jakatakan-Tempel auf der Insel Malaz.«
»Eine Vorahnung ... und dann macht Ihr Euch gleich auf den Weg nach Kartool? Haltet Ihr mich für eine Närrin?«
In den Augen des Mannes blitzte es wütend auf. »Ganz offensichtlich seid Ihr zu betrunken, um zu riechen, was ich riechen kann.« Er warf einen Blick auf die Wachen. »Habt ihr die gleiche Schwäche wie euer Sergeant, bin ich hier auf mich allein gestellt?«
Urb runzelte die Stirn. »Sergeant, ich glaube, wir sollten diese Türen eintreten«, sagte er dann.
»Dann macht es, verdammt!«
Sie schaute zu, wie ihre Wachen auf die Tür einschlugen. Der Lärm sorgte dafür, dass sich rasch eine Menge Schaulustiger bildete, und Hellian sah eine große Frau sich in die erste Reihe durchschlängeln, deren Gewänder sie als Priesterin eines anderen Tempels auswiesen. Oh – und was nun?
Aber die Frau wandte den Blick nicht von Banaschar ab, der sie seinerseits bemerkt hatte und genauso unverwandt zurückstarrte. Seine Gesichtszüge verhärteten sich.
»Was macht Ihr denn hier?«, wollte die Frau wissen.
»Habt Ihr denn nichts gespürt, Hohepriesterin? Selbstgefälligkeit ist eine Krankheit, die sich schnell ausbreitet, wie es scheint.«
Der Blick der Frau wanderte zu den Wachen, die sich mit der Tür abmühten. »Was ist geschehen?«
Der rechte Türflügel zersplitterte und fiel nach einem weiteren Tritt nach innen.
Hellian bedeutete Urb mit einer Geste, er solle hineingehen, und folgte ihm. Banaschar war dicht hinter ihr.
Der Gestank war überwältigend; trotz des Zwielichts waren die großen Blutflecken an den Wänden nicht zu übersehen, ebenso wenig wie die Fleischstücke, die auf den polierten Fliesen herumlagen, oder die Pfützen aus Blut und Fäkalien und die Stofffetzen und Haarbüschel.
Urb hatte nur zwei Schritte in den Raum hineingemacht und stand jetzt einfach da, starrte auf das hinunter, worin er stand. Hellian schob sich an ihm vorbei. Ihre Hand bewegte sich aus eigenem Antrieb auf die Flasche zu, die sie sich hinter den Gürtel gestopft hatte. Banaschar hielt sie fest. »Nicht hier drin«, sagte er.
Sie schüttelte ihn grob ab. »Zum Vermummten mit Euch«, knurrte sie, zog die Flasche heraus und entkorkte sie. Sie trank drei schnelle Schlucke. »Korporal, such Kommandant Charl. Wir werden ein paar Männer brauchen, um dieses Gebiet zu sichern. Und lass eine Nachricht zur Faust schicken. Ich will, dass ein paar Magier hierherkommen.«
»Sergeant«, sagte Banaschar, »dies ist eine Sache für Priester.«
»Macht Euch nicht lächerlich.« Sie winkte ihren restlichen Wachen. »Schaut euch genau um. Seht nach, ob es irgendwelche Überlebenden –«
»Es gibt keine«, behauptete Banaschar. »Die Hohepriesterin der Königin der Träume ist bereits gegangen, Sergeant. Folglich werden alle Tempel benachrichtigt werden. Und es wird Untersuchungen geben.«
»Was für Untersuchungen?«, wollte Hellian wissen.
Er verzog das Gesicht. »Priesterliche.«
»Und was ist mit Euch?«
»Ich habe genug gesehen«, sagte er.
»Denkt nicht einmal daran, irgendwohin zu gehen, Banaschar«, sagte sie, während sie den Blick noch einmal über das Gemetzel schweifen ließ. »Die erste Nacht der Klaren Jahreszeit im Großen Tempel, das hat immer eine Orgie bedeutet. Sieht aus, als wäre sie irgendwie aus dem Ruder gelaufen.« Zwei weitere schnelle Schlucke aus der Flasche, und gesegnete Betäubung winkte ihr. »Es gibt eine Menge Fragen, die Ihr beantworten –«
Urbs Stimme ertönte. »Er ist weg, Sergeant.«
Hellian wirbelte herum. »Verdammt! Hast du den Bastard nicht im Auge behalten, Urb?«
Der große Mann breitete die Arme aus. »Du hast dich mit ihm unterhalten, Sergeant. Ich habe die Menge da draußen beobachtet. Er ist nicht an mir vorbeigekommen, so viel ist sicher.«
»Verteile eine Beschreibung. Ich will, dass er gefunden wird.«
Urb runzelte die Stirn. »Oh ... äh, ich kann mich nicht erinnern, wie er ausgesehen hat.«
»Verdammt sollst du sein, ich auch nicht.« Hellian ging an die Stelle, wo Banaschar gestanden hatte. Starrte aus zusammengekniffenen Augen auf seine Fußspuren in der blutigen Pfütze hinunter. Sie führten nirgendwohin.
Zauberei. Sie hasste Zauberei. »Weißt du, was ich gerade höre, Urb?«
»Nein.«
»Ich höre die Faust. Ich höre sie pfeifen. Du weißt, warum sie pfeift?«
»Nein. Hör zu, Sergeant –«
»Es ist die Bratpfanne, Urb. Es ist das feine, liebliche Brutzeln, das ihn so glücklich macht.«
»Sergeant –«
»Was glaubst du, wohin wird er uns schicken? Nach Korel? Das wäre ein richtiger Schlamassel. Vielleicht nach Genabackis, obwohl es da inzwischen einigermaßen ruhig ist. Vielleicht auch ins Reich der Sieben Städte.« Sie trank den letzten Schluck Birnenbranntwein aus der Flasche. »Eins ist allerdings sicher, Urb. Wir sollten auf alle Fälle schon mal unsere Schwerter wetzen.«
Von der Straße her war das Trampeln schwerer Stiefel zu hören. Mindestens ein halbes Dutzend Trupps.
»Auf Schiffen gibt’s nicht viele Spinnen, stimmt’s, Urb?« Sie blickte zu ihm hinüber, versuchte, ihren verschwommenen Blick zu klären und musterte den elendigen Ausdruck in seinem Gesicht. »Das stimmt doch, oder? Sag mir, dass es so ist, verdammt.«
Vor vielleicht einhundert Jahren hatte ein Blitz den großen Guldindhabaum getroffen. Das weiße Feuer war wie ein Speer durch sein Herzholz gefahren und hatte den alten Stamm weit aufgerissen. Die geschwärzten Brandspuren waren in der Wüstensonne längst verblichen, die Tag um Tag auf den wurmzerfressenen Stamm herabgebrannt hatte. Die Rinde hatte sich in großen Stücken abgeschält und lag als dicke Schicht auf den freiliegenden Wurzeln, die sich wie ein gewaltiges Netz um die Hügelkuppe wanden.
Der ehemals kreisrunde, jetzt aber missgestaltete Erdhügel beherrschte die ganze Senke. Er stand allein, eine vollkommen absichtliche Insel inmitten einer willkürlichen, zufälligen Landschaft. Unter den wild übereinanderliegenden Felsblöcken, der sandigen Erde und den sich schlängelnden toten Wurzeln war der Schlussstein, der einst ein von Steinplatten begrenztes Begräbniszimmer geschützt hatte, geborsten und dann nach unten gestürzt, hatte den Hohlraum unter ihm verschlungen und ein gewaltiges Gewicht auf den Leichnam gebracht, der in dem Hügel begraben war.
Dass Erschütterungen von Schritten bis zu jenem Leichnam hinunterdrangen, geschah so selten – vielleicht ein Dutzend Mal in den vergangenen, zahllosen Jahrtausenden –, dass die lange schlafende Seele erwachte und sich dann auf eindringliche Weise gewärtig wurde, dass die Schritte nicht von einem Paar Füße, sondern von einem Dutzend stammten, die die steilen, unwegsamen Hänge heraufstiegen und sich schließlich um den zerborstenen Baum versammelten.
Der Strang aus Schutzzaubern, der die Kreatur umgab, war verzerrt und verdreht, doch die vielschichtig in ihn hineingewobene Macht ungebrochen. Derjenige, der die Kreatur in dieses Gefängnis gesperrt hatte, war gründlich gewesen, hatte entschiedene, dauerhafte Rituale geschaffen, von Blut gezeichnet und vom Chaos genährt. Diese Schutzzauber sollten für immer halten.
Doch solche Absichten waren dünkelhaft und gründeten auf der fehlerhaften Annahme, dass die Sterblichen eines Tages ohne Bosheit sein würden, ohne Verzweiflung. Dass die Zukunft ein sichererer Ort als die brutale Gegenwart sein würde und dass alles, was einmal vergangen war, nie wieder auftauchen würde. Den zwölf schlanken Gestalten, die in zerfetzte, fleckige Leinenstoffe gehüllt waren – die Köpfe von Kapuzen verdeckt, die Gesichter hinter grauen Schleiern verborgen –, waren sich der Risiken vollauf bewusst, die es mit sich brachte, zu überstürzten Handlungen gezwungen zu sein. Doch leider war ihnen auch bewusst, was Verzweiflung war.
Allen war es bestimmt, bei dieser Zusammenkunft zu sprechen, wobei die Reihenfolge durch die miteinander in Beziehung stehenden Positionen verschiedener Sterne, Planeten und Sternbilder bestimmt wurde, die zwar am blauen Himmel alle nicht zu sehen waren, deren Standorte jedoch nichtsdestotrotz bekannt waren. Nachdem sie ihre Plätze eingenommen hatten, verstrich ein langer Augenblick der Stille, dann sprach der erste der Namenlosen.
»Einmal mehr stehen wir dem Unumgänglichen gegenüber. Dies sind die Muster, die vor langer Zeit vorausgesehen wurden, und die deutlich machen, dass alle unsere Mühen vergeblich waren. Im Namen des Mockra – Gewirrs beschwöre ich das Ritual der Befreiung.«
Bei diesen Worten spürte die Kreatur im Innern des Hügelgrabs plötzlich ein Krachen, und das erwachte Bewusstsein erinnerte sich daran, wer es war. Sein Name war Dejim Nebrahl. Geboren am Vorabend des Untergangs des Ersten Imperiums, als die Straßen der Stadt gebrannt hatten und Schreie von pausenlosem Gemetzel gekündet hatten. Denn die T’lan Imass waren gekommen.
Dejim Nebrahl, der in das gesamte Wissen hineingeboren worden war, ein Kind mit sieben Seelen, das blutverschmiert und zitternd aus dem auskühlenden Leichnam seiner Mutter geklettert war. Ein Kind. Eine Abscheulichkeit.
T’rolbarahl- dämonische Geschöpfe, die Dessimbelackis selbst geschaffen hatte, lange bevor die Dunklen Hunde in den Gedanken des Imperators Gestalt angenommen hatten. Die T’rolbarahlmissgestaltete Irrtümer des Urteilsvermögens – waren vernichtet, auf persönlichen Befehl des Imperators ausgelöscht worden. Bluttrinker, die sich von menschlichem Fleisch ernährten, und noch viel gerissener waren, als selbst Dessimbelackis es sich vorgestellt hatte. Und so war es sieben T’robarahl gelungen, ihren Jägern für eine gewisse Zeit zu entkommen – lange genug, um etwas von ihrer Seele einer menschlichen Frau zu übertragen, die seit den Trellkriegen verwitwet und ohne Familie war, einer Frau, die niemand beachten würde, deren Geist gebrochen werden konnte, deren Körper zu einem nährenden Gefäß gemacht werden konnte, eine M’ena-Mhybe für das siebengesichtige, vielwandlerische T’rolbarahl-Kind, das rasch in ihr heranwuchs.
Geboren in einer Nacht des Entsetzens. Hätten die T’lan Imass Dejim gefunden, hätten sie ohne zu zögern gehandelt: Sie hätten die sieben Seelen aus ihm herausgezogen und sie in ewigem Schmerz gebunden, hätten ihre Macht ausbluten lassen, langsam und schrittweise, um die Knochenwerfer der T’lan in ihrem niemals endenden Krieg gegen die Jaghut zu nähren.
Doch Dejim Nebrahl war entkommen. Und seine Macht war gewachsen, jedes Mal, wenn er sich genährt hatte, Nacht für Nacht in den Ruinen des Ersten Imperiums. Immer verborgen, sogar vor den wenigen Wechselgängern und Vielwandlern, die das Große Gemetzel überlebt hatten, denn selbst sie hätten seine Existenz nicht ertragen können. Er nährte sich auch von einigen von ihnen, denn er war klüger als sie, und schneller, und wenn nicht die Deragoth über seine Spur gestolpert wären ...
Die Dunklen Hunde hatten in jenen Tagen einen Herrn, einen klugen Herrn, der meisterhaft mit bestrickender Zauberei umzugehen wusste, und der niemals aufgab, wenn er sich einmal für eine Aufgabe entschieden hatte.
Ein einziger Fehler, und Dejims Freiheit war dahin. Ein Schutzzauber nach dem anderen nahm ihm das Bewusstsein seiner selbst und damit jedes Gefühl dafür, einmal ... anders gewesen zu sein.
Doch jetzt ... war er wieder wach.
Die zweite Namenlose sprach: »Südlich und westlich der Raraku gibt es eine gewaltige Ebene, die sich gleichförmig viele Meilen in alle Richtungen erstreckt. Wenn der Sand weggeblasen wird, kann man dort die Scherben von einer Million zerbrochener Töpfe sehen, und überquert man die Ebene barfuß, hinterlässt man eine Spur aus blutigen Fußstapfen. In diesem Schauplatz liegt eine vollendete Wahrheit. Auf dem Weg aus der Grausamkeit ... müssen einige Gefäße zerbrechen. Und der Gast muss einen Wegezoll bezahlen ... in Blut. Bei der Macht des Telas-Gewirrs beschwöre ich das Ritual der Befreiung.«
Im Innern des Hügelgrabs wurde sich Dejim Nebrahl seines Körpers bewusst. Er spürte zerschlagenes Fleisch, überbeanspruchte Knochen, scharfkantige Kiesel, rieselnde Sandkörner und das gewaltige Gewicht, das auf ihm ruhte. Schrecklicher Schmerz.
»Da wir Schuld an diesem Dilemma sind«, sagte der dritte Priester, »müssen wir auch zu seiner Lösung beitragen. Chaos verfolgt diese Welt und jede Welt jenseits von ihr. In den Meeren der Wirklichkeit kann man eine Vielzahl von Schichten übereinander dahintreibender Daseinsformen finden. Chaos droht mit Stürmen und Fluten und unberechenbaren Strömungen, verwirbelt alles zu einem schrecklichen Durcheinander. Wir haben eine Strömung ausgewählt, eine schreckliche, ungebändigte Macht – wir haben sie ausgewählt, um sie zu lenken, um ungesehen und unangefochten ihren Weg zu gestalten. Wir wollen eine Kraft auf die andere hetzen und so dafür zu sorgen, dass sie sich gegenseitig auslöschen. Wir übernehmen in dieser Sache eine schreckliche Verantwortung, doch das, was wir an diesem Tag hier tun, bietet auch die einzige Aussicht auf Erfolg. Im Namen des Denul-Gewirrs beschwöre ich das Ritual der Befreiung.«
Der Schmerz in Dejims Körper verblasste. Immer noch gefangen und nicht in der Lage, sich zu bewegen, spürte der T’rolbarahl-Vielwandler, wie sein Fleisch heilte.
Der vierte Namenlose sagte: »Wir müssen einräumen, dass das unmittelbar bevorstehende Ableben eines ehrenvollen Dieners uns Kummer bereitet. Doch darf dieses Gefühl leider nur von kurzer Dauer sein, was der Bedeutung des unglücklichen Opfers nicht entspricht. Natürlich ist dies nicht der einzige Kummer, der uns abverlangt wird. Ich vertraue jedoch darauf, dass wir mit dem anderen alle unseren Frieden geschlossen haben, sonst wären wir nicht hier. Im Namen des D’riss-Gewirrs beschwöre ich das Ritual der Befreiung.«
Dejim Nebrahls sieben Seelen trennten sich voneinander. Er war ein Vielwandler, doch noch viel mehr als das, denn er war nicht sieben, die einer waren – obwohl man sagen konnte, dass auch das zutraf –, sondern sieben von unterschiedlicher Identität, unabhängig und doch vereint.
»Wir können noch nicht alle Aspekte dieses Weges erkennen«, sagte die fünfte Priesterin, »und was das angeht, dürfen unsere abwesenden Verwandten in ihrem Bemühen nicht nachlassen. Schattenthron kann nicht – darf nicht – unterschätzt werden. Er weiß zu viel. Über die Azath. Und vielleicht auch über uns. Noch ist er nicht unser Feind, doch das allein macht ihn längst nicht zu unserem Verbündeten. Er ... stört. Und ich hätte gerne, dass wir ihn bei der nächstbesten Gelegenheit auslöschen, obwohl mir klar ist, dass ich mit meiner Ansicht zur Minderheit in unserem Kult gehöre. Doch wer ist sich der Sphäre des Schattens und ihres neuen Herrn mehr bewusst als ich? Im Namen des Meanas-Gewirrs beschwöre ich das Ritual der Befreiung.«
Und so kam es, dass Dejim die Macht seiner Schatten verstand, sieben hervorgebrachte Täuscher, seine lauernden Helfer bei der Jagd, die ihn am Leben hielt, die ihm so viel Vergnügen bereitete – viel mehr als das Gefühl eines gefüllten Bauchs und frischen, warmen Bluts in den Adern. Die Jagd brachte ihm ... Herrschaft, und Herrschaft war wundervoll.
Jetzt sprach die sechste Namenlose; ihr Akzent war merkwürdig, jenseitig: »Alles, was sich in der Sphäre der Sterblichen entfaltet, formt den Boden, auf dem die Götter wandeln. Und so sind sie sich ihrer Schritte niemals sicher. Uns fällt es zu, jene Stellen vorzubereiten, auf die sie ihre Füße setzen, die tiefen, tödlichen Gruben zu graben, die Fallen und Schlingen, die von den Namenlosen geformt werden, denn wir sind die Hände der Azath, wir sind diejenigen, die dem Willen der Azath Gestalt verleihen. Es ist unsere Aufgabe, alles zusammenzuhalten, zu heilen, was auseinandergerissen wurde, und unsere Feinde zur Vernichtung oder in die ewige Gefangenschaft zu führen. Wir werden nicht versagen. Ich berufe mich auf die Macht des Zerschmetterten Gewirrs Kurald Emurlahn und beschwöre das Ritual der Befreiung.«
Es gab bevorzugte Pfade durch die Welt, Splitterpfade, und Dejim hatte sie einst häufig benutzt. Er würde es wieder tun. Bald.
»Barghast, Trell, Tartheno Toblakai«, sagte der siebte Priester mit grollender Stimme, »in ihnen hat das Blut der Imass überlebt, gleichgültig, für wie rein sie sich halten. Solche Behauptungen sind Erfindungen, doch Erfindungen haben einen Zweck. Sie machen Unterscheidungen geltend, sie ändern den Pfad, der zuvor beschritten wurde, und den, der noch kommt. Sie formen in allen Kriegen die Symbole auf den Bannern und rechtfertigten das Gemetzel. Sie sollen zweckdienlichen Lügen Geltung verschaffen. Beim Tellann-Gewirr beschwöre ich das Ritual der Befreiung.«
Feuer im Herzen, ein plötzliches Summen von Leben. Kaltes Fleisch wurde warm.
»Gefrorene Welten verbergen sich in der Dunkelheit«, erklang die krächzende Stimme des achten Priesters, »und bewahren so das Geheimnis des Todes. Das Geheimnis ist außerordentlich. Der Tod kommt als Wissen. Erkenntnis, Verständnis, Akzeptanz. Das ist er, nicht mehr und nicht weniger. Es wird eine Zeit kommen, die vielleicht gar nicht mehr so fern liegt, da der Tod sein eigenes Antlitz in einer Vielzahl von Facetten erkennt, und etwas Neues wird geboren werden. Im Namen des Gewirrs des Vermummten beschwöre ich das Ritual der Befreiung.«
Der Tod. Er war ihm vom Herrn der Dunklen Hunde gestohlen worden. Er war vielleicht etwas, nach dem man sich sehnen konnte. Aber jetzt noch nicht.
Der neunte Priester lachte leise und fröhlich, ehe er sagte: »Wo alles begann, dorthin wird am Ende alles zurückkehren. Im Namen des Gewirrs der Wahren Dunkelheit, im Namen Kurald Galains beschwöre ich das Ritual der Befreiung.«
»Und bei der Macht von Rashan«, zischte der zehnte Namenlose ungeduldig, »beschwöre ich das Ritual der Befreiung.«
Der neunte Priester lachte erneut.
»Die Sterne kreisen«, sagte der elfte Namenlose, »und so keimt Spannung auf. Es liegt Gerechtigkeit in allem, was wir tun. Im Namen des Thyrllann-Gewirrs beschwöre ich das Ritual der Befreiung.«
Sie warteten. Darauf, dass die zwölfte Namenlose sprechen würde. Doch sie sagte nichts, streckte stattdessen eine schlanke, rostrot geschuppte Hand aus, die alles andere als menschlich war.
Und Dejim Nebrahl spürte eine Präsenz. Eine kalte, brutale Intelligenz sickerte von oben herab, und der Vielwandler bekam plötzlich Angst.
»Kannst du mich hören, T’rolbarahl?«
ja.
»Wir werden dich befreien, aber du musst für deine Befreiung bezahlen. Wenn du dich weigerst, werden wir dich erneut ins geistlose Vergessen schicken.«
Aus Furcht wurde Entsetzen. Welche Bezahlung verlangt ihr von mir?
»Bist du einverstanden?«
Ja.
Dann erklärte sie ihm, was von ihm verlangt wurde. Es schien eine einfache Sache zu sein. Eine kleine Aufgabe, leicht zu erfüllen. Dejim Nebrahl war erleichtert. Es würde nicht lange dauern – die Opfer waren schließlich ganz in der Nähe –, und wenn es getan war, wäre er frei von jeglicher Verpflichtung und könnte tun, was ihm gefiel.
Die zwölfte und letzte Namenlose, die einst als Schwester Bosheit bekannt gewesen war, ließ die Hand sinken. Sie wusste, dass von den zwölf, die hier versammelt waren, sie allein das Hervortreten dieses tödlichen Dämons überleben würde. Denn Dejim Nebrahl würde hungrig sein. Das war bedauerlich, ebenso bedauerlich wie der Schock und die Bestürzung ihrer Kameraden, wenn sie sie fliehen sehen würden – in dem kurzen Augenblick, ehe der T’rolbarahl angriff. Sie hatte natürlich ihre Gründe. Der erste und wichtigste war schlicht und ergreifend der Wunsch, zumindest noch ein Weilchen länger unter den Lebenden zu weilen. Was die anderen Gründe anging, waren sie einzig und allein ihre Sache.
»Im Namen des Gewirrs Starvald Demelain beschwöre ich das Ritual der Befreiung«, sagte sie. Und mit ihren Worten sank eine Macht der Entropie herab, durch tote Wurzeln, durch Stein und Sand, und löste Schutzzauber um Schutzzauber auf – eine Macht, die die Welt als Otataral kannte.
Und Dejim Nebrahl stieg in die Welt der Lebenden auf.
Elf Namenlose begannen ihr letztes Gebet. Die meisten von ihnen brachten es nie zu Ende.
Ein ganzes Stück vom Ort der Geschehnisse entfernt hockte ein tätowierter Krieger im Schneidersitz an einem kleinen Feuer; er neigte den Kopf, als Schreie an sein Ohr drangen. Er blickte nach Süden und sah einen Drachen schwer von den Hügeln aufsteigen, die den Horizont bildeten; seine gesprenkelten Schuppen glitzerten im ersterbenden Licht der Sonne. Der Krieger zog ein finsteres Gesicht, während er beobachtete, wie der Drache immer höher stieg.
»Dieses Miststück«, murmelte er. »Ich hätte es ahnen müssen.«
Er setzte sich wieder hin, während die Schreie in der Ferne verklangen. Die länglichen Schatten zwischen den Felsen, die seinen Lagerplatz umgaben, waren plötzlich unangenehm, dicht und schmierig.
Taralack Veed, ein Gralkrieger und der letzte Überlebende des Geschlechts der Eroth, sammelte einen Mundvoll Schleim und spuckte ihn in die Handfläche seiner linken Hand. Er verteilte den Schleim gleichmäßig in beiden Händen und strich ihn sich dann über den Kopf, klatschte sich in einer häufig geübten Bewegung die schwarzen Haare an den Schädel, was die Fliegen in seinen Haaren für einen Augenblick aufschreckte, ehe sie sich wieder darin niederließen.
Nach einiger Zeit spürte er, dass die Kreatur ihre Mahlzeit beendet hatte und sich in Bewegung setzte. Taralack richtete sich auf. Er pisste ins Feuer, um es zu löschen, sammelte seine Waffen zusammen und machte sich auf, die Spur des Dämons zu suchen.
In der Handvoll Hütten an der Kreuzung lebten achtzehn Menschen. Die Straße, die parallel zur Küste verlief, war die Tapurstraße, und drei Tagesreisen im Norden lag die Stadt Ahol Tapur. Die andere Straße – kaum mehr als ein von Wagenspuren gekennzeichneter Pfad – überquerte tief im Landesinnern das Path’Apur-Gebirge und führte dann zwei Tagesreisen nach Osten, an diesem Weiler vorbei, wo sie schließlich auf die Küstenstraße stieß, die an der Otataral-See verlief.
Vor vier Jahrhunderten hatte sich hier ein blühendes Dorf befunden. Die Hügelkette im Süden war von Hartholzbäumen mit ausgesprochen fedrigem Laub bedeckt gewesen, Bäume, die es mittlerweile auf diesem Subkontinent nicht mehr gab. Passenderweise war das Holz dieser Bäume dazu benutzt worden, Sarkophage herzustellen, und dadurch war das Dorf in Städten wie dem weit entfernt im Süden gelegenen Hissar bekannt geworden, oder auch in Karashimesh im Westen oder Ehrlitan im Nordwesten. Dieses Gewerbe war mit dem letzten Baum ausgestorben. Das niedrige Gehölz verschwand in den Mägen der Ziegen, die fruchtbarste oberste Bodenschicht wurde weggeweht, und binnen einer einzigen Generation war das Dorf auf seinen jetzigen, verfallenen Zustand herabgesunken
Die achtzehn Einwohner, die noch hier lebten, boten jetzt Dienstleistungen an, die immer weniger gebraucht wurden – sie versorgten vorbeiziehende Karawanen mit Wasser, besserten Sattel- und Zaumzeug aus und was es an derlei Dingen sonst noch gab. Einmal – vor nunmehr zwei Jahren - war ein malazanischer Offizieller vorbeigekommen und hatte etwas von einer neuen erhöhten Straße und einem Außenposten mit Garnison gemurmelt, doch der Anlass zu solchen Überlegungen war der illegale Handel mit unverarbeitetem Otataral gewesen, den andere imperiale Maßnahmen mittlerweile zum Erliegen gebracht hatten.
Die Rebellion, die vor kurzem stattgefunden hatte, war nie so richtig ins Bewusstsein der Dorfbewohner gedrungen, abgesehen von den Gerüchten, die dann und wann ein vorbeireitender Bote oder Gesetzloser mitgebracht hatte, aber selbst die gelangten nicht mehr in den Weiler. Wie dem auch war, Rebellionen waren etwas für andere Leute.
So kam es, dass die fünf Gestalten, die kurz nach Mittag plötzlich auf der nächsten Erhebung der ins Landesinnere führenden Straße auftauchten, rasch bemerkt wurden, und die Nachricht gelangte bald zum nominellen Oberhaupt der Gemeinschaft, dem Hufschmied namens Barathol Mekhar, der als Einziger von allen, die hier lebten, nicht in dem Weiler geboren war. Von seiner Vergangenheit draußen in der Welt war wenig bekannt, außer dem, was selbstverständlich war – seine tiefschwarze Haut kennzeichnete ihn als Mitglied eines Stammes aus der tausende von Meilen weit weg gelegenen südwestlichen Ecke des Subkontinents. Und die gewundenen Hautritzungen auf seinen Wangen wirkten kriegerisch, genau wie die kreuz und quer verlaufenden, zahllosen Narben alter Schnittwunden auf seinen Händen und Unterarmen. Er war als ein Mann bekannt, der wenig Worte machte und eigentlich keine Meinung hatte – zumindest keine, die er mit irgendjemandem geteilt hätte –, und eignete sich daher wunderbar als inoffizieller Anführer des Weilers.
Gefolgt von einem halben Dutzend Erwachsenen, die sich immer noch zur Neugier bekannten, schritt Barathol Mekhar die einzige Straße entlang, bis er an den Rand des Weilers kam. Die Gebäude auf beiden Seiten waren nur noch Ruinen und schon lange verlassen; ihre Dächer waren eingestürzt, die Wände in sich zusammengefallen und halb unter Sandverwehungen begraben. Vielleicht sechzig Schritt entfernt standen die fünf Gestalten, reglos, bis auf die ausgefransten Enden ihrer Fellumhänge. Zwei hielten Speere in den Händen, während die anderen lange, zweihändige Schwerter auf dem Rücken trugen. Einigen von ihnen schienen Gliedmaßen zu fehlen.
Barathols Augen waren nicht mehr so scharf wie einst, doch auch so ... »Jhelim, Filiad, geht zur Schmiede. Geht, rennt nicht. Hinter den Lederballen steht eine Truhe. Sie hat ein Schloss – brecht es auf. Holt die Axt und den Schild heraus, und die Handschuhe und den Helm; lasst das Kettenhemd liegen – dafür ist jetzt keine Zeit. Und nun geht.«
In den elf Jahren, die Barathol bei ihnen lebte, hatte er noch niemals so viele Worte auf einmal an einen von ihnen gerichtet. Jhelim und Filiad starrten den breiten Rücken des Hufschmieds entsetzt an, dann, als sich die Furcht in ihre Eingeweide stahl, drehten sie sich um und gingen mit steifen, merkwürdig überlangen Schritten die Straße entlang.
»Banditen«, flüsterte Kulat, der Hirte, der seine letzte Ziege geschlachtet hatte, als eine Karawane vorbeigekommen und ihm für das Fleisch eine Flasche Branntwein geboten hatte. Das war vor sieben Jahren gewesen, und seither hatte er nichts mehr getan. »Vielleicht wollen sie nur Wasser – wir haben selbst ja nichts anderes.« Die kleinen, runden Kieselsteine, auf denen er dauernd herumlutschte, stießen klickend gegeneinander, wenn er sprach.
»Die wollen kein Wasser«, sagte Barathol. »Ihr anderen, geht, sucht Waffen – irgendetwas – nein, lasst es. Geht einfach nur in eure Häuser. Bleibt dort.«
»Worauf warten sie?«, wollte Kulat wissen, während die anderen sich zerstreuten.
»Ich weiß es nicht«, musste der Hufschmied zugeben.
»Nun, sie sehen aus, als würden sie zu einem Stamm gehören, den ich noch nie zuvor gesehen habe.« Er saugte einen Moment lang an den Steinen und sagte dann: »Diese Felle ... ist es nicht ein bisschen warm für Felle? Und diese Knochenhelme –«
»Sie sind aus Knochen? Deine Augen sind besser als meine, Kulat.«
»Das Einzige an mir, was noch was taugt, Barathol. Ziemlich stämmige Kerle, was? Erkennst du vielleicht den Stamm?«
Der Hufschmied nickte. Er konnte jetzt Jhelim und Filiad hören, die aus dem Dorf herankamen; sie schnauften laut. »Ich glaube«, sagte Barathol zur Antwort auf Kulats Frage.
»Werden sie Ärger machen?«
Jhelim trat in sein Blickfeld, mühte sich mit dem Gewicht der doppelklingigen Axt ab, deren Schaft mit Eisenstreifen umhüllt war; eine Kette war um den beschwerten Knauf geschlungen, und die geschliffenen Schneiden aus Arenstahl glänzten silbern. Aus der Spitze der Waffe ragte ein dreizinkiger Dorn, scharf wie die Spitze eines Armbrustbolzens. Der junge Mann starrte sie an, als wäre sie das Zepter des alten Imperators.
Neben Jhelim war Filiad, der die mit Eisenschuppen besetzten Handschuhe, einen Rundschild und den mit einer Brünne und einem Gesichtsgitter versehenen Helm trug.
Barathol nahm die Handschuhe und legte sie an. Die geriffelten Schuppen reichten über seine Unterarme bis zu einer drehbaren Ellbogenschale, und die Handschuhe wurden mit Riemen gleich oberhalb des Gelenks an Ort und Stelle gehalten. An der Unterseite der Manschetten befand sich ein einzelner Eisenstab, der schwarz und eingekerbt war und vom Handgelenk bis zum Ellbogenschutz reichte. Dann nahm er den Helm und machte ein finsteres Gesicht. »Ihr habt die gesteppte Polsterung vergessen.« Er gab ihn zurück. »Gebt mir den Schild – befestige ihn an meinem Arm, verdammt, Filiad. Fester. Gut.«
Schließlich griff der Hufschmied nach der Axt. Jhelim brauchte beide Arme und all seine Kraft, um die Waffe hoch genug zu heben, dass Barathol seine rechte Hand durch die Kettenschlaufe schieben konnte. Er zwirbelte die Kette zweimal um sein Handgelenk, ehe er die Finger um den Schaft schloss und Jhelim die Waffe anscheinend ohne Anstrengung abnahm. »Verschwindet«, sagte er zu den beiden.
Kulat blieb. »Sie kommen jetzt näher, Barathol.«
Der Hufschmied hatte den Blick die ganze Zeit nicht von den Gestalten abgewandt. »So blind bin ich auch wieder nicht, alter Mann.«
»Du musst es sein, wenn du hier stehen bleibst. Du sagst, du kennst den Stamm – sind sie vielleicht deinetwegen gekommen? Irgendeine alte Blutrache?«
»Es ist möglich«, gab Barathol zu. »Wenn dem so ist, sollte euch nichts passieren. Wenn sie mit mir fertig sind, werden sie verschwinden.«
»Warum bist du dir so sicher?«
»Ich bin mir überhaupt nicht sicher.« Barathol hob die Axt, um bereit zu sein. »Wenn’s um T’lan Imass geht, kann man sich nie sicher sein.«
Buch Eins
Der tausendfingrige Gott
Ich schritt den gewundenen Pfad hinunter ins Tal,
Wo niedrige Steinmauern Höfe und Güter trennten
Jede wohlüberlegte Einheit ein Teil des Ganzen
Das alle wohl verstanden, die dort lebten,
Es leitete ihre Reisen und Rufe bei Tage
Und reichte ihnen in der dunkelsten Nacht eine vertraute Hand
Führte sie zurück zur Tür des Hauses und den herumtollenden Hunden.
Ich schritt dahin, bis ich von einem alten Mann aufgehalten wurde,
Der seine Arbeit unterbrach und mich herausfordernd ansah;
Um seiner Einschätzung und Beurteilung zu entgehen,
Bat ich ihn lächelnd, mir alles zu sagen, was er wusste,
Über die Länder im Westen, jenseits des Tales,
Und erleichtert antwortete er, dass dort Städte waren,
Riesengroß und von allen möglichen Merkwürdigkeiten wimmelnd,
Mit einem König und sich bekämpfenden Priesterschaften, und einmal,
So sagte er, habe er eine Wolke aus Staub aufsteigen gesehen
Vom Vorbeiziehen einer Armee, unterwegs zu einer Schlacht
Irgendwo im kalten Süden, da war er sich sicher,
Und so nahm ich alles, was er wusste, viel war es nicht,
Denn jenseits des Tales war er nie gewesen, seit seiner Geburt
Bis jetzt hatte er nichts gewusst und war,
Um die Wahrheit zu sagen, nie gewesen, denn so
Gestaltet sich das Ganze für die Niederen
An allen Orten zu allen Zeiten und die Neugier ruht ungeschärft
Und löchrig, obwohl er genug Atem hatte, um zu fragen
Wer ich war und wie ich hergekommen war und wo ich hinwollte.
Und so antwortete ich mit einem verblassenden Lächeln,
Dass ich zu den wimmelnden Städten unterwegs war, doch zuerst
Hier vorbeikommen musste, und ob er schon bemerkt hatte,
Dass seine Hunde reglos auf dem Boden lagen,
Denn ich hatte die Erlaubnis, versteht ihr, zu antworten, dass ich gekommen war,
Die Herrin der Pest, und dies war – leider – der Beweis
Für ein sehr viel größeres Ganzes.
Poliels ErlaubnisFISHER KEL TATH
Kapitel Eins
Auf den Straßen wimmelt es in diesen Tagen von Lügen.
Hohemagier Tayschrenn bei der Krönung von Imperatrix Laseen Aufgezeichnet vom Imperialen Historiker Duiker
Im Jahre 1164 von Brands SchlafAchtundfünfzig Tage nach der Hinrichtung von Sha’ik
Launische Winde hatten früher am Tag den Staub aufgewirbelt und die Haut und die Kleider all derjenigen, die Ehrlitan durch das östliche, dem Landesinnern zugewandte Stadttor betraten, in die gleiche Farbe wie die roten Sandsteinhügel gehüllt. Händler, Pilger, Viehtreiber und Reisende erschienen vor den Wachen wie heraufbeschworen. Sie tauchten einer nach dem anderen mit gesenkten Köpfen aus dem wirbelnden Staubschleier auf, schleppten sich in den Windschatten des Tores, die Augen hinter Schichten aus zusammengefaltetem, dreckigem Leinen zu Schlitzen zusammengekniffen. Rostrot bestäubte Ziegen stolperten hinter den Viehtreibern her, Pferde und Ochsen trotteten mit hängenden Köpfen und einer Schmutzkruste um Augen und Nüstern heran, und Wagen machten zischende Geräusche, wenn der Sand zwischen den verwitterten Brettern ihrer Wagenböden hindurchrieselte. Die Wachen betrachteten das Treiben und dachten dabei nur ans Ende ihrer Wache, sowie an das Bad, das Essen und die warmen Körper, die als angemessene Belohnung ihrer Pflichterfüllung auf sie warteten.
Die Frau, die zu Fuß durch das Tor ging, fiel ihnen auf, doch aus völlig falschen Gründen. In eng anliegende seidene Gewänder gekleidet, den Kopf und das Gesicht hinter einem Schal verborgen, war sie nichtsdestotrotz einen zweiten Blick wert – und wenn auch nur, um noch einmal die Eleganz ihrer Schritte und den Schwung ihrer Hüften zu bewundern. Den Rest steuerten die Wachen selbst bei, denn sie waren Männer und somit ihren Fantasien sklavisch ausgeliefert.
Die Frau bemerkte die kurzfristige Aufmerksamkeit und verstand sie gut genug, um nicht besorgt zu sein. Problematischer wäre es gewesen, wenn eine der Wachen eine Frau gewesen wäre – oder gar beide. Dann hätten sie sich möglicherweise gewundert, dass sie die Stadt ausgerechnet durch dieses Tor betrat, dass sie zu Fuß ausgerechnet diese Straße entlanggekommen war, die sich Meilen um Meilen durch sonnenverbrannte, praktisch leblose Hügel wand und dann noch weitere Meilen parallel zu einem größtenteils unbewohnten, aus verkrüppelten Bäumen bestehenden Wald verlief. Ihre Ankunft wäre womöglich noch ungewöhnlicher erschienen, da sie keine Vorräte trug und das geschmeidige Leder ihrer Mokassins kaum abgewetzt war. Wären die Wachen Frauen gewesen, hätten sie sie angesprochen, und sie wäre mit unangenehmen Fragen konfrontiert worden, die wahrheitsgemäß zu beantworten sie nicht vorbereitet war.
Daher war es ein Glück für die Wachen, dass sie Männer waren. Und es war auch ein Glück, dass die Fantasie eines Mannes sich so leicht ködern ließ, denn die Blicke folgten ihr nun die Straße entlang, doch ohne jeglichen Verdacht, stattdessen fieberhaft damit beschäftigt, die Rundungen ihres wohlgeformten Körpers bei jedem Schwung ihrer Hüften zu erahnen, eine Bewegung, die sie nur ganz leicht übertrieb.
Als sie an eine Kreuzung kam, wandte sie sich nach links und war einen Herzschlag später aus dem Blickfeld der Wachen verschwunden. Hier in der Stadt war der Wind weniger stark, obwohl auch hier feiner Staub in der Luft schwebte und alles mit einem einfarbigen, pudrigen Überzug versah. Die Frau bewegte sich weiter durch die Menge, näherte sich in einer einwärtsgedrehten Spirale allmählich Jen’rahb, dem zentralen Teil von Ehrlitan, der riesigen, vielstöckigen Ruine, die von kaum mehr als Ungeziefer vier – und zweibeiniger Art bewohnt wurde. Als sie schließlich in Sichtweite der eingestürzten Gebäude gelangte, fand sie ganz in der Nähe ein Gasthaus, das sich bescheiden ausnahm und nichts anderes sein wollte als ein Haus, das ein paar Huren in den Räumen im zweiten Stock beherbergte und ein Dutzend Stammgäste in der Schankstube im Erdgeschoss.
Neben dem Eingang zum Gasthaus befand sich ein Bogengang, der in einen kleinen Garten führte. Die Frau trat in den Durchgang, um sich den Staub von den Kleidern zu klopfen, ging dann weiter bis zu dem flachen Becken mit schlammigem Wasser unter einem gelegentlich tröpfelnden Springbrunnen, wo sie den Schal abnahm und sich Wasser ins Gesicht spritzte, genug, um das Brennen aus den Augen zu vertreiben.
Dann ging sie durch den Durchgang zurück und trat ins Innere der Schenke.
Drinnen herrschte düsteres Zwielicht, und Rauch von offenem Feuer, Öllaternen, Durhang, Itralbe und Rostlaub trieb unter der niedrigen, getünchten Decke; der Raum war zu drei Vierteln gefüllt, alle Tische waren besetzt. Kurz vor ihr hatte ein Mann die Schankstube betreten und erzählte nun atemlos von einem Abenteuer, das er gerade noch überlebt hatte. Die Frau, die dies bemerkte, als sie an dem Mann und seinen Zuhörern vorbeiging, erlaubte sich ein schwaches Lächeln, das vielleicht ein wenig trauriger war, als es in ihrer Absicht gelegen hatte.
Sie fand einen Platz an der Theke und winkte den Wirt heran. Er blieb vor ihr stehen und musterte sie aufmerksam, während sie in akzentfreiem Ehrlii eine Flasche Reiswein bestellte.
Auf ihren Wunsch hin griff er unter die Theke, und sie hörte Flaschen klirren, als er auf Malazanisch sagte: »Ich hoffe, du erwartest nichts, das wirklich diesen Namen verdient, Schätzchen.« Er richtete sich wieder auf, wischte den Staub von einer Tonflasche und betrachtete den Stöpsel. »Die hier ist zumindest noch versiegelt.«
»Das wird reichen«, sagte sie, immer noch im einheimischen Dialekt, und legte drei Silberhalbmonde auf die Theke.
»Hast du vor, die ganz auszutrinken?«
»Ich brauche ein Zimmer im Obergeschoss, in das ich mich zurückziehen kann«, erwiderte sie und zog den Stöpsel aus der Flasche, während der Wirt einen Zinnbecher auf den Tresen stellte. »Eins mit einem Schloss«, fügte sie hinzu.
»Dann lächelt Oponn auf dich herab«, sagte er. »Es ist gerade eins frei geworden.«
»Gut.«
»Gehörst du zu Dujeks Armee?«, fragte der Mann.
Sie schenkte sich etwas von dem bernsteinfarbenen, leicht trüben Wein ein. »Nein. Warum – ist sie hier?«
»Ein paar Reste«, erwiderte er. »Das Hauptheer ist vor sechs Tagen aus der Stadt marschiert. Sie haben natürlich eine Garnison hiergelassen. Und deshalb habe ich mich gefragt –«
»Ich gehöre zu keiner Armee.«
Ihr Tonfall – merkwürdig kalt und ausdruckslos – ließ ihn verstummen. Wenige Augenblicke später ging er, um sich um einen anderen Gast zu kümmern.
Sie trank. Sorgte dafür, dass der Flüssigkeitspegel der Flasche stetig fiel, während das Tageslicht draußen schwand und das Gasthaus sich noch mehr füllte, die Stimmen noch lauter wurden, Ellbogen und Schultern sie öfter anrempelten, als es nötig gewesen wäre. Sie achtete nicht auf die gelegentlichen Fummeleien, starrte nur auf die Flüssigkeit in dem Kelch vor ihr.
Schließlich war sie fertig, drehte sich um und schlängelte sich unsicher durch die unzähligen, sich drängenden Gäste, um schließlich bei der Treppe anzukommen. Vorsichtig stieg sie die Stufen hinauf, eine Hand am dürftigen Geländer, und wurde sich vage bewusst, dass ihr jemand folgte, was sie nicht weiter überraschte.
Auf dem Treppenabsatz lehnte sie sich mit dem Rücken gegen die Wand.
Der Fremde kam näher, immer noch ein dummes Grinsen im Gesicht – das ihm gefror, als sich eine Messerspitze knapp unter dem linken Auge in seine Haut bohrte.
»Geh wieder nach unten«, sagte die Frau.
Eine Träne aus Blut rann die Wange des Mannes hinunter, blieb dickflüssig an seinem Kinn hängen. Er zitterte und zuckte zusammen, als die Messerspitze sich immer tiefer grub. »Bitte«, flüsterte er.
Sie schwankte leicht, schlitzte dem Mann aus Versehen die Wange auf – zum Glück ging die Bewegung nach unten und nicht nach oben, ins Auge. Er schrie auf und wich stolpernd zurück, hob die Hände und versuchte, die Blutung zu stoppen, und torkelte dann die Stufen hinunter.
Erst Rufe von unten, dann raues Lachen.
Die Frau musterte das Messer in ihrer Hand, fragte sich, wo es hergekommen war und wessen Blut jetzt an seiner Klinge glänzte. Es spielte keine Rolle. Sie machte sich daran, ihr Zimmer zu suchen, und fand es schließlich.
Der gewaltige Sandsturm war natürlichen Ursprungs; draußen in der Weite der Jhag-Odhan entstanden, bewegte er sich nun kreisend ins Herz des Subkontinents, den man das Reich der Sieben Städte nannte. Die Winde fegten nordwärts, an der Ostseite der Hügel, Klippen und alten Berge entlang, die die Heilige Wüste Raraku umgaben – eine Wüste, die jetzt ein Meer war –, und wurden auf der ganzen Breite der Hügelkette in einen Krieg der Blitze gezogen, den man von den Städten Pan’potsun und G’danisban aus sehen konnte. Nach Westen weiterwirbelnd, streckte der Sturm sich windende Arme aus, und einer dieser Arme traf Ehrlitan, bevor sich seine Macht draußen auf der Ehrlitansee erschöpfte, ein anderer erreichte die Stadt Pur Atrii. Als das Zentrum des Sturms wieder ins Landesinnere zurückrollte, sammelte er neue Kräfte, hämmerte gegen die Nordseite des Thalasgebirges und umschlang die Städte Hatra und Y’Ghatan, ehe er sich ein letztes Mal gen Süden wandte. Ein natürlicher Sturm – vielleicht ein letztes Geschenk der alten Geister der Raraku.
Die fliehende Armee Leomans von den Dreschflegeln hatte dieses Geschenk dankbar angenommen, war tagelang in den unbarmherzigen Wind geritten. Die Tage hatten sich zu Wochen gedehnt, in denen die Welt um sie herum aus nichts weiter als einer Mauer aus schwebendem Sand bestand, was umso bitterer war, weil es die Überlebenden an etwas erinnerte – an ihren geliebten Wirbelwind, den Hammer von Sha’ik und Dryjhna der Apokalyptischen. Doch selbst in der Bitterkeit gab es Leben, gab es Rettung.
Tavores malazanische Armee folgte ihnen immer noch, nicht eilig, nicht mit der unbekümmerten Dummheit, die sie direkt nach Sha’iks Tod und der Zerschlagung der Rebellion gezeigt hatte. Jetzt war die Jagd eine sorgsam abgewogene Sache, eine taktische Verfolgung der letzten organisierten Streitmacht, die sich dem Imperium entgegenstellte. Eine Streitmacht, von der man glaubte, dass sie das Heilige Buch Dryjhnas besaß, das einzige Hoffnung spendende Artefakt für die kampfbereiten Rebellen aus dem Reich der Sieben Städte.
Leoman von den Dreschflegeln besaß das Buch zwar nicht, verfluchte es aber dennoch jeden Tag. Seine geknurrten Flüche zeugten von beinahe religiösem Eifer und einem beängstigenden Einfallsreichtum, doch der kratzende Wind riss die Worte dankenswerterweise mit sich, so dass nur Corabb Bhilan Thenu’alas, der dicht neben seinem Anführer ritt, sie hören konnte. Wenn er der Tirade müde wurde, dachte Leoman sich höchst kunstvolle Pläne aus, wie er das Buch zerstören würde, wenn er es denn einmal in die Hände bekäme. Feuer, Pferdepisse, Galle, Moranthmunition, der Bauch eines Drachen – bis Corabb irgendwann sein Pferd erschöpft zur Seite lenkte, um in der angenehmeren Gesellschaft seiner Mitrebellen zu reiten.
Die ihm dann regelmäßig mit ängstlichen Fragen zusetzten und unsichere Blicke in Leomans Richtung warfen. Was hat er gesagt?
Gebete, wurde Corabb nicht müde zu antworten. Unser Anführer betet den ganzen Tag zu Dryjhna. Leoman von den Dreschflegeln, sagte er ihnen, ist ein frommer Mann.
Genau so fromm, wie zu erwarten war. Die Rebellion brach in sich zusammen, verwehte im Wind. Städte hatten kapituliert, eine nach der anderen, als die Armeen und Schiffe des Imperiums aufgetaucht waren. Bürger wandten sich in ihrem Eifer, Verbrecher präsentieren zu können, die man für die unzähligen schrecklichen Taten während des Aufstands verantwortlich machen konnte, gegen ihre Nachbarn. Ehemalige Helden wurden den Rückeroberern genauso vorgeführt wie kleinliche Tyrannen, und die Gier nach Blut war groß. Solche grimmigen Neuigkeiten bekamen sie von den Karawanen zu hören, denen sie begegneten, während sie immer weiter flohen. Und mit jeder noch so kleinen Neuigkeit wurde Leomans Gesichtsausdruck düsterer, als wäre das alles, was er tun konnte, um die Wut in seinem Innern zurückzuhalten.
Es war die Enttäuschung, sagte Corabb zu sich selbst, und er unterstrich den Gedanken jedes Mal mit einem tiefen Seufzer. Die Menschen im Reich der Sieben Städte verzichteten so rasch auf die Freiheit, die um den Preis so vieler Leben errungen worden war, und das war nun wahrlich eine bittere Tatsache, ein höchst schäbiger Kommentar zur menschlichen Natur. War dann also alles vergebens gewesen? Wie sollte ein frommer Krieger da keine Enttäuschung verspüren, die seine Seele verbrannte? Wie viele zigtausend Menschen waren gestorben? Und wofür?
Und so sagte sich Corabb, dass er seinen Anführer verstand. Dass er verstand, dass Leoman nicht loslassen konnte – jetzt noch nicht, vielleicht niemals. Sich weiter an den Traum zu klammern verlieh allem, was zuvor geschehen war, Bedeutung.
Komplizierte Überlegungen. Es hatte Corabb viele Stunden stirnrunzelnden Nachdenkens gekostet, um auf diese Gedanken zu kommen, um den außergewöhnlichen Sprung in den Verstand eines anderen Mannes zu machen, durch seine Augen zu sehen, wenn auch nur einen Herzschlag lang, bevor er in demütiger Verwirrung zurücktaumelte. Doch dabei hatte er auch einen Blick auf das erhascht, was große Anführer – im Krieg wie in Staatsangelegenheiten – ausmachte. Die Leichtigkeit, mit der sie den Blickwinkel wechseln, sich die Dinge von allen Seiten ansehen konnten. Während Corabb – um bei der Wahrheit zu bleiben – nur eines tun konnte: sich inmitten all der Zwietracht, die die Welt immer wieder vor ihm aufsteigen ließ, an einer einzigen Vision festzuklammern – an seiner eigenen.
Ohne seinen Anführer, das wusste Corabb nur zu gut, wäre er verloren.
Eine behandschuhte Hand winkte, und Corabb gab seinem Reittier die Fersen, bis er an Leomans Seite war.
Der von einer Kapuze geschützte Kopf drehte sich, das hinter einem Tuch verborgene Gesicht wandte sich ihm zu, von Leder umschlossene Finger zupften das Tuch über dem Mund weg, und Worte wurden gerufen, so dass Corabb sie hören konnte: »Wo im Namen des Vermummten sind wir?«
Corabb starrte ihn an, blinzelte ... und seufzte.
Ihre Finger erzeugten das Drama, pflügten eine traumatische Furche quer über den wimmelnden Pfad. Die Ameisen rannten verwirrt wild durcheinander, und Samar Dev schaute zu, wie sie wütend an der Beleidigung herumscharrten, die Soldaten mit erhobenen Köpfen und weit geöffneten Mandibeln, als ob sie die Götter herausfordern wollten. Oder, in diesem Fall, eine Frau, die allmählich verdurstete.
Sie lag auf der Seite im Schatten des Wagens. Es war kurz nach Mittag, und kein Lüftchen regte sich. Die Hitze hatte ihr jegliche Kraft geraubt. Es war unwahrscheinlich, dass sie ihren Angriff auf die Ameisen fortsetzen konnte, und diese Erkenntnis ließ für einen Augenblick Bedauern in ihr aufsteigen. Zwietracht in ein ansonsten vorhersehbares, abgestumpftes und schäbiges Leben zu bringen, schien eine lohnende Sache zu sein. Nun, vielleicht nicht lohnend, aber gewiss interessant. Wahrhaft göttergleiche Gedanken, die ihren letzten Tag unter den Lebenden kennzeichneten.
Eine Bewegung erregte ihre Aufmerksamkeit. Der Staub auf der Straße erzitterte, und jetzt konnte sie ein lauter werdendes Donnergrollen hören, das wie irdene Trommeln nachhallte. Der Weg, auf dem sie sich befand, wurde hier in der Ugarat-Odhan nicht häufig benutzt. Er gehörte zu einem Zeitalter, das längst dahin war; damals waren die Karawanen regelmäßig auf den gut zwanzig Karawanenrouten von einer zur nächsten der mehr als ein Dutzend großen Städte gezogen, von denen das alte Ugarat die Nabe gewesen war, und alle diese Städte – abgesehen von Kayhum am Flussufer und Ugarat selbst – waren seit mehr als tausend Jahren tot.
Dennoch konnte ein einzelner Reiter ebenso leicht einer zu viel sein wie ihre Rettung, denn sie war eine Frau mit üppigen weiblichen Reizen, und sie war allein. Manchmal, so hieß es, nahmen Banditen und Plünderer diese größtenteils vergessenen Wege, wenn sie sich von einer Karawanenroute zur nächsten bewegten. Und Banditen waren bekanntermaßen kleinlich.
Das Hufgetrappel näherte sich, wurde immer lauter, dann wurde der Neuankömmling langsamer, und einen Augenblick später wogte eine heiße Staubwolke über Samar Dev hinweg. Das Pferd schnaubte – es klang merkwürdig bösartig –, und dann war ein leiseres dumpfes Geräusch zu hören, als der Reiter von seinem Tier rutschte. Leise Schritte näherten sich.
Was war das? Ein Kind? Eine Frau?
Ein Schatten tauchte in ihrem Blickfeld auf, hinter dem, den der Wagen warf, und Samar Dev drehte den Kopf, sah die Gestalt an, die um den Wagen herumkam und auf sie herabblickte.
Nein, das war weder ein Kind noch ein Frau. Vielleicht, dachte sie, nicht einmal ein Mann. Eine Erscheinung, die einen zerfetzten weißen Pelzumhang um die unmöglich breiten Schultern und ein Schwert aus flockigem Feuerstein, dessen Griff mit Leder umwickelt war, auf dem Rücken trug. Sie blinzelte angestrengt, versuchte, mehr Einzelheiten zu erkennen, aber der helle Himmel hinter dem Neuankömmling machte das unmöglich. Ein Riese von einem Mann, der sich so leise wie eine Wüstenkatze bewegte, eine alptraumhafte Vision, eine Halluzination.
Und dann sprach er – aber nicht zu ihr, das war offensichtlich. »Du wirst noch ein bisschen auf deine Mahlzeit warten müssen, Havok. Die hier lebt noch.«
»Havok isst tote Frauen?«, fragte Samar mit rauer Stimme. »Mit wem reitet Ihr?«
»Nicht mit«, erwiderte der Riese. »Auf.« Er trat näher und hockte sich neben sie. Er hielt etwas in den Händen – einen Wassersack – , doch sie stellte fest, dass sie den Blick nicht von seinem Gesicht abwenden konnte. Gleichmäßige, kantige Gesichtszüge, verzerrt durch eine Tätowierung wie zerbrochenes Glas, das Zeichen eines entflohenen Sklaven. »Ich sehe deinen Wagen«, sagte er in der Sprache der Wüstenstämme, doch mit einem seltsamen Akzent. »Aber wo ist das Tier, das ihn gezogen hat?«
»Auf der Ladefläche«, antwortete sie.
Er legte den Wassersack neben ihr hin, richtete sich auf, trat an den Wagen und blickte hinein. »Da liegt ein toter Mann.«
»Ja, das ist er. Er ist zusammengebrochen.«
»Er hat diesen Wagen gezogen? Kein Wunder, dass er tot ist.«