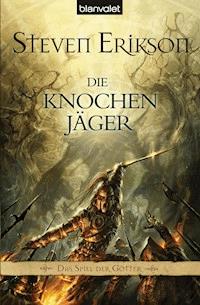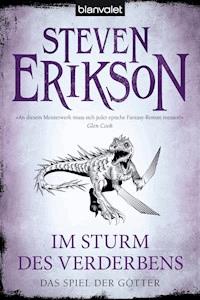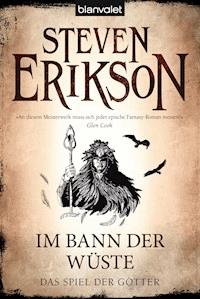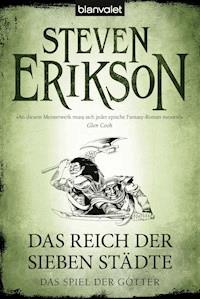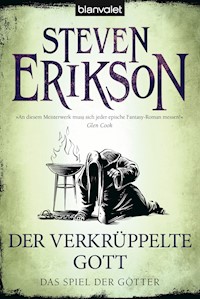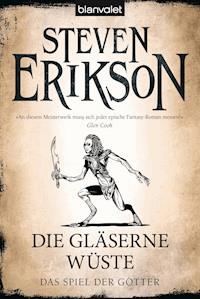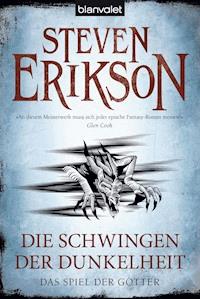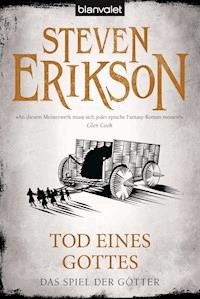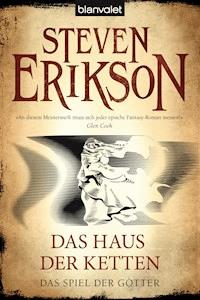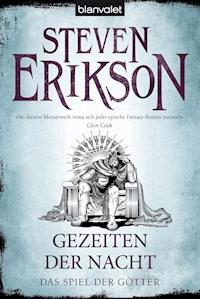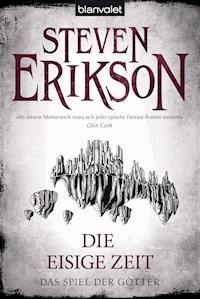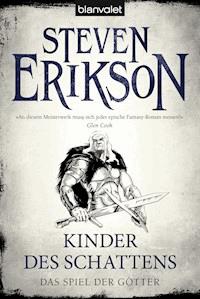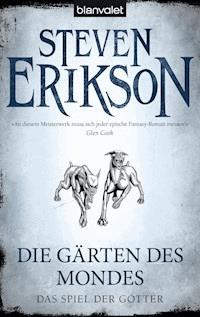
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Spiel der Götter
- Sprache: Deutsch
Das malazanische Imperium ist ein Moloch, der sich mit Hilfe seiner Magier und Soldaten unerbittlich ausbreitet. Jetzt soll die letzte freie Stadt fallen. Doch eine ominöse Macht verweigert den Truppen der Kaiserin den letzten Sieg: Über Darujhistan schwebt aus heiterem Himmel eine riesige Festung und versetzt alle Welt in helle Aufregung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1182
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Das malazanische Imperium ist ein Moloch, der sich mit Hilfe seiner Magier und Soldaten unerbittlich ausbreitet. Als Darujhistan fallen soll, die letzte Freie Stadt auf dem Kontinent Genabackis, sieht sich die malazanische Vorhut jedoch einem mysteriösen Hindernis gegenüber: Die riesige, fliegende Festung Mondbrut schwebt über der Stadt, und ihr Kommandeur Anomander Rake hat seine eigenen Ziele. Ganoes Paran, die rechte Hand der Kaiserin, soll seine Motive erkunden, doch er wird in einer Taverne erstochen. Jetzt erweist sich, dass die Götter selbst in das Spiel um die Macht eingreifen: Sie beleben Ganoes wieder und erwarten dafür eine Gegenleistung. Doch welche dies ist, bleibt dem Geretteten zunächst ein Rätsel …
Der fulminante Auftakt eines neuen großen Fantasy-Zyklus – ein sinfonisches Epos ohnegleichen.
»Steven Erikson ist ein großartiger Autor. Ich habe DIE GÄRTEN DES MONDES mit allergrößtem Vergnügen gelesen. Meine Bitte an Steven Erikson:
Schreib schneller!«
Stephen R. Donaldson
Autor
Steven Erikson wurde in Kanada geboren, lebt jedoch schon seit vielen Jahren mit seiner Familie in der Nähe von London. Der ausgebildete Anthropologe legte 1999 nach einer sechs Jahre dauernden akribischen Vorbereitungsphase seinen weltweit beachteten Debütroman »Die Gärten des Mondes« vor.
Steven Erikson
Die Gärten des Mondes
Das Spiel der Götter 1
Roman
Ins Deutsche übertragenvon Tim Straetmann
Dieser Roman ist I. C. Esslemont gewidmet – Welten zu erobern, Welten zu teilen
Nun, da die Asche kalt geworden ist, öffnen wir das alte Buch. Die ölbefleckten Seiten erzählen die Geschichte der Gefallenen und eines heruntergekommenen Imperiums – Worte ohne jede Wärme. Der Herd ist erloschen, sein Glanz und seine Lebensfunken sind nur noch Erinnerungen vor trübe gewordenen Augen – was prägt meinen Geist, was färbt meine Gedanken, wenn ich das Buch der Gefallenen öffne und tief den Geruch der Geschichte einatme?
Hört also auf diese Worte, die von jenem Atemzuge getragen werden.
Dies sind Geschichten, die von uns allen handeln, immer und immer wieder.
Wir sind wieder erlebte Geschichte, und das ist alles, das ist, für immer und ewig, alles.
Der Imperator ist tot! Wie seine rechte Hand – so kalt, so abgetrennt! Doch achtet auf die sterbenden Schatten, die vereint dahingleiten, blutig und besiegt hinab und aus dem Blick der Sterblichen … Verstoßen von der Herrschaft des Zepters, von güld’nen Kandelabern, denen das Licht entflohen, von einem Herd, den kühle Edelsteine einst umringten, dem diese Wärme sieben Jahre lang entströmte …
Der Imperator ist tot. Wie sein meisterhafter Gefährte, das Seil sauber durchtrennt. Doch achtet auf die keimende Wiederkehr – das zerrissene Leichentuch, die schwankende Dunkelheit – die im sterbenden Licht des Imperiums die Kinder umarmt. Vernehmt die furchtsam wieder aufgenomm’ne Totenklage, denn bevor an diesem Tag die Sonne untergeht wird Blutvergießen über die gewölbte Erde kommen, und in Obsidian-Augen wird siebenmal die Rache erklingen …
Die Anrufung des Schattens (I. i. 1–18)Felisin (geb. 1146)
Prolog
Das Jahr 1154 von Brands Schlaf Das Jahr 96 des Imperiums von Malaz Das letzte Jahr von Imperator Kellanveds Herrschaft
Die Rostflecken auf der schwarzen, vernarbten Oberfläche von Mocks Wetterfahne sahen aus wie aufgemalte Seen aus Blut. Ein Jahrhundert alt, hockte sie auf der Spitze einer alten Pike, die ganz am äußeren oberen Ende der Festungsmauer angebracht worden war. Monströs und missgestaltet wie sie war – kalt in die Form eines geflügelten Dämons gehämmert, dessen Zähne in einem boshaften Grinsen gebleckt waren –, wurde sie von jedem Windstoß hin und her geschüttelt und quietschte protestierend.
Es wehte ein aufsässiger Wind an diesem Tag, und Rauchsäulen stiegen über dem Mausviertel von Malaz auf. Das Kreischen der Wetterfahne verstummte für einen Augenblick und kündete damit vom Abflauen der Meeresbrise, die über die zackigen Mauern von Mocks Feste geklettert kam. Doch schon im nächsten Moment erwachte sie quietschend zu neuem Leben, als der heiße, Funken sprühende und rauchgeschwängerte Atem des Mausviertels über die Stadt wehte und über die Hänge des Vorgebirges strich.
Ganoes Stabro Paran aus dem Haus Paran stand auf Zehenspitzen, um über die Schartenbacke hinwegsehen zu können. Hinter ihm ragte Mocks Feste in die Höhe. Sie war einmal das Herz des Imperiums gewesen; inzwischen jedoch, seit das Festland erobert worden war, war sie einmal mehr zum Sitz einer Faust herabgesunken. Links von ihm befand sich die Pike mit ihrer missgestalteten Trophäe.
Ganoes kannte die uralte Festung oberhalb der Stadt viel zu gut, als dass sie ihn noch großartig interessiert hätte. Dies war sein dritter Besuch hier oben in ebenso vielen Jahren. Schon vor langer Zeit hatte er den Hof mit seinen ungleichmäßigen Pflastersteinen erkundet; das Gleiche galt für den alten Bergfried – der jetzt als Stall benutzt wurde und dessen oberes Stockwerk Tauben, Schwalben und Fledermäusen eine Heimat bot – und die Zitadelle, in der just in diesem Augenblick sein Vater mit den Hafenbeamten über den Ausfuhr-Zehnten verhandelte. Dabei kannte er die Zitadelle nicht ganz so gut, denn zu den meisten Räumen war selbst ihm als Sprössling eines Adelshauses der Zutritt verboten. Hier, im Innern der Zitadelle, hatte die Faust ihre Residenz, und hier waren auch die Räume, in denen jene Angelegenheiten des Imperiums geregelt wurden, die die Verwaltung der Insel betrafen.
Ganoes achtete nicht weiter auf Mocks Feste in seinem Rücken; er widmete seine ganze Aufmerksamkeit der zerrissenen Stadt unter sich – vor allem dem Aufruhr, der in ihren ärmsten Vierteln tobte. Mocks Feste erhob sich hoch oben auf einer Klippe und war über eine Treppe zu erreichen, die in Serpentinen in die Kalksteinwand der Klippe gehauen worden war. Von hier bis hinunter zur Stadt waren es etwa achtzig Armspannen, und rechnete man die arg mitgenommenen Wälle der Feste dazu, waren es noch einmal sechs mehr. Das Mausviertel lag in dem Teil der Stadt, der sich dem Hinterland zuwandte, es bestand aus einem ungleichmäßigen Gewirr aus Schuppen und zugewucherten Terrassen und wurde von dem schlammigen Fluss, der auf den Hafen zukroch, in zwei Teile geteilt. Da die Aufstände im weiter entfernt liegenden Teil von Malaz stattfanden und immer mehr Säulen aus schwarzem Rauch die Luft erfüllten, war es Ganoes unmöglich, irgendwelche Einzelheiten auszumachen.
Es war Mittag, aber die magischen Blitze und Donnerschläge ließen den Himmel dunkel und schwer erscheinen.
Mit klirrender Rüstung erschien ein Soldat neben ihm auf dem Wehrgang. Der Mann legte von Armschienen geschützte Unterarme auf die Brustwehr; eine Bewegung, die die Scheide seines Langschwertes an den Steinen entlangschaben ließ. »Du bist froh über dein reines Blut, was?«, fragte er, die grauen Augen auf die rauchende Stadt gerichtet.
Der Junge musterte den Soldaten. Er kannte bereits die gesamte Ausstattung sämtlicher Regimenter der Armee des Imperiums, und demnach musste der Mann an seiner Seite ein Befehlshaber der Dritten sein – einer Elitetruppe, die dem Imperator direkt unterstand. An seinem dunkelgrauen, nur bis zur Taille reichenden Umhang steckte eine silberne Brosche: eine steinerne Brücke, die von Flammen aus Rubinen beleuchtet wurde. Ein Brückenverbrenner.
Die Insel Malaz war noch immer ein wichtiger Anlaufpunkt, besonders jetzt, da der Krieg mit Korel im Süden begonnen hatte, und häufig kamen hochrangige Soldaten und imperiale Beamte in Mocks Feste vorbei. Ganoes hatte schon viele gesehen, hier oder in der Hauptstadt Unta.
»Dann stimmt es also?«, fragte er kühn.
»Dann stimmt was?«
»Das mit dem Ersten Schwert des Imperiums. Dassem Ultor. Wir haben es in der Hauptstadt gehört, bevor wir aufgebrochen sind. Er soll tot sein. Stimmt das? Ist Dassem tot?«
Der Mann schien zusammenzuzucken; sein Blick blieb unverwandt auf das Mausviertel gerichtet. »So ist der Krieg«, murmelte er fast unhörbar, als wären die Worte nicht für die Ohren eines anderen bestimmt.
»Ihr gehört zur Dritten. Ich dachte, die Dritte wäre mit ihm im Reich der Sieben Städte gewesen. Bei Y’Ghatan …«
»Beim Atem des Vermummten! Während in den schwelenden Trümmern dieser verdammten Stadt noch immer nach seiner Leiche gesucht wird, stehst du, der Sohn eines Kaufmanns, fast dreitausend Längen vom Reich der Sieben Städte entfernt, plötzlich vor mir und sprichst von Dingen, die eigentlich kaum jemand wissen dürfte.« Er wandte sich immer noch nicht zu ihm um. »Ich weiß zwar nicht, woher du das weißt, aber wenn ich dir einen guten Rat geben darf: behalte es für dich.«
Ganoes zuckte die Schultern. »Man sagt, er hat einen Gott betrogen.«
Endlich sah der Mann ihn an. Sein Gesicht war von Narben übersät, und etwas, das wie eine Verbrennung aussah, verunstaltete sein Kinn und seine linke Wange. Davon einmal abgesehen, schien er für einen Befehlshaber recht jung zu sein. »Achte auf die Lektion, die darin liegt, Junge.«
»Was für eine Lektion?«
»Jede Entscheidung, die du triffst, kann die Welt verändern. Das beste Leben ist eines, das die Götter überhaupt nicht bemerken. Wenn du ein freies Leben führen willst, Junge, dann führe ein unauffälliges Leben.«
»Ich will Soldat werden. Ein Held.«
»Das geht vorbei.«
Mocks Wetterfahne kreischte auf, als ein launischer Windstoß vom Hafen den fetten Rauch durcheinander wirbelte. Ganoes konnte jetzt verfaulten Fisch und den Gestank des dicht bevölkerten Hafenviertels riechen.
Ein zweiter Brückenverbrenner mit einer zerbrochenen, angesengten Fiedel auf dem Rücken trat zu seinem Befehlshaber. Er war drahtig und sogar noch jünger – höchstens ein paar Jahre älter als Ganoes, der erst zwölf war. Das Gesicht und die Handrücken des Neuankömmlings waren von merkwürdigen Pockennarben übersät, und seine Rüstung bestand aus einer seltsamen Mischung aus fremdartigen Ausrüstungsgegenständen, die er über einer abgetragenen, fleckigen Uniform angelegt hatte. An seiner Hüfte hing ein Kurzschwert in einer rissigen Holzscheide. Er lehnte sich mit der Leichtigkeit langjähriger Gewohnheit neben dem anderen Mann an die Schartenbacke.
»Wenn Zauberer in Panik geraten, fängt es ziemlich übel an zu stinken«, sagte der Neuankömmling. »Sie verlieren die Kontrolle da unten. Man braucht doch wohl kaum einen ganzen Kader von Magiern, nur um ein paar Wachshexen aufzuspüren!«
Der Kommandant seufzte. »Ich dachte, ich warte erst mal ab, ob sie sich zügeln können.«
Der Soldat grunzte. »Die sind alle neu und unerfahren. Bei einigen könnte das bleibende Spuren hinterlassen. Außerdem«, fügte er hinzu, »gibt es da unten mehr als nur ein paar, die den Befehlen anderer folgen.«
»Das ist nur eine Vermutung.«
»Der Beweis liegt da unten«, sagte der andere Mann, »im Mausviertel.«
»Vielleicht.«
»Du bist zu vorsichtig«, sagte der Mann. »Hadra hält das für deine größte Schwäche.«
»Was Hadra macht, interessiert mich nicht. Die geht nur den Imperator was an.«
Ein zweites Grunzen war die Antwort. »Oder über kurz oder lang uns alle.«
Der Kommandant schwieg, drehte sich jedoch langsam um und musterte seinen Gefährten.
Der Mann zuckte die Schultern. »Ist nur so ein Gefühl … Sie hat einen neuen Namen angenommen: Laseen.«
»Laseen?«
»Ein napanesisches Wort, es bedeutet …«
»Ich weiß, was es bedeutet.«
»Ich hoffe, der Imperator weiß es auch …«
»Es bedeutet Thronmeister«, sagte Ganoes.
Die beiden Männer blickten auf ihn herab.
Der Wind drehte erneut, ließ den eisernen Dämon auf seiner Pike ächzen und trug den Geruch von kühlem Stein von der Feste heran. »Mein Lehrer ist Napanese«, erklärte Ganoes.
Eine neue Stimme erklang hinter ihnen, die kalte, gebieterische Stimme einer Frau. »Kommandant.«
Die beiden Soldaten drehten sich ohne allzu große Hast um. »Die neue Kompanie da unten braucht Hilfe«, sagte der Kommandant zu seinem Gefährten. »Schick Dujek und einen Trupp hin und sorge dafür, dass sich ein paar Sappeure um die Feuer kümmern – es bringt nichts, wenn die ganze Stadt abbrennt.«
Der Soldat nickte und marschierte davon, ohne der Frau einen einzigen Blick zuzuwerfen.
Sie stand mit zwei Leibwächtern nahe beim Eingangstor zum quadratischen Turm der Zitadelle. Ihrer dunkelblauen Haut nach war sie Napanesin, doch ansonsten wirkte sie unscheinbar. Sie trug eine mit Salzwasserspritzern übersäte graue Robe, das mausgraue Haar war kurz geschnitten wie das eines Soldaten, und ihre Gesichtszüge waren fein und unauffällig. Ihre Leibwächter hingegen ließen Ganoes einen Schauer den Rücken hinunterlaufen. Sie flankierten sie – hoch gewachsen, ganz in Schwarz gehüllt, die Hände in den Ärmeln, die Gesichter tief im Schatten der Kapuzen verborgen. Ganoes hatte niemals zuvor Klauen gesehen, doch er wusste instinktiv, dass dies zwei Akolythen des Kults waren. Was bedeutete, dass die Frau …
»Diese Schweinerei habt Ihr angerichtet, Hadra. Aber es sieht so aus, als ob ich sie in Ordnung bringen müsste«, sagte der Kommandant.
Ganoes war schockiert darüber, dass nicht das geringste Anzeichen von Furcht in der Stimme des Soldaten mitschwang, stattdessen sogar etwas wie Verachtung. Hadra hatte die Klaue geschaffen, hatte die Organisation zu einer Macht geformt, die fast der des Imperators gleichkam.
»Das ist nicht mehr mein Name, Kommandant.«
Der Mann verzog das Gesicht. »Das habe ich gehört. Ihr müsst Euch in Abwesenheit des Imperators sehr sicher fühlen. Er ist nicht der Einzige, der sich daran erinnert, dass Ihr einst ein Dienstmädchen im Alten Viertel wart. Ich nehme an, die Zeit der Dankbarkeit ist vorüber.«
Das Gesicht der Frau blieb völlig unbewegt; sie ließ sich nicht im Geringsten anmerken, ob die Worte des Mannes sie getroffen hatten. »Der Befehl war eigentlich ziemlich einfach«, sagte sie. »Aber es sieht so aus, als hätten Eure neuen Offiziere Schwierigkeiten, ihn auszuführen.«
»Die Sache ist aus dem Ruder gelaufen«, sagte der Kommandant. »Sie sind unerfahren …«
»Das ist nicht mein Problem«, schnappte sie. »Aber ich bin gar nicht besonders enttäuscht. Dass Eure Offiziere die Kontrolle verloren haben, wird allen, die sich uns entgegenstellen, nur eine umso härtere Lehre sein.«
»Die sich Euch entgegenstellen? Ihr sprecht von einer Hand voll zweitklassiger Hexen, die ihre mickrigen Künste feilbieten – und mit welch finsteren Zielen! Sie wollten doch nur die Coraval-Schwärme in den Untiefen der Bucht finden. Beim Atem des Vermummten, Hadra, das ist wohl kaum eine Bedrohung für das Imperium.«
»Sie haben es unerlaubt getan, den neuen Gesetzen zum Trotz …«
»Euren Gesetzen zum Trotz, Hadra. Und diese Gesetze werden sich nicht durchsetzen lassen. Wenn der Imperator zurückkehrt, wird er Euer Verbot der Zauberei beiseite fegen, dessen könnt Ihr sicher sein.«
Die Frau lächelte kalt. »Und Ihr werdet erfreut sein zu erfahren, dass der Turm die Ankunft der Transportschiffe für Eure neuen Rekruten gemeldet hat. Wir werden Euch und Eure unruhigen, aufrührerischen Soldaten wohl kaum vermissen, Kommandant.«
Ohne ein weiteres Wort – und ohne den Jungen, der neben dem Mann stand, auch nur eines einzigen Blickes zu würdigen – drehte sie sich um und verschwand mit ihren schweigsamen Leibwächtern wieder in der Zitadelle.
Ganoes und der Kommandant richteten ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Aufruhr im Mausviertel. Zwischen den Rauchschwaden loderten immer wieder Flammen auf.
»Eines Tages werde ich Soldat sein«, sagte Ganoes.
Der Mann grunzte. »Nur wenn du in allem anderen versagst, Junge. Das Schwert zu ergreifen ist die letzte Tat eines Verlierers. Vergiss das nie, und such dir einen besseren Traum.«
Ganoes warf ihm einen finsteren Blick zu. »Ihr seid anders als die anderen Soldaten, mit denen ich gesprochen habe. Ihr klingt mehr wie mein Vater.«
»Aber ich bin nicht dein Vater«, brummte der Mann.
»Die Welt«, sagte Ganoes, »hat aber schon genug Weinhändler.«
Der Kommandant musterte Ganoes aus zusammengekniffenen Augen. Er öffnete schon den Mund zur offensichtlichen Entgegnung – und klappte ihn wieder zu.
Zufrieden mit sich sah Ganoes wieder hinab auf das brennende Stadtviertel. Manchmal kann auch ein Junge das letzte Wort haben, Kommandant.
Erstes Buch
Fahl
… Im achten Jahr schlossen die Freien Städte von Genabackis Verträge mit einer Reihe von Söldnerheeren, um das Vordringen des Imperiums zu verhindern; einige davon waren recht berühmt etwa die Karmesin-Garde unter Führung von Fürst K’azz D’Avore (siehe Band III und V), oder die Regimenter der Tiste Andii von Mondbrut unter dem Kommando von Caladan Bruth.
Die Streitkräfte des malazanischen Imperiums, die von Hohefaust Dujek Einarm befehligt wurden, bestanden in jenem Jahr aus der Zweiten, der Fünften und der Sechsten Armee sowie einigen Legionen der Moranth.
Im Rückblick lassen sich zwei Dinge feststellen. Zum einen, dass das Bündnis mit den Moranth aus dem Jahr 1156 eine grundlegende Änderung in der Wissenschaft der Kriegsführung kennzeichnete, die sich kurzfristig als sehr effektiv erweisen sollte. Zum anderen markiert die Einmischung der magiekundigen Tiste Andii von Mondbrut den Beginn des Magie-Flankenfeuers auf diesem Kontinent, und zwar mit verheerenden Folgen.
Im Jahr 1163 von Brands Schlaf endete die Belagerung von Fahl mit einer mittlerweile legendären magischen Feuersbrunst …
Imperiale Feldzüge 1158–1194Band IV, Genabackis
Kapitel Eins
Die alten Steine dieser Straße erzitterten beim Klang der Trommeln und der eisernen schwarzen Hufeisen wo ich ihn habe gehen sehen vom Meer herauf und zwischen morgenroten Hügeln hindurch war er gekommen, ein Junge, der die Echos der Söhne und Brüder – alle in den Reihen geisterhafter Krieger – passierte, wo ich am Ende des Tages auf dem abgewetzten letzten Meilenstein saß – sein Schritt auf der steinernen Straße kündete laut von all dem, was ich von ihm wissen wollte – der Junge geht weiter, ein andrer Soldat, ein andres strahlendes Herz, das noch nicht erstarrt zu kaltem Eisen ist.
Klagelied einer Mutter (anonym)
Das Jahr 1161 von Brands Schlaf Das Jahr 103 des Imperiums von Malaz Das Jahr 7 der Herrschaft von Imperatrix Laseen
Zerren und stoßen«, sagte die alte Frau, »so macht es die Imperatrix, genau wie die Götter.« Sie beugte sich zur Seite und spuckte aus, führte dann ein schmutziges Tuch an ihre runzligen Lippen. »Drei Ehemänner und zwei Söhne hab ich in den Krieg ziehen sehen.«
Mit glänzenden Augen verfolgte das Fischermädchen, wie die Kolonne berittener Soldaten vorbeidonnerte; sie hörte nur halb auf das, was die Alte neben ihr sagte. Ihre Atemzüge passten sich dem Rhythmus an, in dem die prächtigen Pferde vorbeistampften. Sie spürte, wie ihr Gesicht heiß wurde, und sie wusste, dass das nichts mit der Hitze zu tun hatte. Der Tag neigte sich dem Ende entgegen, und die Sonne war nur noch ein verwaschener roter Fleck über den Bäumen zu ihrer Rechten. Die Meeresbrise, die ihr entgegenwehte, war kühl geworden.
»Das war zur Zeit des Imperators«, fuhr die alte Vettel fort. »Möge der Vermummte die Seele des elenden Bastards am Spieß rösten. Aber sieh mal, Schätzchen, Laseen verstreut Knochen in alle Winde. Hah, immerhin hat sie mit seinen angefangen, was?«
Das Fischermädchen nickte schwach. Wie es sich für die Niedriggeborenen schickte, warteten sie am Straßenrand – die alte Frau mit einem Sack Rüben beladen, während das Mädchen einen schweren Korb auf dem Kopf balancierte. Etwa jede Minute wechselte die Alte den groben Sack von einer knochigen Schulter auf die andere. Eingekeilt zwischen den Reitern vor ihnen und einem Graben, der hinter ihnen steil zu den Felsen abfiel, hatte sie keinen Platz, den Sack abzusetzen.
»Sie verstreut Knochen, hab ich gesagt. Die Knochen von Ehemännern, die Knochen von Söhnen, die Knochen von Frauen und die Knochen von Töchtern. Für sie sind sie alle gleich. Für das Imperium sind sie alle gleich.« Die alte Frau spuckte ein zweites Mal aus. »Drei Ehemänner und zwei Söhne. Pro Kopf zehn Münzen im Jahr. Fünf mal zehn macht fünfzig. Fünfzig Münzen im Jahr, und dafür immer allein. Im Winter allein und im Bett allein.«
Das Fischermädchen wischte sich den Staub von der Stirn. Der Blick aus ihren hellen Augen huschte von einem Soldaten zum anderen, während sie vor ihr vorbeizogen. Die jungen Männer in ihren hochgezogenen Sätteln hatten ernste Gesichter und blickten ungerührt nach vorn. Die wenigen Frauen, die sich zwischen ihnen befanden, waren groß und wirkten irgendwie wilder als die Männer. Der Sonnenuntergang ließ die Helme rot aufblitzen, so dass die Augen des Mädchens zu brennen begannen und alles vor ihrem Blick verschwamm.
»Du bist die Tochter des Fischers«, sagte die alte Frau. »Ich hab dich schon öfter gesehen, auf der Straße oder unten am Strand. Und zusammen mit deinem Vater auf dem Markt. Er hat nur noch einen Arm, stimmt’s? Noch mehr Knochen für ihre Sammlung, was?« Sie machte eine hackende Bewegung mit einer Hand und nickte. »Ich wohne in dem ersten Haus, da vorn am Weg. Von den Münzen kauf ich mir Kerzen. Jede Nacht zünde ich fünf Kerzen an – fünf Kerzen, damit die alte Rigga nicht so allein ist. Es ist ein müdes altes Haus, Schätzchen, voll mit müden alten Sachen. Ich gehör auch dazu. Was hast du da in deinem Korb?«
Nur allmählich begriff das Fischermädchen, dass ihr eine Frage gestellt worden war. Sie wandte ihren Blick von den Soldaten ab und lächelte auf die alte Frau hinunter. »Es tut mir Leid«, sagte sie, »die Pferde sind so laut.«
»Ich hab dich gefragt, was du in deinem Korb hast, Schätzchen«, wiederholte Rigga ihre Frage diesmal lauter.
»Garn. Genug für drei Netze. Eins müssen wir bis morgen fertigkriegen. Papa hat das Letzte verloren – irgendwas im Wasser hat es mit dem ganzen Fang in die Tiefe gezogen. Ilgrand Lender will das Geld zurückhaben, das er uns geliehen hat, deshalb müssen wir morgen unbedingt einen Fang machen. Einen guten Fang.« Sie lächelte erneut und ließ ihren Blick wieder zu den Soldaten wandern. »Ist das nicht wunderbar?«
Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte Rigga das Mädchen an den dichten schwarzen Haaren gepackt und zerrte kräftig daran.
Das Mädchen schrie auf. Der Korb auf ihrem Kopf begann zu wackeln, rutschte auf eine Schulter hinab. Sie griff hastig danach, doch er war zu schwer. Der Korb fiel zu Boden und brach auseinander. »Aah!«, japste das Mädchen und versuchte sich hinzuknien. Aber Rigga riss sie an den Haaren zu sich herum.
»Du hörst mir jetzt mal zu, Schätzchen!« Der saure Atem der alten Frau schlug dem Mädchen ins Gesicht. »Das Imperium unterdrückt dieses Land jetzt schon seit hundert Jahren. Du bist in dieser Zeit geboren worden, ich nicht. Als ich in deinem Alter war, ist Itko Kan noch ein eigenes Land gewesen. Wir haben eine Flagge gehabt – unsere eigene Flagge. Wir sind frei gewesen, Schätzchen.«
Dem Mädchen wurde schlecht von Riggas Atem. Sie kniff die Augen zu.
»Das ist die Wahrheit. Vergiss das nie, sonst wird dich der Schein der Lügen für immer blenden.« Riggas Stimme hatte einen leiernden Tonfall angenommen, und augenblicklich erstarrte das Mädchen. Rigga. Riggalai, die Seherin. Die Wachshexe, die Seelen in Kerzen schloss und verbrannte. Seelen, die von Flammen verzehrt wurden Riggas Worte klangen wie eine Prophezeiung und ließen das Mädchen frösteln. »Vergiss das nie. Ich bin die Letzte, die zu dir spricht. Du bist die Letzte, die mich hört. So sind wir verbunden, du und ich, was auch immer geschieht.«
Riggas Finger krallten sich fester in das Haar des Mädchens. »Jenseits des Meeres hat die Imperatrix ihr Messer in jungfräulichen Boden getrieben. Bald wird es eine Flut aus Blut geben, und du wirst mitgerissen werden und ertrinken, wenn du nicht vorsichtig bist. Sie werden dir ein schönes Pferd geben, dir ein Schwert in die Hand drücken und dich übers Meer schicken. Aber deine Seele wird von einem Schatten umarmt werden. Hör zu! Du musst dies tief in deinem Innern vergraben! Rigga wird dich schützen, denn wir zwei sind verbunden. Aber mehr kann ich nicht tun, verstehst du? Achte auf den Lord, den die Dunkelheit hervorgebracht hat, denn es ist seine Hand, die dich befreien wird, auch wenn er es nicht weiß …«
»Was ist da los?«, bellte eine Stimme.
Rigga wandte ihr Gesicht der Straße zu. Ein Vorreiter hatte sein Pferd gezügelt. Die Seherin ließ die Haare des Mädchens los.
Das Mädchen stolperte einen Schritt zurück. Sie rutschte auf einem Stein aus und fiel hin. Als sie wieder aufsah, war der Vorreiter bereits weitergeritten. Ein anderer donnerte heran.
»Lass die hübsche Kleine in Ruhe, alte Hexe«, knurrte er. Er kam noch näher heran, lehnte sich aus dem Sattel und holte mit der flachen Hand aus. Der eisenbeschlagene Handschuh krachte gegen Riggas Kopf, und die Wucht des Schlages riss sie herum. Sie stürzte. Das Fischermädchen schrie auf, als Rigga hart auf ihren Oberschenkeln landete. Blut und Speichel spritzten ihr ins Gesicht. Wimmernd wich das Mädchen über das Geröll zurück, schob die alte Frau dann mit den Füßen von sich. Sie kniete sich hin.
Irgendetwas von Riggas Prophezeiung schien sich im Kopf des Mädchens festgesetzt zu haben, schwer wie ein Stein und im Dunkel verborgen. Sie stellte fest, dass sie kein einziges Wort von dem, was die Seherin gesagt hatte, wiederholen konnte. Sie streckte sich und griff nach Riggas Wollschal. Vorsichtig drehte sie die alte Frau auf den Rücken. Eine Seite von Riggas Kopf war blutverschmiert; die rote Flüssigkeit rann jetzt hinter ihrem Ohr hinunter. Auch ihr faltiges Kinn war voller Blut, genau wie ihr Mund. Ihre Augen starrten blicklos ins Leere.
Das Fischermädchen wich zurück; sie bekam keine Luft mehr. Verzweifelt blickte sie sich um. Die Kolonne war vorbeigezogen, hatte nichts als Staub und leiser werdendes Hufgetrappel zurückgelassen. Riggas Sack war auf die Straße gerollt. Zwischen den zertrampelten Rüben lagen fünf Talgkerzen. Das Mädchen atmete tief die staubige Luft ein. Dann wischte sie sich die Nase ab und sah dabei hinunter auf ihren Korb.
»Vergiss die Kerzen«, murmelte sie mit schwerer, eigenartiger Stimme. »Sie sind sowieso hin. Verstreut wie die Knochen. Was soll’s.« Sie kroch auf die Garnknäuel zu, die aus dem zerbrochenen Korb gefallen waren, und als sie dann wieder sprach, klang ihre Stimme jung und normal. »Wir brauchen das Garn. Wir werden die ganze Nacht arbeiten und ein Netz knüpfen. Papa wartet auf mich. Er steht schon an der Tür und schaut, ob er mich sehen kann.«
Sie verstummte. Ein Schaudern durchlief ihren Körper. Das Sonnenlicht war fast völlig verschwunden. Eine für diese Jahreszeit ungewöhnliche Kälte entströmte den Schatten, die jetzt wie Wasser über die Straße flossen.
»Jetzt ist es also so weit«, sagte das Mädchen leise und krächzend mit einer Stimme, die nicht ihre eigene war.
Eine weich behandschuhte Hand legte sich auf ihre Schulter. Sie duckte sich, kauerte sich hin.
»Ruhig, Mädchen«, sagte die Stimme eines Mannes. »Es ist vorbei. Für sie kann man nichts mehr tun.«
Das Fischermädchen blickte auf. Ein Mann ganz in Schwarz beugte sich über sie; sein Gesicht lag im Schatten seiner Kapuze. »Aber er hat sie geschlagen«, sagte das Mädchen mit dünner Kinderstimme. »Und wir müssen Netze knüpfen, Papa und ich …«
»Komm, ich helfe dir hoch«, sagte der Mann und schob seine langfingrigen Hände unter ihre Arme. Er richtete sich auf und hob sie ohne jede Anstrengung hoch. Ihre Füße in den alten Sandalen baumelten einen Augenblick in der Luft, bevor er sie absetzte.
Nun erblickte sie einen zweiten Mann. Er war kleiner und ebenfalls ganz in Schwarz gekleidet. Dieser Mann stand auf der Straße, und seine Aufmerksamkeit galt anderen Dingen; er blickte in die Richtung, in die die Soldaten verschwunden waren. Als er sprach, klang seine Stimme dünn. »Kein besonders tolles Leben«, sagte er, ohne herüberzublicken. »Sie hatte nur eine geringe Begabung, noch dazu eine, die schon lange vertrocknet war … Oh, eine mehr hätte sie womöglich noch geschafft, aber das werden wir niemals erfahren …«
Das Fischermädchen stolperte zu Riggas Sack hinüber und hob eine Kerze auf. Sie reckte sich, und ihre Augen wirkten plötzlich hart. Dann spuckte sie nachdenklich auf die Straße.
Der Kopf des kleineren Mannes fuhr zu ihr herum. Es sah aus, als würden sich unter seiner Kapuze nichts als Schatten verbergen.
Das Mädchen wich einen Schritt zurück. »Es ist ein gutes Leben gewesen«, flüsterte sie. »Sie hatte diese Kerzen, wisst Ihr. Fünf Stück. Fünf Kerzen für …«
»Nekromantie«, warf der kleinere Mann ein.
Der größere Mann, der noch immer neben ihr stand, sagte sanft: »Ich sehe sie, Kind. Und ich weiß, was sie bedeuten.«
Der andere Mann schnaubte. »Die Hexe hat fünf zerbrechliche, schwache Seelen beherbergt. Nichts Bemerkenswertes.« Er legte den Kopf ein wenig schief. »Ich kann sie hören. Sie rufen nach ihr.«
Dem Mädchen traten die Tränen in die Augen. Eine wortlose Qual schien von dem schwarzen Stein in ihrem Geist aufzusteigen. Sie wischte sich die Wangen ab. »Wo kommt Ihr her?«, fragte sie unvermittelt. »Wir haben Euch auf der Straße gar nicht gesehen.«
Der Mann neben ihr drehte sich halb zu der Schotterpiste um. »Wir waren auf der anderen Seite«, sagte er, und in seiner Stimme schwang so etwas wie Erheiterung mit. »Wir haben gewartet, genau wie ihr.«
Der andere kicherte. »Auf der anderen Seite, in der Tat.« Er sah die Straße entlang und hob die Arme.
Das Mädchen sog scharf die Luft ein, als es plötzlich dunkel wurde. Ein lautes Geräusch – als würde etwas zerreißen – erfüllte für eine Sekunde die Luft, dann löste sich die Dunkelheit auf. Die Augen des Mädchens weiteten sich.
Sieben gewaltige Hunde saßen um den Mann auf der Straße herum. Die Augen der Tiere leuchteten gelb, und alle blickten in die gleiche Richtung wie der Mann.
Sie hörte ihn zischen: »Gierig, was? Dann los!«
Lautlos hetzten die Hunde die Straße entlang.
Ihr Herr drehte sich um und sagte zu dem Mann neben ihr: »Das wird Laseen ein bisschen was zu knabbern geben.« Er kicherte erneut.
»Musst du die Dinge unbedingt komplizierter machen?«, fragte der andere müde.
Der kleine Mann versteifte sich. »Sie sind in Sichtweite der Kolonne.« Er legte den Kopf schief. Ein Stück weiter vorn auf der Straße erklang schrilles Gewieher entsetzter Pferde. Er seufzte. »Bist du zu einem Entschluss gekommen, Cotillion?«
Der andere grunzte amüsiert. »Da du mich mit meinem Namen angesprochen hast, Ammanas, hast du ja wohl gerade die Entscheidung für mich gefällt. Jetzt können wir sie wohl kaum noch hier lassen, oder?«
»Natürlich können wir das, alter Freund … sie darf nur nicht mehr atmen.«
Cotillion blickte auf das Mädchen hinunter. »Nein«, sagte er ruhig. »Es wird schon gehen.«
Das Fischermädchen biss sich auf die Lippe. Immer noch Riggas Kerze umklammernd, machte sie einen Schritt zurück. Ihre Blicke huschten von einem Mann zum anderen.
»Schade«, sagte Ammanas.
Cotillion nickte leicht, dann räusperte er sich. »Es wird einige Zeit dauern.«
»Haben wir die denn?«, wollte Ammanas mit einem amüsierten Unterton wissen. »Zur wahren Rache gehört das langsame, vorsichtige Anschleichen an das Opfer. Hast du die Qualen vergessen, die Laseen uns bereitet hat? Sie steht schon mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht wird sie stürzen, ohne dass wir etwas dazu beitragen. Wo läge dann die Befriedigung?«
Cotillions Antwort war kühl und trocken. »Du hast die Imperatrix schon immer unterschätzt. Deshalb sind wir jetzt auch in dieser Lage … Nein.« Er deutete auf das Fischermädchen. »Wir brauchen sie. Laseen hat sich den Zorn von Mondbrut zugezogen, und das ist so ziemlich das größte Hornissennest, das es jemals gegeben hat. Der Zeitpunkt ist perfekt.«
Ganz schwach drangen zwischen dem angsterfüllten Gewieher der Pferde nun auch die Schreie von Männern und Frauen an das Ohr des Mädchens; die Geräusche schnitten ihr tief ins Herz. Ihre Blicke huschten zum Straßenrand, wo die leblose Gestalt von Rigga lag, und dann zurück zu Ammanas, der langsam auf sie zukam. Sie wollte fortlaufen, doch ihre Knie waren weich und zitterten. Er trat ganz nah an sie heran und schien sie sorgfältig zu mustern, obwohl die Schatten unter seiner Kapuze undurchdringlich blieben.
»Du bist ein Fischermädchen?« Die Frage klang freundlich.
Sie nickte.
»Hast du einen Namen?«
»Das reicht!«, knurrte Cotillion. »Sie ist keine Maus, mit der du spielen kannst, Ammanas. Außerdem habe ich sie ausgewählt, und daher werde ich auch ihren Namen bestimmen.«
Ammanas wich einen Schritt zurück. »Schade«, sagte er noch einmal.
Das Mädchen hob flehend die Hände. »Bitte«, bettelte sie, an Cotillion gewandt, »ich habe nichts getan! Mein Vater ist ein armer Mann, aber er wird Euch alles geben, was er hat. Er braucht mich, und das Garn … er wartet bestimmt schon auf mich!« Sie spürte, dass sie sich nass gemacht hatte, und setzte sich schnell auf den Boden. »Ich habe nichts getan!« Scham stieg in ihr auf, und sie legte die Hände in den Schoß. »Bitte.«
»Mir bleibt keine andere Wahl, mein Kind«, sagte Cotillion. »Du kennst jetzt unsere Namen.«
»Ich habe sie noch nie gehört«, schluchzte das Mädchen.
Der Mann seufzte. »In Anbetracht dessen, was gerade da vorn auf der Straße passiert, wird man dich ausfragen, Kind. Und zwar auf sehr unerfreuliche Weise. Es gibt nämlich Leute, die unsere Namen kennen.«
»Du musst wissen, Schätzchen«, fügte Ammanas hinzu und bemühte sich, ein Kichern zu unterdrücken, »dass wir eigentlich gar nicht hier sein sollten. Es gibt Namen – und es gibt Namen.« Er drehte sich zu Cotillion um und sagte mit kalter Stimme: »Wir müssen uns um ihren Vater kümmern. Mit meinen Hunden?«
»Nein«, sagte Cotillion, »er soll am Leben bleiben.«
»Wie dann?«
»Ich vermute, Gier wird ausreichen«, sagte Cotillion, »wenn erst einmal reiner Tisch gemacht ist.« Die folgenden Worte troffen vor Sarkasmus. »Ich bin sicher, du kannst den magischen Teil in dieser Angelegenheit übernehmen, oder?«
Ammanas kicherte. »Hütet euch vor den Schatten, auch wenn sie Geschenke bringen.«
Cotillion wandte sich wieder dem Mädchen zu. Er streckte die Arme zur Seite aus. Die Schatten, die seine Gesichtszüge in Dunkelheit hüllten, wogten nun um seinen ganzen Körper.
Ammanas sprach wieder. Dem Mädchen schien es, als würden seine Worte von ganz weit her zu ihr dringen. »Sie ist ideal. Die Imperatrix wird niemals ihre Spur finden, sie kann allenfalls einen Verdacht hegen.« Er hob die Stimme. »Es ist nicht das Schlechteste, Schätzchen, die Schachfigur eines Gottes zu sein.«
»Zerren und stoßen«, sagte das Mädchen schnell.
Cotillion zögerte angesichts ihrer eigenartigen Bemerkung einen Moment, dann zuckte er die Schultern. Die Schatten wirbelten auf und umschlossen das Mädchen. Bei ihrer kalten Berührung stürzte ihr Geist in die Dunkelheit. Das Letzte, was sie flüchtig wahrnahm, war das weiche Wachs der Kerze in ihrer rechten Hand und wie es zwischen den Fingern ihrer geballten Faust hervorzuquellen schien.
Der Hauptmann verlagerte sein Gewicht im Sattel und warf der Frau, die an seiner Seite ritt, einen Blick zu. »Wir haben die Straße in beiden Richtungen gesperrt, Mandata, und alle Reisenden weiter ins Inland umgeleitet. Bis jetzt ist noch nichts durchgesickert.« Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und zuckte zusammen. Die Wollkappe unter seinem Helm hatte ihm die Haut aufgescheuert.
»Ist irgendetwas nicht in Ordnung, Hauptmann?«
Er schüttelte den Kopf, blickte aus zusammengekniffenen Augen die Straße entlang. »Der Helm sitzt locker. Als ich ihn das letzte Mal getragen habe, hatte ich noch mehr Haare.«
Die Mandata der Imperatrix antwortete nicht.
Die Morgensonne tauchte die weiße, staubige Straße in beinahe blendendes Licht. Der Hauptmann spürte, wie ihm überall am Körper der Schweiß hinunterlief, und der gepanzerte Nackenschutz seines Helms scheuerte immer wieder über die Haare in seinem Nacken. Schon jetzt tat ihm das Kreuz weh. Es war Jahre her, seit er das letzte Mal auf einem Pferd gesessen hatte, und er gewöhnte sich nur langsam wieder daran. Bei jedem Stoß des Sattels spürte er seine Rückenwirbel knirschen.
Es war lange her, dass er sich allein auf Grund des Titels einer Person aufgerichtet hatte. Aber dies war die Mandata der Imperatrix, Laseens persönliche Dienerin, eine Verkörperung ihres imperialen Willens. Das Letzte, was der Hauptmann wollte, war, dass diese gefährliche junge Frau etwas von seinem Elend mitbekam.
Ein Stück weiter vorn begann die Straße sich in Serpentinen den Hügel hinaufzuwinden. Von links kam ein Wind, der nach Meer roch und durch die knospenden Bäume pfiff, die diese Seite der Straße säumten. Am Nachmittag würde dieser Wind so heiß sein, als käme er direkt aus dem Ofen eines Bäckers, und den Gestank der Schlammlöcher mitbringen. Und noch ganz andere Dinge … Der Hauptmann hoffte, zu diesem Zeitpunkt wieder in Kan zu sein.
Er versuchte, nicht an den Ort zu denken, dem sie entgegenritten. Sollte das doch die Mandata tun. In den Jahren, die er nun schon im Dienst des Imperiums stand, hatte er genug gesehen, um zu wissen, wann es am besten war, sich rauszuhalten. Dies war ein solcher Augenblick.
»Ihr seid hier schon lange stationiert, nicht wahr, Hauptmann?« fragte die Mandata.
»Hmm.«
Sie wartete einen Augenblick, dann bohrte sie nach. »Wie lange?«
Er zögerte. »Dreizehn Jahre, Mandata.«
»Dann habt Ihr schon unter dem Imperator gekämpft«, sagte sie.
»Hmm.«
»Und die Säuberungen überlebt.«
Der Hauptmann starrte sie an. Falls sie seine Blicke spürte, so zeigte sie es jedenfalls nicht. Ihre Augen blieben auf die Straße gerichtet. Sie saß locker im Sattel, das Langschwert unter ihrem linken Arm – griffbereit für einen Kampf zu Pferd. Ihr Haar war entweder kurz geschnitten oder sie hatte es unter ihrem Helm hochgebunden. Wahrscheinlich war sie sehr geschmeidig, vermutete der Hauptmann.
»Seid Ihr fertig?«, fragte sie. »Ich habe gerade von den Säuberungen gesprochen, die auf Veranlassung von Imperatrix Laseen nach dem vorzeitigen Tod ihres Vorgängers stattgefunden haben.«
Der Hauptmann biss die Zähne zusammen und senkte das Kinn, um den Helmriemen zu lösen. Er hatte keine Zeit gehabt, sich zu rasieren, und die Schnalle scheuerte. »Es wurden nicht alle getötet, Mandata. Die Menschen von Itko Kan sind nicht besonders reizbar. Es hat hier weder Aufstände noch Massenhinrichtungen wie in anderen Teilen des Imperiums gegeben. Wir haben alle einfach nur stillgehalten und abgewartet.«
»Ihr seid kein Adliger, nehme ich an, Hauptmann?«, meinte die Mandata mit einem dünnen Lächeln.
Er grunzte. »Wenn ich von Adel wäre, hätte ich nicht überlebt, nicht einmal hier in Itko Kan. Das wissen wir doch beide. Ihre Befehle waren sehr präzise, und nicht einmal die komischen Kanesen hätten es gewagt, sich der Imperatrix zu widersetzen.« Er machte ein finsteres Gesicht. »Nein, ich habe mich hochgedient, Mandata.«
»Wo wart Ihr zuletzt stationiert?«
»In der wickanischen Ebene.«
Sie ritten einige Zeit schweigend weiter, passierten hin und wieder Soldaten, die entlang der Straße postiert waren. Zu ihrer Linken machten die Bäume zerzaustem Heidekraut Platz und gaben den Blick auf die schaumgekrönte Weite der See frei. »Das Gelände, das Ihr abgeriegelt habt – wie viele Eurer Leute habt Ihr eingesetzt, um darauf zu patrouillieren?«, ergriff die Mandata wieder das Wort.
»Elfhundert«, erwiderte der Hauptmann.
Sie drehte sich zu ihm um; ihre kühl blickenden Augen unter dem Helmrand verengten sich leicht.
Der Hauptmann studierte ihren Gesichtsausdruck. »Das Gemetzel erstreckt sich eine halbe Länge vom Meer und eine Viertellänge landeinwärts, Mandata.«
Die Frau sagte nichts.
Sie näherten sich der Hügelkuppe. Eine größere Anzahl Soldaten hatte sich dort oben versammelt, und andere warteten entlang des Hangs. Alle hatten sich umgedreht, um zu ihnen herüberzusehen.
»Seid bereit, Mandata.«
Die Frau musterte die Gesichter am Straßenrand. Sie wusste, dass dies harte Männer und Frauen waren, Veteranen der Belagerung von Li Heng und der Wickan-Kriege auf den Ebenen im Norden. Aber hier waren sie auf etwas gestoßen, das sie angeschlagen und verletzlich gemacht hatte. In ihren Augen stand eine Sehnsucht, die die Mandata beunruhigend fand – als hungerten sie nach Antworten. Sie unterdrückte den Drang, ihnen etwas zu sagen, als sie vorbeiritt, irgendwelche tröstenden Worte zu sprechen. Wie auch immer – es war nicht ihre Art, solche Gaben zu verteilen, war es nie gewesen. In dieser Beziehung ähnelte sie der Imperatrix sehr.
Von jenseits der Hügelkuppe drangen die Schreie von Möwen und Krähen an ihr Ohr, Geräusche, die sich zu einem schrillen Lärm steigerten, als sie die Hügelkuppe erreichten. Ohne die Soldaten links und rechts der Straße zu beachten, trieb die Mandata ihr Pferd vorwärts. Der Hauptmann blieb dicht hinter ihr. Sie kamen zum Kamm und machten Halt. Die Straße führte hier vielleicht eine Fünftellänge abwärts und stieg erst in der Ferne wieder zu einem Vorgebirge auf.
Tausende von Möwen und Krähen bedeckten den Boden, bevölkerten die Bewässerungsgräben oder hockten im niedrigen, struppigen Heidekraut und Stechginster. Unter diesem sich ständig bewegenden Meer von schwarzen und weißen Vogelleibern war der Boden gleichmäßig rot. Hier und dort ragten die halb skelettierten Kadaver von Pferden aus dem Durcheinander, und zwischen den kreischenden Vögeln blitzte Eisen auf.
Der Hauptmann löste seinen Helm. Er nahm ihn langsam vom Kopf und hängte ihn schließlich an den Sattelknopf. »Mandata …«
»Ich heiße Lorn«, sagte die Frau leise.
»Einhundertfünfundsiebzig Männer und Frauen. Zweihundertzehn Pferde. Das neunzehnte Regiment der Achten Kavallerie von Itko Kan …« Irgendetwas schien dem Hauptmann die Kehle zuzuschnüren. Er sah Lorn an. »Tot.« Sein Pferd scheute, als ihm eine von unten heraufwehende Brise in die Nüstern stieg. Der Hauptmann riss wild an den Zügeln. Das Tier erstarrte, die Nüstern gebläht, die Ohren angelegt, mit zitternden Muskeln. Der Hengst der Mandata stand so still da wie eine Statue. »Alle hatten ihre Waffen gezogen. Und alle haben gegen den Feind gekämpft – wer auch immer sie angegriffen hat. Aber alle Toten sind unsere Leute.«
»Ihr habt den Strand überprüft?«, fragte Lorn. Sie starrte noch immer die Straße entlang.
»Nicht das geringste Anzeichen einer Landung«, erwiderte der Hauptmann. »Es gibt überhaupt keine Spuren, weder zum Meer hin noch landeinwärts. Aber es gibt noch mehr Tote, Mandata. Bauern, Fischer, Reisende, die auf der Straße unterwegs waren. Alle in Stücke gerissen, ihre Gliedmaßen verstreut – Kinder, Vieh, Hunde.« Er verstummte und wandte sich ab. »Mehr als vierhundert Tote«, sagte er mit krächzender Stimme. »Wir wissen die genaue Zahl noch nicht.«
»Natürlich«, sagte Lorn. Ihr Tonfall verriet nichts von ihren Gefühlen. »Und es gibt keine Zeugen?«
»Nein, keinen einzigen.«
Ein Mann kam unten auf der Straße auf sie zugeritten. Er saß weit vornübergebeugt im Sattel und sprach die ganze Zeit auf sein Pferd ein, während er das verängstigte Tier mitten durch das Gemetzel lenkte. Vögel flogen laut kreischend vor ihm auf, um sich wieder auf den Kadavern niederzulassen, sobald er vorbei war.
»Wer ist das?«, fragte die Mandata.
»Leutnant Ganoes Paran«, brummte der Hauptmann. »Aus Unta. Er ist neu in meinem Kommando.«
Lorn betrachtete den jungen Mann aus leicht zusammengekniffenen Augen. Er hatte am Rand der Senke Halt gemacht, um den dort Arbeitenden Befehle zu erteilen. Dann richtete er sich im Sattel auf und blickte in ihre Richtung. »Paran. Aus dem Haus Paran?«
»Hmm, richtig alter Adel, mit allem, was dazugehört.«
»Ruft ihn her.«
Der Hauptmann winkte, und der Leutnant drückte seinem Reittier die Fersen in die Flanken. Einen Augenblick später zügelte er es neben ihnen und salutierte.
Pferd und Reiter waren von Kopf bis Fuß mit Blutspritzern und kleinen Fleischfetzen bedeckt. Fliegen und Wespen umschwirrten beide aufgeregt. Lorn konnte in Leutnant Parans Gesicht nichts von der Jugend entdecken, die eigentlich dort hingehörte. Davon einmal abgesehen, war es ein Gesicht, das man sich durchaus anschauen konnte.
»Habt Ihr die andere Seite überprüft, Leutnant?«, fragte der Hauptmann.
Paran nickte. »Jawohl, Hauptmann. Am Fuße des Vorgebirges befindet sich ein kleines Fischerdorf, vielleicht ein Dutzend Hütten. Außer in zweien liegen in allen Leichen. Die meisten Boote scheinen da zu sein; ein Liegeplatz ist allerdings leer.«
»Beschreibt mir die leeren Hütten, Leutnant«, mischte Lorn sich ein.
Er schlug nach einer allzu aufdringlichen Wespe, bevor er antwortete. »Eine liegt ziemlich weit oben am Strand, direkt an dem Pfad, der zur Straße führt. Wir glauben, dass sie der alten Frau gehört, die wir ungefähr eine halbe Länge südlich von hier tot auf der Straße gefunden haben.«
»Wie kommt Ihr darauf?«
»Weil die Dinge, die wir in der Hütte gefunden haben, zu einer alten Frau passen, Mandata. Außerdem scheint sie häufig Kerzen angezündet zu haben. Talgkerzen, genauer gesagt. Die alte Frau auf der Straße hatte einen Sack voller Rüben und eine Hand voll Talgkerzen bei sich. Talg ist hier teuer, Mandata.«
»Wie oft seid Ihr schon durch dieses Schlachtfeld geritten, Leutnant?« , fragte Lorn.
»Oft genug, um mich daran gewöhnt zu haben«, antwortete Paran und verzog dabei das Gesicht.
»Und was ist mit der zweiten leeren Hütte?«
»Die gehörte wahrscheinlich einem Mann und einem Mädchen. Sie liegt nahe an der Flutlinie, genau gegenüber von dem leeren Liegeplatz.«
»Und keine Spur von den Bewohnern?«
»Nichts, Mandata. Natürlich finden wir immer noch neue Leichen, entlang der Straße oder auf den Feldern …«
»Aber nicht am Strand.«
»Nein.«
Die Mandata runzelte die Stirn. Sie war sich der Tatsache bewusst, dass beide Männer sie beobachteten. »Hauptmann, mit was für Waffen sind Eure Soldaten getötet worden?«
Der Hauptmann zögerte, warf dem Leutnant schließlich einen auffordernden Blick zu. »Ihr seid dort unten rumgekrochen, Paran. Dann lasst mal Eure Meinung hören.«
Paran antwortete mit einem knappen Lächeln. »Jawohl, Hauptmann. Natürliche Waffen, Hauptmann.«
Der Hauptmann verspürte ein flaues Gefühl im Magen. Er hatte gehofft, er hätte sich vielleicht getäuscht.
»Was meint Ihr mit ›natürlichen Waffen‹?«, fragte Lorn.
»Zähne … große, scharfe Zähne …«
Der Hauptmann räusperte sich. »Es hat in Itko Kan seit mehr als hundert Jahren keine Wölfe mehr gegeben. Wie dem auch sei, keiner der Kadaver …«
»Wenn das Wölfe waren«, sagte Paran und drehte sich um, damit er einen Blick auf das Schlachtfeld werfen konnte, »müssen sie so groß gewesen sein wie Maultiere. Und es gibt keine Spuren, Mandata. Noch nicht einmal ein Fellbüschel.«
»Also keine Wölfe«, sagte Lorn.
Paran zuckte die Achseln.
Die Mandata holte tief Luft, hielt einen Moment den Atem an und atmete mit einem leisen Seufzen wieder aus. »Ich möchte dieses Fischerdorf sehen.«
Der Hauptmann griff nach seinem Helm, aber die Mandata schüttelte den Kopf. »Es reicht, wenn Leutnant Paran mich begleitet, Hauptmann. Ich würde vorschlagen, Ihr übernehmt in der Zwischenzeit persönlich das Kommando über Eure Leute. Die Toten müssen so schnell wie möglich weggeschafft werden. Alle Hinweise auf dieses Massaker müssen beseitigt werden.«
»Verstanden, Mandata«, sagte der Hauptmann und hoffte, dass ihm die Erleichterung nicht anzuhören war.
Lorn wandte sich an den jungen Adligen. »Nun, Leutnant?«
Er nickte und setzte mit einem Zungenschnalzen sein Pferd in Bewegung.
Als die Vögel in Scharen vor ihnen aufflogen, stellte die Mandata fest, dass sie den Hauptmann beneidete. Die aufgeschreckten Aasfresser gaben den Blick auf einen Flickenteppich aus Rüstungsteilen, Knochen und Fleisch frei. Die Luft war heiß und schwül, und es stank widerlich. Sie sah Soldaten, deren immer noch behelmte Köpfe von gewaltigen, unglaublich starken Kiefern zermalmt worden waren. Sie sah in Fetzen gerissene Rüstungen, zerschmetterte Schilde und ausgerissene Arme und Beine. Lorn ertrug es nur wenige Minuten, das Szenario um sie herum sorgfältig zu betrachten, dann richtete sie – unfähig, das Ausmaß dieses Gemetzels zu erfassen – den Blick auf das Vorgebirge, das ein Stück vor ihnen lag. Ihr Hengst, der einer besonders edlen Zucht aus dem Reich der Sieben Städte entstammte und ein echtes Schlachtross und der Spross einer langen Ahnenreihe von für Kampf und Krieg ausgebildeten Vorfahren war, hatte seinen stolzen, unnachgiebigen Schritt verloren und setzte sorgfältig Huf vor Huf.
Lorn spürte, dass sie Ablenkung brauchte. Zum Beispiel, indem sie mit dem Leutnant ein Gespräch begann. »Habt Ihr schon Eure Bestallung erhalten, Leutnant?«
»Nein, Mandata. Aber ich gehe davon aus, dass ich in der Hauptstadt stationiert sein werde.«
Sie wölbte eine Augenbraue. »Ah, ja. Und wie wollt Ihr das hinkriegen?«
Paran blickte starr geradeaus; ein dünnes Lächeln spielte um seine Lippen. »Das wird schon arrangiert werden.«
»Ich verstehe.« Lorn schwieg einen Moment. »Die Adligen haben eine ganze Weile darauf verzichtet, nach Posten in der Armee zu streben, und stattdessen die Köpfe eingezogen, nicht wahr?«
»Seit den Anfängen des Imperiums. Der Imperator war uns nicht besonders gewogen. Die Imperatrix scheint hingegen andere Interessen zu haben.«
Lorn betrachtete den jungen Mann. »Ich stelle fest, dass Ihr es liebt, Risiken einzugehen, Leutnant«, sagte sie. »Oder aber Ihr geht in Eurer Anmaßung so weit, sogar die Mandata der Imperatrix herauszufordern. Vertraut Ihr so sehr auf die Unbesiegbarkeit Eures Blutes?«
»Seit wann ist es anmaßend, die Wahrheit zu sagen?«
»Ihr seid wirklich noch sehr jung, nicht wahr?«
Das saß. Paran stieg das Blut in die glatt rasierten Wangen. »Mandata, die vergangenen sieben Stunden bin ich knietief durch Blut und Körperteile gewatet. Ich habe mit Krähen und Möwen um Leichen gekämpft. Wisst Ihr, was diese Vögel hier tun? Ich meine, wisst Ihr es wirklich? Sie streiten sich um die Fleischfetzen, die sie aus den Leichen reißen. Sie werden dick und fett von Augäpfeln und Zungen, Lebern und Herzen. In ihrer rasenden Gier werfen sie die Fleischstückchen wild durch die Gegend …« Er verstummte, riss sich sichtlich zusammen, während er sich im Sattel aufrichtete. »Ich bin nicht mehr jung, Mandata. Und was meine anmaßenden Worte betrifft – nichts könnte mir gleichgültiger sein. Man kann hier draußen nicht um den heißen Brei herumreden, jetzt nicht und niemals wieder.«
Sie erreichten den Hang auf der gegenüberliegenden Seite. Zur Linken führte ein schmaler Pfad hinunter zum Meer. Paran deutete darauf und lenkte sein Pferd in die angegebene Richtung.
Lorn folgte ihm; sie war in nachdenkliches Schweigen versunken und starrte den breiten Rücken des Leutnants an. Dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf den Weg, auf dem sie dahinritten. Der schmale Pfad zog sich am Steilufer entlang. Zur Linken fiel das Gelände etwa sechzig Fuß steil zu den Felsen ab. Es war Ebbe, und die Wellen brachen sich an einem Riff ein paar hundert Schritt vor dem Ufer. In unzähligen Felsspalten und Vertiefungen stand Wasser, in dem sich matt der bedeckte Himmel spiegelte.
Sie erreichten eine Biegung, und darunter und dahinter erstreckte sich ein halbmondförmiger Strand. Oberhalb davon, am Fuß des Vorgebirges, lag ein flaches, grasbewachsenes Stück Land, auf dem ein Dutzend Hütten kauerten.
Die Mandata ließ ihren Blick hinaus aufs Meer schweifen. Die Boote lagen auf ihren flachen Bordwänden neben den Anlegepfählen. Der von der Ebbe freigegebene Strand war leer, und nicht ein einziger Vogel war in Sicht.
Sie zügelte ihr Pferd. Einen Augenblick später drehte sich Paran nach ihr um und tat dasselbe. Er sah, wie sie ihren Helm abnahm und ihr langes, kastanienbraunes Haar ausschüttelte. Es war schweißnass und strähnig. Der Leutnant ritt zu ihr zurück, einen fragenden Ausdruck im Gesicht.
»Leutnant Paran, Ihr habt Eure Worte gut gewählt.« Sie sog die salzgeschwängerte Seeluft tief in die Lungen, dann blickte sie ihn an. »Ich fürchte, Ihr werdet nicht in Unta stationiert werden. Ihr erhaltet Eure Befehle in Zukunft direkt von mir, denn Ihr seid ab sofort ein bevollmächtigter Offizier in meinem Stab.«
Er sah sie aus zusammengekniffenen Augen an. »Was ist mit den Soldaten da hinten geschehen, Mandata?«
Sie antwortete nicht sofort, lehnte sich lediglich ein wenig im Sattel zurück und starrte hinaus aufs Meer. »Jemand ist hier gewesen. Ein überaus mächtiger Zauberer«, sagte sie. »Es ist etwas geschehen, und wir sollen nicht herausfinden, was es war.«
Paran blieb der Mund offen stehen. »Die Ermordung von vierhundert Menschen war nichts weiter als ein Ablenkungsmanöver?«
»Wäre der Mann mit seiner Tochter zum Fischen draußen gewesen, wären sie mit der Flut zurückgekehrt.«
»Aber …«
»Ihr werdet ihre Leichen nicht finden, Leutnant.«
Paran war verwirrt. »Und was jetzt?«
Sie sah ihn an, wendete dabei ihr Pferd. »Wir reiten zurück.«
»Das war alles?« Er starrte ihr nach, als sie ihr Pferd den schmalen Pfad hinauflenkte, dann ritt er hinter ihr her, um sie einzuholen. »Einen Moment, Mandata«, sagte er, als er sie erreicht hatte.
Sie warf ihm einen warnenden Blick zu.
Paran schüttelte den Kopf. »Nein. Wenn ich ab jetzt zu Eurem Stab gehöre, muss ich mehr über das wissen, was hier vorgeht.«
Sie setzte ihren Helm wieder auf und zog den Kinnriemen fest. Ihr langes Haar fiel in zerzausten Strähnen über ihren Umhang. »Also gut. Wie Ihr wisst, Leutnant, bin ich keine Magierin –«
»Nein«, unterbrach Paran sie mit einem kalten Grinsen, »Ihr jagt sie nur und tötet sie.«
»Unterbrecht mich nicht noch einmal, Leutnant. Also, wie ich gesagt habe, bin ich eine Art Gegenmittel zu Zauberei und Magie. Das bedeutet, dass ich zwar keine Magie ausübe, aber nichtsdestotrotz ein Verhältnis zu ihr habe. In gewisser Weise zumindest. Man könnte vielleicht sagen, wir kennen einander. Ich kenne die Muster der Zauberei, und ich kenne die Muster der Gehirne, die sich ihrer bedienen. Wir sollen zu dem Schluss kommen, dass das Gemetzel echt war – und dass es ein Zufall war. Aber es war weder das eine noch das andere. Es gibt eine Spur, und die müssen wir finden.«
Paran nickte langsam.
»Eure erste Aufgabe, Leutnant, ist es, in diese Stadt zu reiten, in der der Markt stattfindet … Wie war noch mal ihr Name?«
»Gerrom.«
»Ach ja, Gerrom. Dort wird man dieses Fischerdorf kennen, denn diese Leute haben ihren Fang in Gerrom verkauft. Fragt ein bisschen herum, findet heraus, ob jemand eine Fischerfamilie kennt, die nur aus einem Mann und seiner Tochter bestanden hat. Ich brauche ihre Namen und vernünftige Beschreibungen. Wendet Euch an das Militär, wenn die Städter widerspenstig sein sollten.«
»Das werden sie nicht«, sagte Paran. »Die Kanesen sind ein hilfsbereites Volk.«
Sie waren wieder oben angekommen und hielten dort an, wo der Pfad auf die Straße stieß. Unten bewegten sich Wagen zwischen den Leichen, Ochsen schrien und stampften mit blutverschmierten Hufen, Soldaten brüllten, und über allem wirbelten tausende von Vögeln durch die Luft. Es stank nach Panik. Am anderen Ende des Schlachtfelds stand der Hauptmann, in einer Hand den Helm, der am Kinnriemen baumelte.
Die Mandata starrte mit harten Augen auf die Szene hinunter. »Ich hoffe um ihretwillen, dass Ihr Recht habt, Leutnant.«
Als er die beiden Reiter näher kommen sah, sagte eine innere Stimme dem Hauptmann, dass seine angenehmen Tage in Itko Kan gezählt waren. Sein Helm erschien ihm auf einmal viel schwerer als sonst. Der Hauptmann beäugte Paran. Dieser dünnblütige Bastard hatte es gut. An hundert Fäden wird der Schritt für Schritt zu einem schnuckeligen Posten in irgendeiner friedlichen Stadt hochgezogen.
Er sah, dass Lorn ihn musterte, als die beiden die Hügelkuppe erreichten. »Hauptmann, ich habe eine Bitte an Euch.«
Der Hauptmann grunzte. Eine Bitte? Zur Hölle! Die Imperatrix muss jeden Morgen in ihre Schuhe schauen, um sicherzugehen, dass die hier nicht schon drin steht. »Selbstverständlich, Mandata.«
Die Frau stieg vom Pferd, und Paran folgte ihrem Beispiel. Das Gesicht des Leutnants war völlig unbewegt. War das Arroganz – oder hatte die Mandata ihn zum Nachdenken gebracht?
»Hauptmann«, begann Lorn, »soweit ich weiß, ist in Kan ein Rekrutierungszug unterwegs. Werden auch Leute von außerhalb der Städte aufgenommen?«
»In die Armee? Ja, sicher, die meisten kommen sogar aus dem Umland. Die Städter müssten viel zu viel aufgeben. Außerdem erfahren sie die schlechten Nachrichten immer zuerst. Die meisten Bauern haben keine Ahnung, dass in Genabackis so ziemlich alles schief gegangen ist. Viele von ihnen glauben sowieso, dass die Städter zu viel jammern. Darf ich fragen, welchen Hintergrund Eure Frage hat?«
»Ihr dürft.« Lorn drehte sich um und sah den Soldaten zu, die sich bemühten, die Straße zu räumen. »Ich brauche eine Liste aller Rekruten, die innerhalb der letzten beiden Tage aufgenommen worden sind. Aber ich brauche nur die, die von außerhalb sind; die anderen, die in den Städten geboren wurden, sind unwichtig. Und nur die Frauen und/oder alten Männer.«
Der Hauptmann grunzte erneut. »Das dürfte eine kurze Liste werden, Mandata.«
»Das hoffe ich sehr, Hauptmann.«
»Ihr habt herausgefunden, was hinter dieser Geschichte steckt?«
Lorn war noch immer damit beschäftigt, den Soldaten unten auf der Straße zuzusehen. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung.«
Na klar, dachte der Hauptmann, und ich bin der wiedergeborene Imperator. »Wie bedauerlich«, murmelte er.
»Ach, übrigens«, wandte die Mandata sich ihm zu, »Leutnant Paran gehört jetzt zu meinem Stab. Ich gehe davon aus, dass Ihr die notwendigen Formalitäten erledigen werdet.«
»Wie Ihr wünscht, Mandata. Ich liebe Papierkram.«
Die letzten Worte bescherten ihm ein dünnes Lächeln. Dann war es auch schon wieder verschwunden. »Leutnant Paran wird sofort aufbrechen.«
Der Hauptmann sah zu dem jungen Adligen hinüber und lächelte. Es war ein Lächeln, das alles sagte. Für die Mandata zu arbeiten hieß den Köder an der Angel zu spielen. Die Mandata war der Haken, und das andere Ende der Schnur hielt die Imperatrix in der Hand. Soll er sich ruhig ordentlich winden …
Ein säuerlicher Ausdruck glitt über Parans Gesicht. »Jawohl, Mandata.« Er stieg wieder aufs Pferd, salutierte und ritt davon.
Der Hauptmann sah ihm nach. »Sonst noch etwas, Mandata?«, fragte er die Frau neben ihm.
»Ja.«
Ihr Tonfall veranlasste ihn, sich umzudrehen.
»Es geht um die Eingriffe der Adligen in die imperiale Kommandostruktur; dazu würde ich gerne die Meinung eines Soldaten hören.«
Der Hauptmann starrte sie an. »Das ist keine besonders schöne Geschichte.«
»Fangt an.«
Der Hauptmann begann zu reden.
Es war der achte Tag der Rekrutierung, und Sergeant Aragan saß mit trüben Augen hinter seinem Schreibtisch, als ein weiterer Welpe vom Korporal vorwärts gestoßen wurde. Sie hatten hier in Kan ziemlich viel Glück gehabt. Die beste Ernte erhält man in der tiefsten Provinz, hatte Kans Faust gesagt. Alles, was die Leute hier mitkriegen, sind Geschichten. Geschichten fügen dir keine blutenden Wunden zu. Geschichten lassen dich nicht hungrig werden und tragen dir auch keine wunden Füße ein. Wenn du jung bist und nach Schweinestall stinkst und davon überzeugt bist, dass es auf der ganzen verdammten Welt keine Waffe gibt, die dich verletzen kann, dann ist das Einzige, was Geschichten bewirken, dass du gerne an ihnen teilhaben würdest.
Die alte Frau hatte Recht gehabt. Wie üblich. Diese Menschen hatten so lange unter der Knute gelebt, dass es ihnen mittlerweile gefiel. Nun gut, dachte Aragan, das Lernen fängt hier an.
Es war ein schlechter Tag gewesen. Angefangen hatte es damit, dass der hiesige Hauptmann mit drei Kompanien davongeprescht war, ohne den geringsten Hinweis – und sei es auch nur ein Gerücht – zurückzulassen, was eigentlich los war. Und als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, war keine zehn Minuten später Laseens Mandata aus Unta aufgetaucht. Sie war mittels eines dieser unheimlichen magischen Gewirre hierher gelangt. Obwohl er sie nie zuvor gesehen hatte, überlief es ihn schon kalt, wenn der heiße trockene Wind ihren Namen wisperte. Die Magiertöterin – der Skorpion in der Tasche des Imperiums.
Aragan starrte mit finsterer Miene auf seine Schreibtafel und wartete, bis der Korporal sich räusperte. Dann erst sah er auf.
Der Rekrut, der da vor seinem Schreibtisch stand, ließ den Sergeant verblüfft zusammenzucken. Er öffnete den Mund, um sämtliche Milchgesichter mit der beißenden Tirade zu verjagen, die ihm auf der Zunge lag. Eine Sekunde später schloss er ihn wieder, ohne ein einziges Wort gesagt zu haben. Kans Faust hatte klare, eindeutige Anweisungen gegeben: solange sie zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf haben – nehmt sie! Der Genabackis-Feldzug war ein riesiger Schlamassel; die Armee brauchte Frischfleisch.
Er grinste das Mädchen an. Sie entsprach hundertprozentig der Beschreibung, die die Faust gegeben hatte. Trotzdem … »Also gut, Schätzchen, dir ist klar, dass du dich angestellt hast, um der Armee des Imperiums beizutreten, ja?«
Das Mädchen nickte. Sie hielt ihren festen, kühlen Blick unverwandt auf Aragan gerichtet. Das Gesicht des Rekrutierungsoffiziers verhärtete sich. Verdammt, die kann doch nicht älter sein als zwölf oder dreizehn! Wenn das meine Tochter wäre …
Wieso sehen ihre Augen so verdammt alt aus? Etwas Ähnliches hatte er das letzte Mal in Genabackis gesehen, außerhalb des Mott-Waldes; er war über Felder marschiert, über die eine seit fünf Jahren anhaltende Dürre und ein doppelt so langer Krieg hinweggezogen waren. Nur der Hunger brachte solch alte Augen hervor – oder der Tod. Er blickte sie finster an. »Wie heißt du, Mädchen?«
»Dann bin ich also dabei?«, fragte sie ruhig.
Aragan nickte; sein Kopf hämmerte plötzlich wie wild. »Du wirst deine Zuweisung binnen einer Woche erhalten, es sei denn, du hast eine besondere Vorliebe.«
»Der Genabackis-Feldzug«, antwortete das Mädchen, ohne zu zögern. »Unter dem Kommando von Hohefaust Dujek Einarm. In Dujeks Kriegsheer.«
Aragan blinzelte. »Ich werde eine entsprechende Anmerkung machen«, sagte er sanft. »Wie ist dein Name, Soldatin?«
»Leida, mein Name ist Leida …«