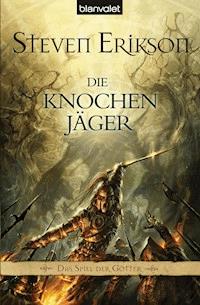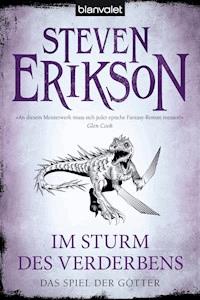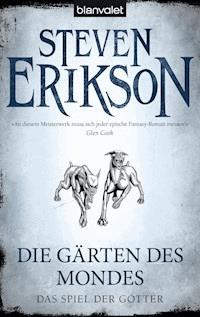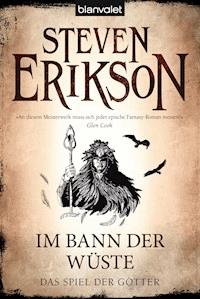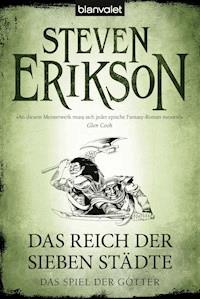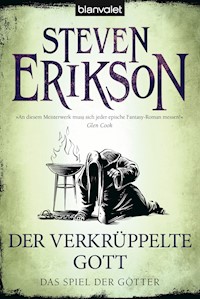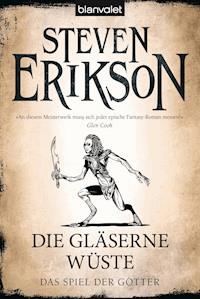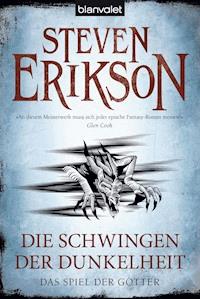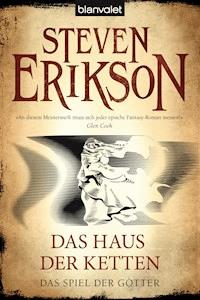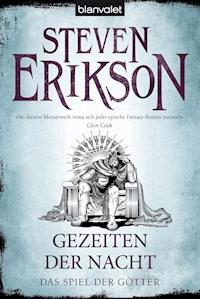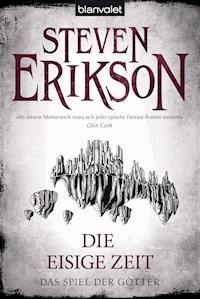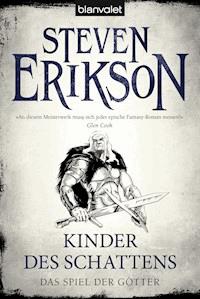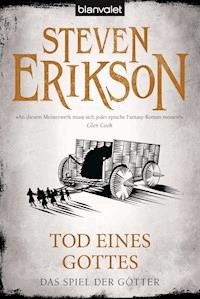
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Spiel der Götter
- Sprache: Deutsch
Krieg, Intrigen und unkontrollierte schwarze Magie
Ein Feind von unvorstellbarer Macht nähert sich Schwarz-Korall. Und doch verlässt Anomander Rake, der Sohn der Dunkelheit, seine Heimat und sein Volk. Dabei wäre nur er in der Lage, den Gegner zu bezwingen. Aber Anomander Rake weiß genau, dass die eigentliche Entscheidung in Darujhistan fallen wird. Darum ist sein Platz dort. Er betritt die Stadt des blauen Feuers in dem Wissen, dass es ein uraltes Unrecht wiedergutzumachen gilt – und dass der Tod eines Gottes unmittelbar bevorsteht!
Mit dieser komplexen epischen Fantasy-Saga wurde Steven Erikson zu einem der bedeutendsten Vertreter der modernen Fantasy.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1087
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Ein Feind von unvorstellbarer Macht nähert sich Schwarz-Korall. Und doch verlässt Anomander Rake, der Sohn der Dunkelheit, seine Heimat und sein Volk. Dabei wäre nur er in der Lage, den Gegner zu bezwingen. Aber Anomander Rake weiß genau, dass die eigentliche Entscheidung in Darujhistan fallen wird. Darum ist sein Platz dort. Er betritt die Stadt des blauen Feuers in dem Wissen, dass es ein uraltes Unrecht wiedergutzumachen gilt – und dass der Tod eines Gottes unmittelbar bevorsteht!
Autor
Steven Erikson, in Kanada geboren, lebt heute in Cornwall. Der Anthropologe und Archäologe feierte 1999 mit dem ersten Band seines Zyklus Das Spiel der Götter nach einer sechsjährigen akribischen Vorbereitungsphase seinen weltweit beachteten Einstieg in die Liga der großen Fantasy-Autoren.
Das Spiel der Götter bei Blanvalet:
1. Die Gärten des Mondes
2. Das Reich der Sieben Städte
3. Im Bann der Wüste
4. Die eisige Zeit
5. Der Tag des Sehers
6. Der Krieg der Schwestern
7. Das Haus der Ketten
8. Kinder des Schattens
9. Gezeiten der Nacht
10. Die Feuer der Rebellion
11. Die Knochenjäger
12. Der goldene Herrscher
13. Im Sturm des Verderbens
14. Die Stadt des blauen Feuers
15. Tod eines Gottes
Weitere Bände in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Steven Erikson
Tod eines Gottes
Das Spiel der Götter 15
Roman
Aus dem Englischen von Tim Straetmann
Buch Eins
Sterben im Jetzt
Schieb es weiter in den nächsten Augenblick
Denk jetzt nicht nach, spar dir das
für später auf, wenn das Denken
sein nutzloses Gesicht zeigt
wenn es zu spät ist und Sorge in hastiger Suche
nach Deckung verschwendet wird.
Schieb es weiter nach hinten in die Tasche
damit seine nagende Anwesenheit nachlässt
Nichts ist es wert, getan zu werden
In sinnloser Anmut
wenn deine Schreie erstickt werden
von all den gültigen Annahmen
Schieb es weiter in das tiefe Loch
das du nicht kennenlernen willst
für den Fall, dass es bricht
und dir grausame Erinnerungen beschert, wenn alles
was du hättest tun können, Vergangenheit geworden ist
Nein, mach dir nicht die Mühe
Schieb es gut in die Ecke
Es ist nutzlos, also erspare mir den Kummer
die Kosten – so strahlend, so hoch – haben dir nicht gefallen
Der ach so blutige Schnitt
wo du doch nur süßes Vergnügen wolltest
bis zum Ende deiner Tage
Schieb es weiter, bis es seinerseits schiebt
Lass deinen Schock hören, schrei ihn heraus
du hast dir nie ausgemalt, nie gewusst,
was es bedeuten würde, dich abzuwenden
Jetzt heul dein Entsetzen heraus in Wogen der Ungläubigkeit
Es ist geschehen, es ist tot
Schieb dich weiter bis nach ganz vorn
kratz nach den Augen schreiender Verwandter
Kein Erbe erwartet deine strahlenden Kinder
Es ist getötet, es ist getötet
Verloren die Zukunft, irgendwelchen heiligen Ruhm zu nähren
Die Welt ist zu Ende. Zu Ende.
Sibans Beichte auf dem Sterbebett
Siban von Aren
Kapitel Eins
Wir sahen ihn aus großer Entfernung herannahen
Taumelnd unter dem Gewicht all dessen, was er
In seinen Armen trug
Wir hielten es für eine Krone, doch als er näher kam
Entpuppte sich der Reif als die Haut einer Schlange
Die sich selbst in den Schwanz biss
Wir lachten und tranken abwechselnd aus der Karaffe, als er hinfiel
Jubelten, als er wieder aufstand
In gefälliger Anmut
Wir wurden still, als er ankam
Und wir die Bürde sahen, die er trug
Und vor jedem Schaden bewahrte
Wir blieben ernst angesichts seines erleichterten Lächelns
Und er sagte, diese junge neue Welt, die er gefunden hatte
Sei jetzt unser
Wir blickten ihn an, als wären wir großartige Götter
Die über einen Haufen unverdienter Geschenke grübeln
Und Messer ziehen
Verwegen vor Stolz schnitten wir blutige Streifen ab
Verteilten die leuchtende, tropfende Beute
Und aßen uns satt
Wir sahen ihn weinen, als nichts mehr übrig war
Und er wich zurück, mit Schmerz und Entsetzen im Blick
Und sinkenden Armen
Aber Wölfe machen aus jeder Welt einen Kadaver
Wir haben einfach nur entsprechend unserer Natur reagiert
In aller Unschuld
Verkündeten wir eifrig unsere demutsvolle Reinheit
Obwohl er sich jetzt abwandte und nicht zuhörte
Als der Geschmack sauer wurde
Und verräterisches Gift in unsere Glieder kroch
Wir sahen ihn weggehen, eine Länge oder vielleicht mehr
Sein einsamer Marsch
Sein trauerndes Verlassen unserer Freundlichkeit
Seine glückliche Auslöschung unseres rücksichtslosen Selbsts
Von Schlangen zu Tode gebissen
Die letzten Tage unseres Erbes
Fisher kel Tath
Der Aufprall war so hart, dass die riesigen Federn der Kutsche krachend aufeinanderschlugen; als das gewaltige Gefährt wieder hochschnellte, sah Grantl ganz kurz einen der beiden Brüder Stamm, der sich nicht hatte festhalten können und durch die körnige Luft wirbelte – mit sensenden Armen, strampelnden Beinen und verwirrte Überraschung im Gesicht.
Noch bevor Amby in die Tiefe und damit außer Sicht stürzte, spannte sich sein Haltestrick, und Grantl sah, dass der Idiot ihn an seinem Knöchel befestigt hatte.
Die Pferde wieherten schrill, und ihre Mähnen wogten, während sie hektisch über den steinigen, unebenen Boden stürmten. Ihre Hufe zertrampelten schattenhafte Gestalten, die gedämpfte Schreie ausstießen, und die Kutsche holperte auf ekelerregende Weise über Körper.
Jemand schrie ihm etwas ins Ohr; Grantl, der oben auf dem Dach der Kutsche saß, drehte sich um und sah Jula, den anderen der Brüder Stamm, an dem Haltestrick zerren. Ein Fuß tauchte auf – ohne Mokassin, die langen, knochigen Zehen weit gespreizt, als suchten sie nach einem Ast –, und dann kamen das Schienbein und das knubbelige Knie. Einen Augenblick später griff Amby nach oben, fand etwas, woran er sich festhalten konnte, und zog sich wieder auf das Kutschendach. Dabei hatte er das merkwürdigste Grinsen im Gesicht, das Grantl je gesehen hatte.
Im Halbdunkel raste die Kutsche der Trygalle-Handelsgilde vorwärts, pflügte durch wimmelnde Menschenmassen. Während sie wie ein Schiff durch aufgewühlte Wogen stampfte, reckten sich an den Seiten zerfetzte, verwesende Arme nach oben. Einige der Gestalten fanden etwas, woran sie sich festhalten konnten, doch wurden ihnen die Arme aus den Gelenken gerissen. Andere wurden auf die Beine gezogen, fingen an zu klettern auf der Suche nach besserem Halt.
Woraus sich die vordringlichste Aufgabe der Anteilseigner ergab. Süßeste Duldung, die kleine, dickliche Frau mit dem strahlenden Lachen, schlug zähnefletschend mit einem Beil auf einen ausgestreckten Arm ein. Knochen brachen wie Zweige, und sie stieß einen lauten Schrei aus, als sie in ein anzüglich grinsendes, vertrocknetes Gesicht trat – hart genug, dass der Kopf von den Schultern flog.
Verdammte Kadaver … sie fuhren durch ein Meer aus belebten Kadavern, und es schien, als wollte buchstäblich jeder von ihnen eine Passage ergattern.
Neben Grantl tauchte eine große viehische Gestalt auf. Ein Barghast, haarig wie ein Affe, die geschwärzten, spitz zugefeilten Zähne zu einem breiten Grinsen gebleckt.
Grantl ließ mit einer Hand die Bronzestrebe los, griff nach einer seiner Macheten und zog dem Kadaver die schwere Klinge durchs Gesicht. Plötzlich war die untere Hälfte des Grinsens verschwunden, und der Angreifer taumelte zurück. Grantl drehte sich weiter um und trat dem Barghast gegen die Brust. Die Erscheinung fiel nach unten. Einen Augenblick später tauchte ein anderer Mann auf, mit schmalen Schultern, einem hohen, länglichen Schädel, auf dem ein Nest aus mausgrauen Haaren thronte, und einem verschrumpelten Gesicht.
Grantl trat erneut zu.
Die Kutsche schwankte wild, als die riesigen Räder über irgendetwas Großes rollten. Grantl spürte, wie er vom Dach rutschte, und schrie vor Schmerzen auf, als die Hand, mit der er sich an einer Strebe festhielt, verrenkt wurde. Klauen scharrten an seinem Oberschenkel, und er trat in zunehmender Panik um sich. Als seine Ferse auf etwas traf, das nicht nachgab, nutzte er diesen festen Stand, um sich wieder auf das Kutschendach zu werfen.
Auf der anderen Seite wurde Süßeste Duldung inzwischen von drei toten Männern bedrängt, jeder von ihnen schien sie auf irgendeine Weise schänden zu wollen. Sie drehte und wand sich unter ihnen, hackte mit ihren Beilen auf sie ein, biss ihnen in die vertrockneten Hände und verpasste denen, die sie zu küssen versuchten, Kopfstöße. Jetzt mischte sich Reccanto Solcher in den Kampf ein; er benutzte ein merkwürdiges Messer mit einer Sägezahnklinge, mit dem er mehrere Gelenke anging – Schultern, Knie, Ellbogen –, um dann die abgetrennten Gliedmaßen beiseitezuwerfen.
Grantl erhob sich auf die Knie und ließ den Blick über die Landschaft schweifen. Die Toten bewegten sich alle in eine Richtung, während die Kutsche sich von der Seite her in den Strom hineinschob – und unausweichlich langsamer wurde, da die Bugwelle aus Gestalten, die wie Blut zu einer Wunde strömten, immer größer wurde und die Pferde die Hufe höher und höher heben mussten, um über immer mehr und mehr Untote zu steigen.
Hinter Grantl schrie jemand. Er drehte sich um und sah, dass die Frau namens Matt sich im hinteren Bereich des Kutschendachs seitlich nach unten beugte und auf das verrammelte Fenster einschrie.
Ein kräftiger, von dämonischem Gebrüll begleiteter Hieb brachte die Kutsche zum Schwanken. Klauen rissen ein Stück Holz ab.
»Schafft uns hier raus!«
Grantl war völlig ihrer Meinung – umso mehr, als der Dämon plötzlich in seinem Blickfeld erschien und die reptilischen Arme nach ihm ausstreckte.
Mit beiden Waffen in den Händen sprang er knurrend auf.
Ein längliches, mit Fängen versehenes Gesicht zuckte zischend auf ihn zu.
Grantl stieß seinerseits ein ohrenbetäubendes Gebrüll aus und schwang seine Macheten. Schneiden prallten auf dicke Haut, gruben sich tief in lebloses Fleisch, bis hinunter zu den Knochen des langen Dämonenhalses.
In den tiefliegenden Augen der Kreatur flackerte so etwas wie Überraschung auf, dann sackten der Kopf und die Hälfte des Halses nach unten weg.
Zwei weitere wilde Hiebe ließen die Unterarme davonwirbeln.
Der Körper stürzte nach hinten, und noch während dies geschah, kletterten kleinere Kadaver wie an einer Leiter daran hoch.
Jetzt hörte Grantl von weiter vorn ein seltsames, rhythmisches Geräusch, als würden Waffen klirrend gegen Schildränder stoßen. Aber dafür war es zu laut, zu überwältigend – es sei denn … Grantl richtete sich auf und blickte nach vorn.
Eine Armee, in der Tat. Zusammen mit all den anderen Untoten marschierten tote Soldaten in Reih und Glied, in Rechteck- und Keilformationen – unvorstellbar viele Soldaten. Er starrte sie an, bemühte sich, die ungeheure Größe dieser Streitmacht zu begreifen, die sich vor ihnen erstreckte, so weit das Auge reichte … Bei den Göttern hienieden, sämtliche Toten sind auf dem Marsch – aber wohin? Zu welchem Krieg?
Plötzlich verschwamm die Umgebung und löste sich in viele kleine Bruchstücke auf. Die Kutsche schien unter ihm wegzusacken. Dunkelheit wogte heran, trug salzigen Meeresgeruch mit sich, das Tosen einer Brandung – und Sand, der unter den Rädern wegrutschte. Mit der Seite, die ihm am nächsten war, krachte die Kutsche gegen eine Palme, woraufhin krachergroße Nüsse herabregneten, auf das Kutschendach trommelten und dann davonhüpften. Die Pferde stolperten, wurden langsamer, und einen Augenblick später kam alles zum Stillstand.
Grantl blickte nach oben und sah Sterne an einem freundlichen Nachthimmel.
Unter ihm öffnete sich quietschend die Tür der Kutsche, und jemand torkelte heraus, um sich keuchend und spuckend und fluchend in den Sand zu übergeben.
Meister Bezwang.
Grantl kletterte über die Speichen des Rades, das ihm am nächsten war, nach unten und begab sich auf zittrigen Beinen zu dem Zauberer.
Meister Bezwang war immer noch auf Händen und Knien und spuckte die letzten Tropfen dessen aus, was auch immer sich in seinem Magen befunden hatte. »Oh«, keuchte er. »Mein armer Kopf.«
Matt kam an Grantls Seite. Sie hatte eine eiserne Schädelkappe getragen, die sie irgendwann verloren haben musste, und jetzt hingen ihr die Haare in schweißnassen Strähnen um das runde Gesicht. »Ich dachte schon, ein verdammter Tiger wäre auf uns gelandet«, sagte sie. »Aber das warst du, und du hast einen Dämon in Angst und Schrecken versetzt. Dann ist es also wahr – diese Tätowierungen sind gar keine Tätowierungen.«
Glanno Tarp hatte sich vom Kutschbock fallen lassen und duckte sich, um den Pferden auszuweichen, die nach ihm schnappten. »Habt ihr gesehen, wie Amby Stamm durch die Luft geflogen ist? Bei den Göttern, das war blötakulär!«
Grantl runzelte die Stirn. »Blö-was?«
»Blödsinnig spektakulär«, erklärte Matt. »Oder spektakulär blödsinnig. Bist du ein Wechselgänger?«
Er sah sie kurz an und machte sich dann auf, die Umgebung zu erkunden.
Eine Aufgabe, die schnell erledigt war. Sie befanden sich auf einer Insel. Einer sehr kleinen Insel mit weniger als fünfzig Schritt Durchmesser. Der Sand bestand aus zermahlenen Korallen und glänzte silbern im Mondlicht. Zwei Palmen wuchsen mitten auf der Insel. Tausend Schritt weiter draußen in den umliegenden Untiefen verliefen Riffe rings um das Atoll, brachen wie das Rückgrat einer Seeschlange durch die Wasseroberfläche. Weitere Inseln waren zu sehen, aneinandergereiht wie die Perlen einer zerbrochenen Kette, wobei kaum eine größer war als diejenige, auf der sie sich befanden; die nächste war vielleicht dreitausend Schritt entfernt.
Als er zurückkehrte, sah er, wie ein Kadaver vom Kutschendach fiel und in den Sand plumpste. Einen Moment später setzte der Untote sich auf und sagte: »Oh.«
Der Trell stieg aus der Kutsche, gefolgt von Edel Fingerhut, der Sumpfhexe, die geisterhaft bleich war und ein paar stolpernde Schritte machte, ehe sie sich in den Sand fallen ließ. Als Mappo Grantl sah, trat er zu ihm.
»Ich vermute, wir sind in der Sphäre des Vermummten auf etwas Unerwartetes gestoßen«, sagte er.
»Keine Ahnung«, antwortete Grantl. »War mein erster Besuch.«
»Etwas Unerwartetes?« Matt schnaubte. »Das war der reinste Irrsinn – alle Toten der Welt auf dem Marsch.«
»Aber wohin?«, fragte Grantl.
»Vielleicht ist die Frage nicht, wohin sie unterwegs sind, sondern woher sie kommen.«
Woher? Waren sie womöglich auf dem Rückzug? Nun, das war eine beunruhigende Vorstellung. Wenn die Toten auf der Flucht sind …
»Früher mal war’s ’ne lockere Fahrt«, sagte Matt nachdenklich. »Es war friedlich. Aber in den letzten Jahren … irgendwas geht da vor.« Sie ging zu Meister Bezwang. »Also, wenn das nicht klappt, Bezwang, was machen wir dann?«
Der Mann, der immer noch auf Händen und Knien hockte, schaute auf. »Du kapierst es einfach nicht, was?«
»Was?«
»Wir haben das verdammte Tor noch nicht einmal erreicht.«
»Aber dann … was …«
»Da war gar kein Tor!«, kreischte der Magier.
Eine lang anhaltende Stille breitete sich aus.
Nahebei am Strand sammelte der Untote Muscheln.
Jula Stamms wässrige Augen richteten sich bewundernd und verträumt auf Edel Fingerhut. Als Amby das sah, folgte er dem Beispiel seines Bruders und versuchte, sogar noch begehrlicher zu gucken, damit sie am Ende erkannte, dass er für sie der Richtige war, der einzig Richtige. Ein Wettkampf, der umso heftiger wurde, je mehr Zeit verging.
Sein linkes Bein schmerzte nach wie vor von der Hüfte bis zu den Zehen, und er hatte nur noch einen Mokassin. Was nicht allzu schlimm war, da der Sand immerhin warm war.
Edel Fingerhut war in einer Besprechung mit Meister Bezwang, dem furchterregenden Mann mit den seltsamen Tätowierungen und dem haarigen riesigen Unmenschen namens Mappo. Amby kam zu dem Schluss, dass dies die wichtigen Leute waren, und mit Ausnahme von Edel Fingerhut wollte er mit ihnen lieber nichts zu tun haben. Es war nie gesund, solchen Leuten zu nahe zu kommen. Explodierende Köpfe, platzende Herzen – er hatte es mit eigenen Augen gesehen, damals, als er noch ein Knirps gewesen war (aber nicht annähernd so ein Knirps wie Jula) und die Familie sich nach langem Hin und Her entschieden hatte, doch noch gegen die Malazaner zu kämpfen, die wie Giftpilze in ihrem Sumpf aufgetaucht waren. Buna Stamm hatte damals das Sagen gehabt, bevor er von einer Kröte gefressen worden war, aber es war unbestreitbar, dass Bunas zweitengste Brüder – diejenigen, die noch dichter hatten dran sein wollen – dabei getötet worden waren. Explodierende Köpfe. Platzende Herzen. Kochende Lebern. Natürlich war es dabei um das Gesetz des Ausweichens gegangen. Marschalle und ihre Untermarschalle waren gerissen, und gerissen zu sein bedeutete, schnell zu sein, tja, und darum hatten sie sich weggeduckt, als die Pfeile und Armbrustbolzen und Wogen aus Magie herangeflogen kamen. Alle, die versucht hatten, genauso gerissen zu sein, aber überhaupt nicht gerissen und daher sehr viel langsamer gewesen waren … nun ja, die hatten sich einfach nicht schnell genug weggeduckt.
Jula seufzte schließlich und gestand seine Niederlage ein, dann sah er Amby an. »Ich kann nicht glauben, dass ich dich gerettet habe.«
»Ich auch nicht. Ich hätt’s nicht gemacht.«
»Deshalb kann ich auch nicht glauben, dass ich es getan habe. Andererseits hat sie gesehen, wie tapfer ich bin, wie großzügig und selbstlos. Sie hat gesehen, dass ich besser bin, weil sie weiß, dass du es nicht gemacht hättest.«
»Vielleicht hätte ich es doch gemacht, und vielleicht weiß sie das, Jula. Außerdem hat einer von den kranken übel Riechenden versucht, die Türen aufzumachen, und wenn ich nicht gewesen wäre, hätte er es geschafft – und genau das hat sie wirklich gesehen.«
»Du hast den nicht absichtlich abgekratzt.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil du ihm eine mit deinem Gesicht verpasst hast, Amby.«
Amby betastete einmal mehr prüfend seine Nase und zuckte zusammen, doch dann grinste er höhnisch. »Sie hat gesehen, was sie gesehen hat, und was sie gesehen hat, warst nicht du.«
»Sie hat meine Hände gesehen, die nach unten gegriffen haben, um dich wieder hochzuziehen. Das hat sie gesehen.«
»Hat sie nicht. Dafür habe ich gesorgt. Ich habe deine Hände nämlich mit meinem … äh … meinem Hemd zugedeckt.«
»Du lügst.«
»Du lügst.«
»Nein, du.«
»Du!«
»Du kannst sagen, was du willst, Amby, was auch immer du willst. Ich war derjenige, der dich gerettet hat.«
»Du meinst, der mir den Mokassin ausgezogen hat.«
»Das war ein Versehen.«
»Ja, klar – und wo ist er jetzt?«
»An der Seite runtergefallen.«
»Nein, ist er nicht. Ich hab in deinen Beutel geschaut, Jula. Du hast überhaupt nicht versucht, mich zu retten, du hast mir meinen Mokassin gestohlen, weil es dein Lieblings-Mokassin ist. Ich will ihn wiederhaben.«
»Es ist gegen das Gesetz, in den Beutel von jemand anderem zu schauen.«
»Gegen das Sumpfgesetz. Sieht das hier aus wie ein Sumpf?«
»Das spielt überhaupt keine Rolle. Du hast das Gesetz gebrochen. Wie auch immer, was du gefunden hast, war mein Ersatz-Mokassin.«
»Dein einzelner Ersatz-Mokassin?«
»Genau.«
»Und wieso ist er dann voll mit meinen Liebesbekundungen?«
»Was für Liebesbekundungen?«
»Diejenigen, die sie und ich uns hin und her geschrieben haben. Diejenigen, die ich in meinem Mokassin versteckt habe. Die meine ich, Jula.«
»Immerhin kommt jetzt raus, wie oft du das Gesetz gebrochen hast, wenn du deine Liebesbekundungen – die du an dich selbst und niemanden sonst schreibst – in meinem Ersatz-Mokassin versteckt hast!«
»Nicht, dass du jemals nachgesehen hättest.«
»Aber ich hätte nachsehen können, wenn ich es gewusst hätte.«
»Hast du aber nicht, oder? Außerdem hast du gar keinen Ersatz-Mokassin, weil ich ihn gestohlen habe.«
»Und deshalb habe ich ihn zurückgestohlen!«
»Du kannst nichts zurückstehlen, von dem du nicht gewusst hast, dass es gestohlen wurde. Das ist einfach nur stehlen. Und stehlen ist gegen das Gesetz.«
»Das Sumpfgesetz.«
»Dein Beutel ist ein Sumpf.«
»Hahahahaha.«
Amby grinste über seinen eigenen Witz, und dann lachte auch er. »Hahahahaha…«
Matt griff nach dem Weinschlauch, zog den Stöpsel und nahm einen Schluck und reichte ihn an Süßeste Duldung weiter. »Hör dir nur diese Idioten an«, sagte sie.
»Lieber nicht«, antwortete Süßeste Duldung. Und dann erschauerte sie. »Weißt du, das war das erste Mal, dass sie auf diese Weise versucht haben, in meine Hose zu kommen.«
»Vielleicht war’s ja eine Art Leichenstarre.«
Süßeste Duldung schnaubte. »Machst du Witze? Was auch immer sie da unten hatten, war nicht echt, vielleicht eher so was wie angebundene Stöcke.« Sie trank ein paar Schluck Wein, seufzte dann und schaute sich um. »Hübsch hier.«
»Unser winziges Stückchen Paradies.«
»Zumindest können wir die Sonne aufgehen sehen. Das wird schön werden.« Sie schwieg einen Moment, ehe sie fortfuhr. »Als Reccanto aufgetaucht ist, dachte ich, er wollte mir helfen. Aber jetzt glaube ich, dass er die Situation nur ausgenutzt hat, um selbst mal zuzugreifen.«
»Und das überrascht dich, Süße? Er ist ein Mann.«
»Mit schlimmen Augen.«
»Schlimmen Augen und schlimmen Händen.«
»Könnte sein, dass ich ihn umbringen muss.«
»Moment mal«, sagte Matt und nahm den Weinschlauch wieder an sich. »Er hat dich gerettet. Hat Arme und Hände abgehackt …«
»Die Konkurrenz aus dem Weg geräumt.«
»Deine Ehre verteidigt, Süße.«
»Wenn du es sagst.«
Matt stöpselte den Schlauch zu. »Bei den Göttern hienieden, Süße, was glaubst du … in was sind wir dahinten reingeraten?«
Süßeste Duldung schürzte die vollen Lippen und senkte die Lider mit den langen Wimpern. »Als ich noch ein Kind war, wurde ich zu Hause in Einaugkatz mal zu einer Fliegendämmerung mitgenommen – du weißt schon, diese Zeremonie vor dem Tempel des Vermummten, bei der sich alle Priester mit Honig einschmieren …«
»In manchen Orten nehmen sie Blut«, unterbrach Matt sie.
»Das habe ich gehört. In Einaugkatz war es Honig, so dass die Fliegen kleben geblieben sind. Fliegen und Wespen, genauer gesagt. Wie auch immer, ich war mit meinem Großvater da, der Soldat bei den Wiedergängern gewesen war …«
»Bei den Göttern, es ist lange her, dass ich diesen Namen das letzte Mal gehört habe.« Matt starrte Süßeste Duldung an. »Ist das wahr? Dein Großvater war bei den Wiedergängern?«
»Das hat er immer erzählt. Als ich noch klein war, habe ich ihm jedes Wort geglaubt. Als ich älter wurde, habe ich ihm nichts mehr geglaubt. Und jetzt, wo ich noch älter bin, fange ich an, ihm wieder zu glauben. All die Dinge in seinem Haus … Bodenfliesen, in die Muster eingeritzt waren, zerbrochene Masken, die an den Wänden hingen … ja, Matt, ich glaube, er war dabei.«
»Bei einer Truppe, die von einem Seguleh angeführt wurde …«
»Einem geächteten Seguleh, ja. Wie auch immer, mein Großvater hat mich mitgenommen, damit ich den Tempel des Schutzpatrons seiner alten Kompanie und all die Priester und Priesterinnen dabei sehen konnte, wie sie das mit den Fliegen gemacht haben.«
»Moment mal. Es heißt, die Wiedergänger sind alle verschwunden. Der Vermummte persönlich soll sie geholt haben, damit sie ihm in der Sphäre der Toten dienen können. Also, wie kommt es, dass dein Großvater noch in Einaugkatz gelebt hat?«
»Er hat seinen Schwertarm in einer Schlacht verloren. Man hat ihn für tot gehalten und zurückgelassen, und als er endlich gefunden wurde, war es für jede ernsthafte Heilung zu spät. Deshalb haben sie einfach nur den Stumpf ausgebrannt und ihn in den Ruhestand versetzt. Was ist – lässt du mich jetzt meine Geschichte erzählen oder nicht?«
»Ja doch, klar. Tut mir leid.«
»Er hat gesagt, die Priester würden das mit dem Honig ganz falsch machen. Die Fliegen und Wespen waren bei der Zeremonie nicht das Wichtige. Sondern das Blut – der Honig, aber der hat eigentlich Blut symbolisiert. Die Wiedergänger – die so eine Art Kriegerpriester des Vermummten gewesen waren, zumindest in der Welt der Sterblichen –, nun ja, das waren Flagellanten. Blut auf der Haut, ausgeblutetes Leben, das auf der Haut stirbt – darum ist es eigentlich gegangen. Deshalb schätzt der Vermummte tote Soldaten mehr als all die anderen unzähligen Toten, die durch das Tor stolpern. Die Händler des Blutes, die Armee, die auf der verborgenen Ebene namens Letzter Trotz kämpfen wird.« Sie machte eine Pause, leckte sich die Lippen. »Darum geht’s bei der Fliegendämmerung. Eine letzte Schlacht, die Toten sind versammelt auf einer verborgenen Ebene namens Letzter Trotz.«
»Dann ist das vielleicht der Grund«, sagte Matt mit einem Frösteln, »warum der Vermummte die Wiedergänger geholt hat. Weil diese Schlacht herannaht.«
»Gib mir noch was von dem da«, sagte Süßeste Duldung und streckte die Hand nach dem Weinschlauch aus.
Glanno Tarp stupste Reccanto Solcher an. »Haste gesehen? Sie reden über uns. Na ja, vor allem über mich. Es wird passieren, Solcher, früher oder später wird es passieren.«
Reccanto Solcher sah sein Gegenüber aus zusammengekniffenen Augen an. »Was – dass sie dich im Schlaf umbringen?«
»Sei kein Idiot. Eine von ihnen wird mich bitten, sie zu heiraten, für immer und ewig.«
»Und danach wird sie dich im Schlaf umbringen. Dann können wir deinen Anteil unter uns aufteilen.«
»Glaubst du, ich habe nicht gesehen, wie du Süße angegrabscht hast?«
»Wie konntest du das? Du hast die Kutsche gefahren!«
»Es gibt nichts, was ich nicht sehe, Solcher. Das macht mich zu so einem prächtiguten Kutscher.«
»Sie ist wirklich wunderbar griffig.«
»Pass auf, was du mit meinem zukünftigen ewiglichen Weib machst.«
»Könnte sein, dass du am Ende bei Matt hängenbleibst, was bedeutet, dass ich mit Süße tun kann, was ich will.«
Glanno Tarp rülpste laut. »Wir sollten etwas zu essen machen. Frühstücken. Und wenn die da drüben dann ausgequatscht haben, können wir aufstehen und uns auf den Weg machen.«
»Wo auch immer er uns hinführt.«
»Das spielt keine Rolle. Es hat nie eine Rolle gespielt und wird nie eine spielen.«
Reccanto Solcher grinste. »Stimmt. Nicht das Ziel zählt.«
Und gemeinsam fügten sie hinzu: »Sondern der Weg!«
Matt und Süßeste Duldung sahen zu ihnen herüber; beide machten ein finsteres Gesicht. »Nicht das schon wieder!«, rief Matt. »Hört bloß auf damit, ihr zwei! Hört auf damit, oder wir bringen euch im Schlaf um!«
Reccanto Solcher stupste Glanno Tarp an.
Mappo hockte auf seinen breiten Füßen und wiegte sich hin und her, während er darauf wartete, dass Meister Bezwang seine gemurmelte Beschwörung gegen Schmerzen endlich beendete. Er hatte Mitleid mit ihm, denn es war offensichtlich, dass der Magier litt – sein Gesicht war blass und ausgezehrt, die Stirn schweißbedeckt, und seine Hände zitterten.
Dass sich überhaupt jemand so einen Beruf aussuchte, war angesichts des hohen Preises, den man dafür zahlte, nur schwer vorstellbar. Waren Münzen das alles wert? Es war ihm unverständlich, wie man so denken konnte.
Was auf dieser Welt hatte einen echten Wert? Auf irgendeiner Welt? Freundschaft, die Geschenke der Liebe und des Mitgefühls. Die Ehre, die man dem Leben einer anderen Person zugestand. Nichts von alledem konnte mit Reichtum erkauft werden. Eine einfache Wahrheit, wie ihm schien. Und doch wusste er, dass gerade ihre Banalität den Brennstoff für höhnischen Zynismus und Spott bildete. Bis einem solche Dinge genommen wurden, bis das, was es bedeutete, sie zu verlieren, auf schrecklich verstörende Weise in das eigene Leben trat. Nur in einem Augenblick derart tiefgreifender äußerster Not wurde die Verachtung von dieser Wahrheit abgewaschen, so dass sie nackt und unbestreitbar dalag.
Alle bedeutenden Wahrheiten waren banal.
Aber es gab noch eine andere Wahrheit. Er hatte für diese Reise bezahlt. Seine Münzen waren für die Schmerzen dieses Mannes verantwortlich. Der Handel war unausgeglichen, und so trauerte Mappo um Meister Bezwang und wollte seine eigene Schuld nicht leugnen. Ehre bedeutete schließlich die Bereitschaft und die Bereitwilligkeit, abzuwägen und abzuschätzen, das rechtmäßige Gleichgewicht zu beurteilen, ohne dass eine Hand die Waagschalen neigte.
Und so bezahlten alle hier, um Mappos Bedürfnis zu erfüllen, diese Reise durch die Gewirre. Eine weitere Bürde, die er annehmen musste. Wenn er es konnte.
Der beachtliche Krieger, der neben ihm saß, rührte sich und sagte schließlich: »Ich glaube, ich verstehe jetzt, warum die Trygalle so viele Anteilseigner verliert, Meister Bezwang. Beim Abgrund, es muss doch auch Gewirre geben, durch die man friedlich reisen kann?«
Meister Quell rieb sich das Gesicht. »Sphären widersetzen sich, Grantl. Wir sind wie Wasserspritzer in heißem Öl. Mehr kann ich nicht tun, damit wir nicht … abprallen. Magier können sich in ihre erwählten Gewirre drängen – es ist nicht leicht, meistens ist es ein Spiel subtiler Überzeugung. Oder eine bescheidene Durchsetzung des Willens. Man will schließlich nicht ein Loch von einer Sphäre in die andere sprengen, denn das würde sehr wahrscheinlich außer Kontrolle geraten. Es kann einen Magier binnen einem Augenblick verschlingen.« Er sah aus blutunterlaufenen Augen zu ihnen auf. »So können wir es jedenfalls nicht tun.« Er wedelte schwach mit der Hand in Richtung der Kutsche hinter ihnen. »Wir wirken wie eine Beleidigung, wenn wir ankommen. Wir sind eine Beleidigung. Wie eine weißglühende Speerspitze schießen wir durch, rasen auf unserem wilden Weg entlang, und ich muss gewährleisten, dass alles, was wir auf unserem Weg zurücklassen, äh … kauterisiert wird. Ausgebrannt. Wenn ich das nicht schaffe, explodiert eine Woge aus Macht hinter uns, und auf so einer Woge kann kein Sterblicher lange reiten.«
Edel Fingerhut, die hinter Mappo saß, meldete sich zu Wort. »Dann müsst Ihr allesamt Hohemagier sein.«
Meister Bezwang nickte. »Ich muss zugeben, dass diese Art zu reisen anfängt, mich zu beunruhigen. Ich glaube, wir verletzen damit das ganze verdammte Universum. Wir bringen das Sein an sich zum … Bluten. Oh, nur ein bisschen hier und da, irgendwo inmitten des schmerzhaften Pochens, das möglicherweise zur Realität dazugehört. Wie auch immer, das ist jedenfalls der Grund, warum es keinen friedlichen Weg gibt, Grantl. Die Bewohner einer jeden Sphäre werden dazu getrieben, uns auszulöschen.«
»Ihr habt gesagt, wir hätten das Tor des Vermummten noch nicht einmal erreicht«, sagte der tätowierte Mann kurz darauf. »Und dennoch …«
»Ja.« Bezwang spuckte in den Sand. »Die Toten schlafen nicht mehr. Was für eine verdammte Sauerei.«
»Findet das nächste Festland in unserer eigenen Welt«, sagte Mappo. »Ich werde von dort aus losgehen. Es auf eigene Faust versuchen …«
»Wir halten den Kontrakt ein, Trell. Wir werden dich bringen, wohin du willst.«
»Nicht um den Preis, dass Ihr und Eure Begleiter womöglich sterbt – das kann ich nicht zulassen, Meister Bezwang.«
»Wir erstatten nichts zurück.«
»Ich will nichts zurückerstattet bekommen.«
Meister Bezwang stand zittrig auf. »Wir werden sehen, wie es nach der nächsten Etappe aussieht. Jetzt ist es Zeit fürs Frühstück. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich erbrechen zu müssen, wenn man nichts im Magen hat, das man erbrechen kann.«
Grantl stand ebenfalls auf. »Ihr habt Euch für eine neue Route entschieden?«
Bezwang verzog das Gesicht. »Schaut Euch um, Grantl. Die Entscheidung ist uns abgenommen worden.«
Mappo stand auf und blieb an Grantls Seite, während Bezwang zu seiner Mannschaft wankte, die sich um eine Kohlenpfanne versammelt hatte, die sie aus dem Bauch der Kutsche gezogen hatten. Der Trell betrachtete das bisschen Land um sie herum mit zusammengekniffenen Augen. »Was hat er gemeint?«, fragte er.
Grantl zuckte die Schultern. Seine Fänge glänzten, als er Mappo lächelnd ansah. »Da ich raten muss, Trell, würde ich sagen, dass wir bald schwimmen müssen.«
»Wir sind in Maels Sphäre«, schnaubte Edel Fingerhut. »Und ihr dachtet, die Sphäre des Vermummten wäre schlimm.«
Als Edel Fingerhut vier Jahre alt gewesen war, hatte man ihr einen Schlauch zum Atmen gegeben und sie in einem Haufen Torf begraben, wo sie zwei Tage und eine Nacht ausharren musste. Wahrscheinlich war sie dabei gestorben. Die meisten von ihnen starben, aber ihre Seele blieb – gefangen vom Torf und seinen dunklen, zauberischen Eigenschaften – im toten Körper. So erklärten die alten Hexen die Sache. Es war notwendig, ein Kind dem Torf zu übergeben, jener unheiligen Verbindung aus Erde und Wasser, so dass die Seele aus dem Körper, in dem sie hauste, herausgelöst werden konnte. Nur dann konnte diese Seele reisen, nur dann konnte diese Seele frei durch die Sphäre der Träume wandern.
Edel Fingerhut konnte sich kaum an die Zeit im Torf erinnern. Vielleicht hatte sie geschrien, vielleicht hatte sie versucht, in Panik um sich zu schlagen. Die Seile, mit denen sie gefesselt worden war und die außerdem dazu gedient hatten, sie in der Abenddämmerung des zweiten Tages wieder herauszuziehen, hatten tiefe Narben an ihren Handgelenken und an ihrem Hals hinterlassen. Brandwunden, die nicht davon stammten, dass die Hexen sie sanft und maßvoll ziehend wieder in die Welt zurückgeholt hatten. Es ging auch das leise Gerücht, dass die Geister, die im Torf lauerten, manchmal versuchten, den Körper eines Kindes zu stehlen und ihn für sich selbst zu nutzen. Und die Hexen, die das zeitweilige Grab bewachten, erzählten von Zeiten, in denen das Seil – dessen Ende sie sich um die Handgelenke geschlungen hatten – sich plötzlich gespannt hatte, und daraufhin hatte immer ein Kampf zwischen den Hexen oben und den Geistern in der Tiefe begonnen. Manchmal, so wurde zugegeben, verloren die Hexen, die Seile wurden angenagt, bis sie rissen, und das Kind wurde in die faulige Tiefe gezogen, um nur einmal im Jahr in der Nacht der Erwachten wieder aufzutauchen. Kinder mit blau-brauner Haut und leeren Augenhöhlen, mit Haaren, die die Farbe von Rost und Blut hatten, mit langen polierten Nägeln – so zogen sie durch den Sumpf und sangen die Lieder der Erde, die einen Sterblichen in den Wahnsinn treiben konnten.
Waren Geister zu ihr gekommen? Die Hexen wollten es nicht sagen. Waren die Brandnarben auf ihrer Haut die Folge von Panik oder etwas Anderem? Sie wusste es nicht.
Sie hatte nur wenige Erinnerungen, und diese wenigen waren eher Empfindungen. Das Gewicht auf ihrer Brust. Die einsickernde Kälte. Der Geschmack von stinkendem Wasser im Mund, das Stechen in den zugekniffenen Augen. Und die Geräusche, die sie hören konnte, schreckliche tröpfelnde Geräusche, wie das Rauschen von Flüssigkeiten in den Adern der Erde. Die dumpfen Schläge und das Knirschen, das Knistern, mit dem sich … Dinge näherten.
Es hieß, dass es im Torf keine Luft gab. Dass noch nicht einmal ihre Haut atmen konnte – obwohl jedes Lebewesen dieses Atmen brauchte. Daher musste sie tatsächlich gestorben sein.
Seit damals konnte sie sich nachts, wenn sie schlief, aus ihrem Körper erheben und unsichtbar über ihm schweben. Bewundernd auf ihn hinunterblicken. Sie war in der Tat schön, als wenn etwas von dem Kind, das sie einst gewesen war, niemals älter wurde, ja, gegen das Altern immun war. Eine Eigenschaft, die dazu führte, dass die Männer verzweifelt versuchten, Anspruch auf sie zu erheben, aber sie wollten sie nicht als Ebenbürtige, sondern als Besitz. Und je älter der Mann war, desto größer war sein Verlangen.
Als sie dies über sich und die Männer, die sie am meisten begehrten, herausgefunden hatte, hatte die Erkenntnis sie angewidert. Warum sollte sie diesen prachtvollen Körper solchen runzligen, armseligen Kreaturen geben? Das würde sie nicht tun. Niemals. Allerdings fiel es ihr schwer, sich gegen die notgeilen Jäger zu wehren … oh, sie konnte sie mit einem Fluch ins Elend stoßen, konnte sie vergiften und zusehen, wie sie unter großen Schmerzen starben, aber so etwas weckte ihr Mitleid – und zwar auf die sanfte, nicht die fiese Art –, was es nur umso schwieriger machte, grausam zu sein.
Sie hatte die Lösung in den jungen Brüdern Stamm gefunden. Beide waren knapp über zwanzig und nicht sonderlich geeignet, um länger bei Motts Irregulären zu bleiben, wobei sie über die Gründe nicht lange nachdenken musste. Und beide waren herrlich verliebt in sie.
Es spielte keine Rolle, dass sie zusammen kaum ein ganzes Gehirn hatten. Sie waren Stamms, grimmig gegenüber Magiern und allen Arten von Magie und von Geburt an mit der Überlebensfähigkeit des Salamandergottes ausgestattet. Sie beschützten sie in allen Schlachten, die man sich vorstellen konnte, angefangen von ausgemachten Kämpfen bis hin zu den hinterhältigen Nachstellungen alter Männer.
Wenn sie ihren Körper lange genug bewundert hatte, pflegte sie dorthin zu schweben, wo die beiden schliefen, und auf ihre schlaffen Gesichter hinunterzustarren, die weit offen stehenden Münder, aus denen pfeifende Schnarchgeräusche kamen, auf die Speichelfäden und die zuckenden Augenlider. Ihre Schoßhündchen. Ihre Wachhunde. Ihre tödlichen Jagdhunde.
Doch jetzt, in dieser Nacht unter einem tropischen Sternenhimmel, verspürte Edel Fingerhut ein zunehmendes Unbehagen. Dieses Trygalle-Unternehmen, für das sie sich aus einer Laune heraus entschieden hatte, erwies sich als weitaus tödlicher als erwartet. Tatsächlich hätte sie fast einen von ihnen in der Sphäre des Vermummten verloren. Und einen der beiden zu verlieren wäre … schlecht. Es würde dem anderen die Gelegenheit geben, näher an sie heranzurücken, und genau das wollte sie nicht, nein, das wollte sie ganz und gar nicht. Abgesehen davon war ein Wachhund auch nicht annähernd so wirkungsvoll wie zwei.
Vielleicht, nur vielleicht, war sie dieses Mal zu weit gegangen.
Grantl öffnete die Augen und sah, wie die schwach schimmernde Erscheinung zu den beiden schlafenden Stamm-Brüdern hinüberschwebte und einige Zeit über ihren Körpern verweilte, ehe sie umkehrte und in den Körper von Edel Fingerhut zurücksank.
Aus der Nähe hörte er das leise Ächzen des Trell und dann die Worte: »Ich frage mich, was für ein Spiel sie spielt …«
Grantl wollte ihm eigentlich antworten, doch stattdessen überwältigte ihn schlagartig die Müdigkeit, und er schlief ein, so dass sein Verstand stürzte, in die Tiefe taumelte und wie eine geschundene Ratte auf einer feuchten Lichtung aus hohem Gras ausgespuckt wurde. Die Sonne brannte wie das wütende Auge eines Gottes auf ihn herunter. Er fühlte sich zerschlagen und missbraucht und erhob sich auf alle viere – eine Position, die sich überhaupt nicht seltsam anfühlte und ihm auch nicht ungewöhnlich vorkam.
Die Lichtung war von dichtem Dschungel umgeben, aus dem die Geräusche zahlloser Vögel, Affen und Insekten drangen – eine so laute und anhaltende Kakophonie, dass sich tief in seiner Kehle ein verärgertes Knurren bildete.
In seiner unmittelbaren Umgebung verstummten schlagartig fast alle Geräusche, und es bildete sich ein Kokon aus Stille, unterbrochen nur vom Summen der Bienen und einem Paar langschwänziger Kolibris, die vor einer Orchidee auf und ab tanzten – kleine Kobolde, die wild mit den Flügeln schlagend davonrasten.
Grantl spürte, wie seine Nackenhaare sich aufstellten, was sich auf eine Weise starr und prickelnd anfühlte, dass es für einen Menschen eindeutig zu heftig war. Als er an sich selbst hinunterblickte, sah er die gestreiften Vorderbeine eines Tigers, wo seine Arme und Hände hätten sein sollen.
Schon wieder einer von diesen verdammten Träumen. Hör zu, Trake, wenn du willst, dass ich werde wie du, dann hör damit auf, mir diese Szenen vorzuspielen. Ich werde ein Tiger werden, wenn es das ist, was du willst – aber dann hör damit auf, diese Erfahrung auf meine Träume zu beschränken. Wenn ich aufwache, fühle ich mich schwerfällig und langsam, und das gefällt mir nicht. Wenn ich aufwache, erinnere ich mich an nichts anderes als an Freiheit.
Etwas näherte sich. Wesen … drei, nein, fünf. Nicht groß, nicht gefährlich. Er wandte langsam den Kopf und fokussierte den Blick.
Die Kreaturen, die zum Rand der Lichtung kamen, waren irgendetwas zwischen Affen und Menschen. Klein wie Heranwachsende, schlank und geschmeidig, mit einem feinen Pelz, der in den Achselhöhlen und im Schritt dichter war. Die beiden Männchen trugen jeder eine Art kurzen, gebogenen Knüttel, im Feuer gehärtet und mit den Fängen irgendeines Fleischfressers gespickt. Die Weibchen schwangen Speere, eine hielt in einer Hand einen Speer, in der anderen eine breite Feuersteinaxt, die sie auf die Lichtung schleuderte. Die Waffe landete mit einem dumpfen Aufprall auf halber Strecke zwischen Grantl und der Gruppe im Gras.
Grantl erkannte mit leichtem Schreck, dass er wusste, wie diese Kreaturen schmeckten – ihr heißes Fleisch, ihr Blut, ihr salziger Schweiß. In dieser Gestalt, an diesem Ort und in dieser Zeit hatte er sie gejagt, sie zu Boden gerissen und ihre kläglichen Schreie gehört, während seine Kiefer sich um ihren Hals geschlossen und zugebissen hatten.
Dieses Mal war er allerdings nicht hungrig, und es schien, als wüssten sie das.
Ehrfurcht flackerte in ihren Augen, ihre Münder verzerrten sich und verliehen ihnen einen merkwürdigen Ausdruck. Plötzlich begann eine der Frauen zu reden. Die Sprache trillerte, wurde von Klick- und Knacklauten unterbrochen.
Und Grantl konnte sie verstehen.
»Tier aus Dunkelheit und Feuer, Jäger im Dunkel und im Licht, Pelz der Nacht und Bewegung im Gras, Gott, der nimmt, sieh dies, unser Geschenk, und verschone uns, denn wir sind schwach und wenige und dieses Land ist nicht unseres, dieses Land ist die Reise, denn wir träumen vom Ufer, wo es viel zu essen gibt und die Vögel in der Hitze der Sonne rufen.«
Grantl stellte fest, dass er vorwärtsglitt, stumm wie ein Gedanke, Leben und Macht gebunden in einem einzigen Atemzug. Vorwärts, bis seine krallenbewehrten Pfoten an der Klinge der Axt angekommen waren. Er senkte den Kopf und atmete tief den Geruch von Stein und Schweiß ein, von altem Blut, das an den mit Gras polierten Schneiden aus Feuerstein klebte, von dem Urin, der daraufgespritzt worden war.
Diese Kreaturen wollten Anspruch auf diese Lichtung erheben.
Sie baten um Erlaubnis, und vielleicht auch um mehr. So etwas wie … Schutz.
»Die Leopardin verfolgt uns und fordert dich heraus«, sang die Frau, »aber sie wird deinen Pfad nicht kreuzen. Sie wird vor deinem Geruch fliehen, denn du bist hier der Herr, der Gott, der unangefochtene Jäger des Waldes. Letzte Nacht hat sie mein Kind geholt – wir haben alle unsere Kinder verloren. Vielleicht werden wir die Letzten sein. Vielleicht werden wir das Ufer niemals wiederfinden. Aber wenn unser Fleisch die Hungrigen nähren muss, dann sollst du es sein, der durch unser Blut stark wird.
Wenn du heute Nacht kommst, um einen von uns zu holen, nimm mich. Ich bin die Älteste. Ich kann keine Kinder mehr gebären. Ich bin nutzlos.« Dann hockte sie sich hin, legte ihren Speer ab und sank ins Gras, rollte sich auf den Rücken und entblößte ihre Kehle.
Sie mussten verrückt sein, beschloss Grantl. In den Wahnsinn getrieben von den Schrecken des Dschungels, in dem sie Fremde waren, sich verirrt hatten, nach irgendeiner fernen Küste suchten. Und während sie dahinzogen, brachte jede Nacht neues Entsetzen.
Aber das hier war ein Traum. Aus irgendeiner uralten Zeit. Und selbst wenn er danach trachten sollte, sie zur Küste zu führen, würde er lange vor dem Ende dieser Reise aufwachen. Er würde aufwachen und sie dadurch ihrem Schicksal überlassen. Und was, wenn er plötzlich hungrig wurde? Was, wenn seine Triebe sich Bahn brächen, er sich auf dieses unglückliche Weibchen stürzen und seine Kiefer um ihre Kehle schließen würde?
War dies der Ursprung von Menschenopfern? Als die Natur sie gierig und hungrig beäugt hatte? Als sie nichts als angespitzte Stöcke und ein schwelendes Feuer gehabt hatten, um sich zu schützen?
Er würde diese Gruppe heute Nacht nicht töten.
Er würde etwas anderes finden, das er töten konnte. Grantl setzte sich in Bewegung, glitt in den Dschungel. Tausend Gerüche erfüllten ihn, tausend gedämpfte Geräusche wisperten in den Schatten. Er trug sein gewaltiges Gewicht lautlos und ohne Anstrengung. Unter dem Laubdach herrschte nur dämmriges Licht, und so würde es immer bleiben, doch er sah alles – eine vorbeihuschende grün geflügelte Gottesanbeterin, im Humus herumwuselnde Asseln, einen geschmeidig fliehenden Tausendfüßler. Er glitt über einen Wildwechsel, sah die dunkelblättrigen Schösslinge, an denen die Tiere gefressen hatten. Er ging an einem verfaulten Holzklotz vorbei, der auseinandergerissen und beiseitegeworfen worden war; der Boden darunter war von der suchenden Schnauze eines Wildschweins aufgewühlt.
Als sich einige Zeit später die Nacht herabsenkte, fand er die Fährte, die er gesucht hatte. Scharf, beißend, gleichermaßen vertraut wie fremd. Sie war nur hin und wieder zu erkennen, ein Beweis dafür, dass die Kreatur, die sie hinterlassen hatte, vorsichtig war und sich zum Ausruhen auf die Bäume begab.
Ein Weibchen.
Er bewegte sich langsamer, während er der Spur folgte. Inzwischen war jegliches Licht verschwunden, sämtliche Farben waren zu Grautönen geworden. Wenn sie ihn entdeckte, würde sie fliehen. Andererseits – das einzige Tier, das nicht fliehen würde, war der Elefant, und er hatte kein Interesse daran, diesen weisen Riesen mit seinem üblen Sinn für Humor zu jagen.
Während er sich – einen leisen Schritt nach dem anderen – voranschob, kam er zu der Stelle, wo sie etwas gerissen hatte. Ein Wapiti, dessen Panik noch bitter in der Luft hing. Seine winzigen Hufe hatten den Humus aufgewühlt, und auf ein paar gekräuselten schwarzen Blättern war ein wenig Blut zu sehen. Grantl hielt inne und ließ sich nieder, dann hob er den Blick.
Und entdeckte sie. Sie hatte ihre Beute auf einen dicken Ast geschleppt, von dem in einer Kaskade aus Nachtblüten Lianen hingen. Das Wapiti – oder das, was noch von ihm übrig war – lag über dem Stamm, sie selbst hatte sich der Länge nach auf dem Ast ausgestreckt und starrte Grantl aus funkelnden Augen an.
Diese Leopardin war sehr gut dafür ausgestattet, nachts zu jagen – ihr Fell war schwarz auf schwarz, die Flecken kaum zu erkennen.
Sie betrachtete ihn ohne Furcht, was Grantl zu denken gab.
Und dann murmelte eine Stimme in seinem Schädel, süß und dunkel: »Geh deines Weges, Lord. Es ist nicht genug da, um es zu teilen … sofern ich das überhaupt wollte, was ich natürlich nicht will.«
»Ich bin deinetwegen gekommen«, antwortete Grantl.
Ihre Augen weiteten sich, und er sah, wie sich die Muskeln an ihren Schultern zusammenzogen. »Haben dann alle Tiere Reiter?«
Einen Moment lang verstand Grantl nicht, was sie meinte, dann dämmerte ihm die Erkenntnis mit plötzlicher Hitze, plötzlichem Interesse. »Ist deine Seele weit gereist, meine Lady?«
»Durch die Zeit. Über eine unbekannte Entfernung. Meine Träume führen mich jede Nacht hierher. Und immer bin ich auf der Jagd, immer schmecke ich Blut, immer gehe ich deinesgleichen aus dem Weg, Lord.«
»Ich werde durch Gebete herbeigerufen«, sagte Grantl. Kaum hatte er es ausgesprochen, wusste er, dass es die Wahrheit war. Die halbmenschlichen Kreaturen, die er zurückgelassen hatte, riefen ihn tatsächlich an. Als würden sie auf die angeborene Ablehnung der Vorstellung, dass alles nur Zufall war, mit der Anrufung des Mörders reagieren. Er wurde herbeibeschworen, um zu töten, wie ihm klar wurde. Um einen Nachweis für die Idee des Schicksals zu liefern.
»Eine seltsame Vorstellung, Lord.«
»Verschone sie, Lady.«
»Wen?«
»Du weißt, von wem ich spreche. In dieser Zeit gibt es nur eine einzige Kreatur, die Gebete sprechen kann.«
Er spürte ihre ironische Erheiterung. »Darin irrst du. Auch wenn die anderen kein Interesse daran haben, sich Tiere als Götter und Göttinnen vorzustellen.«
»Die anderen?«
»Viele Nächte von diesem Ort entfernt gibt es Berge, und in diesen Bergen kann man Festungen finden, in denen die K’Chain Che’Malle hausen. Es gibt einen gewaltigen Fluss, der zu einem warmen Ozean fließt, und an seinen Ufern kann man die Grubenstädte der Forkrul Assail finden. Es gibt einsame Türme, in denen einzelne Jaghuts leben und darauf warten, zu sterben. Es gibt die Dörfer der Tartheno Toblakai und ihrer in der Tundra lebenden Verwandten, der Neph Trell.«
»Du kennst diese Welt weitaus besser als ich, Lady.«
»Hast du immer noch vor, mich zu töten?«
»Wirst du aufhören, die Halbmenschen zu jagen?«
»Wie du willst. Aber du solltest wissen, dass es Zeiten gibt, in denen dieses Tier keine Reiterin hat. Und ich vermute, dass es außerdem Zeiten gibt, in denen auch das Tier, das du nun reitest, allein jagt.«
»Ich verstehe.«
Sie erhob sich aus ihrer trägen Position, kletterte kopfüber den Baumstamm hinunter und landete leicht auf dem weichen Waldboden. »Warum sind sie dir so wichtig?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe Mitleid mit ihnen.«
»Unsere Art kennt kein Mitleid, Lord.«
»Da bin ich anderer Ansicht. Es ist das, was wir geben können, wenn wir die Seelen dieser Tiere reiten. Beim Vermummten, es ist alles, was wir geben können.«
»Wer ist der Vermummte?«
»Der Gott des Todes.«
»Mir scheint, du kommst aus einer seltsamen Welt.«
Nun, das verblüffte ihn. Grantl schwieg längere Zeit, dann fragte er: »Woher kommst du, Lady?«
»Aus einer Stadt namens Neu-Morn.«
»Ich kenne eine Ruine namens Morn.«
»Meine Stadt ist keine Ruine.«
»Vielleicht existierst du in einer Zeit vor der Ankunft des Vermummten.«
»Vielleicht.« Sie streckte sich, ihre leuchtenden Augen wurden zu schmalen Schlitzen. »Ich werde bald gehen, Lord. Wenn du noch hier bist, wenn ich das tue, wird das Tier, das hierbleibt, über deine Anwesenheit nicht erfreut sein.«
»Ach? Und würde es so dumm sein, mich anzugreifen?«
»Und dabei sterben? Nein. Aber ich möchte es eigentlich nicht dazu verfluchen, Schrecken zu empfinden.«
»Oh … ist das jetzt Mitleid?«
»Nein, das ist Liebe.«
Ja, er konnte erkennen, wie es dazu kommen konnte, dass man solche Tiere liebte und es als überaus kostbares Geschenk empfand, ihre Seele zu reiten. »Ich werde jetzt gehen, Lady. Glaubst du, dass wir uns wieder begegnen werden?«
»Es scheint, als würden wir die Nacht teilen, Lord.«
Sie glitt davon, und nicht einmal Grantls außerordentliche Sehfähigkeit ermöglichte es ihm, ihr weiter als ein paar Schritte nachzublicken. Er drehte sich um und trottete in die entgegengesetzte Richtung davon. Ja, er konnte spüren, wie sein eigener Halt hier schwächer wurde, schon bald würde er in seine eigene Welt zurückkehren. In jenes blasse, schale Dasein, wo er halb blind, halb taub, abgestumpft und schwerfällig lebte.
Er gestattete sich ein tiefes ärgerliches Husten, das die unsichtbaren Dschungelbewohner überall um ihn herum verstummen ließ.
Bis irgendein tapferer Affe hoch über ihm einen Stock nach ihm warf. Das Geräusch, mit dem der Stock unweit seines rechten Hinterbeins auf den Boden prallte, ließ ihn zusammenzucken und zurückweichen.
Aus der Dunkelheit über ihm drang keckerndes Gelächter.
Der Sturm aus Chaos sprang in sein Blickfeld, verschlang die Hälfte des Himmels mit einem wirbelnden Irrsinn aus Blei, körnigem Schwarz und glühenden Silberfäden. Er sah, wie die Sturmfront den Boden aufwirbelte und sich in eine rasende Wand aus Staub, Felsen und Dreck verwandelte, die immer näher rückte.
Schloot erschien das unmittelbar bevorstehende Vergessen gar nicht so übel. Er wurde von der Kette mitgeschleift, die an seinem rechten Knöchel befestigt war. Der größte Teil seiner Haut war abgeschürft – der weiße Knochen und die Knorpel des verbliebenen Ellbogens waren schmutzig und hatten rote Höfe. Genauso sah es auch bei seinen Knien aus, nur größer. Die Fußschelle fraß sich allmählich durch den Knöchel und den Fußknochen. Er fragte sich, was wohl geschehen würde, wenn der Fuß irgendwann abriss – wie mochte sich das anfühlen? Er würde daliegen, schließlich doch bewegungslos, und vielleicht zusehen, wie die Fußschelle davontorkelte und -hüpfte. Er würde … frei sein.
Die Qual dieses Daseins sollte nicht mit Schmerzen verbunden sein. Das war unlauter. Gewiss, der größte Teil der Schmerzen verblasste allmählich – er war schon nicht mehr in der Lage, sich zusammenzurollen oder zusammenzuzucken, zu keuchen oder zu schluchzen –, aber die Erinnerungen blieben und brannten wie Feuer in seinem Kopf.
Er wurde weiter über lockere Steine gezerrt, deren scharfe Kanten neue Furchen durch das zerschundene Fleisch seines Rückens zogen und gegen die Basis seines Schädels schlugen, um auch die letzten Reste von Haaren und Kopfhaut wegzureißen. Und als die Kette sich kurz verhakte und ihn herumdrehte, als sie freikam, starrte er wieder und wieder auf den Sturm, der ihnen folgte.
Von dem ächzenden Wagen ein Stück weiter vorn erklangen leidvolle Lieder, ein nie endender Chor des Elends, der unentwegt nach hinten strömte.
Zu blöd, dachte er, dass der riesige Dämon ihn nicht unmittelbar nach seinem Zusammenbruch gefunden und ihn sich über die Schulter gelegt hatte – nicht, dass er noch mehr hätte tragen können, als er ohnehin schon getragen hatte. Aber vielleicht hätte er ihn ja einfach nur ein kleines Stückchen zur Seite gezogen, dann hätte das gewaltige Wagenrad Schloot nicht den rechten Arm und die Schulter zermalmt und beides so zu Brei zermantscht, dass sie nur noch mit ein paar Sehnenfäden am Körper hingen. Danach hatten sich alle Hoffnungen aufgelöst – so schwach sie auch gewesen sein mochten –, dass er je wieder aufstehen und seine Kraft erneut in den Zug derer, die den Wagen voranzerrten, einbringen konnte. Jetzt war er nur noch ein weiteres totes Gewicht, das hinterhergeschleppt wurde und das Leiden derjenigen vergrößerte, die weiterstapften.
Ganz in der Nähe und beinahe parallel zu ihm endete eine moosüberzogene Kette in den Überresten eines Drachen. Schwingen, die zerfetzten Segeln glichen, gebrochene und herunterbaumelnde Holme, ein größtenteils hautloser Kopf, der hinter einem abgeschrammten Hals hergeschleift wurde. Als Schloot den Drachen das erste Mal gesehen hatte, war er schockiert gewesen. Entsetzt. Jetzt überschwemmte ihn jedes Mal, wenn er in Sicht kam, eine Woge des Grauens. Dass eine solche Kreatur versagt hatte, war der Beweis für die verzweifelte äußerste Not, die sie alle plagte.
Anomander Rake hatte aufgehört zu töten. Die Legion war dabei zu scheitern. Die Auslöschung rückte immer näher.
Das Leben fürchtet das Chaos. So war es immer. Wir fürchten es mehr als alles andere, denn es ist ein Gräuel. Ordnung kämpft gegen die Auflösung. Ordnung nutzt Zusammenarbeit in jeglichem Maßstab als Überlebensmechanismus, angefangen von einem Streifen Haut bis hin zu einer ganzen Menagerie voneinander abhängiger Kreaturen. Diese Zusammenarbeit muss in ihrem Wesen nicht zwangsläufig friedlich sein – ein winziger Austausch von Misserfolgen zugunsten eines größeren Erfolgs.
Ja, während ich hier entlanggeschleift werde, am Ende meines Daseins, fange ich an zu verstehen …
Sieh mich an, sieh diese Gabe der inneren Einkehr.
Rake, was hast du getan?
Eine schwielige Hand schloss sich um den ihm verbliebenen Arm, hob ihn hoch, und dann wurde er nach vorn getragen, näher an den dahinkriechenden Wagen heran.
»Es ist sinnlos.«
»Und das«, erwiderte eine tiefe, bedächtige Stimme, »ist nicht von Bedeutung.«
»Ich bin es nicht wert …«
»Wahrscheinlich nicht, aber ich habe vor, auf dem Wagen einen Platz für dich zu finden.«
Schloot stieß ein abgehacktes Lachen aus. »Reißt mir einfach den Fuß ab, guter Herr, und lasst mich liegen.«
»Nein. Es könnte sein, dass du noch gebraucht wirst, Magier.«
Dass ich gebraucht werde? Nun, das war absurd. »Wer seid Ihr?«
»Draconus.«
Schloot lachte ein zweites Mal. »Ich habe nach Euch gesucht … seit Jahrhunderten, wie mir scheint.«
»Jetzt hast du mich gefunden.«
»Ich dachte, Ihr wüsstet vielleicht, wie man von hier entkommen kann. Ist das nicht lustig? Denn wenn Ihr das wüsstet, wärt Ihr ja wohl kaum noch hier, nicht wahr?«
»Das klingt logisch.«
Eine merkwürdige Antwort. »Draconus.«
»Ja?«
»Seid Ihr ein logischer Mann?«
»Nicht im Geringsten. Nun gut, wir sind da.«
Der Anblick, der sich Schloot bot, als er herumgeschwenkt wurde und nach vorn sehen konnte, war womöglich noch entsetzlicher als alles andere, was er gesehen hatte, seit er in der verfluchten Sphäre Dragnipurs angekommen war. Eine Mauer aus Leibern, aus der zwischen starrenden Gesichtern eingeklemmte Füße hervorragten. Hier und da hing ein zuckender, schweißtriefender Arm nach draußen. Hier ein Knie, da eine Schulter. Knäuel aus verfilzten Haaren, Finger mit dolchlangen Nägeln. Menschen, Dämonen, Forkrul Assail, K’Chain Che’Malle, andere, die Schloot nicht einmal identifizieren konnte. Er sah eine Hand und einen Unterarm, die gänzlich aus Metall zu bestehen schienen, Gelenkpfannen und Scharniere und Stangen und eine Kruste aus stählerner, von schartigen Flecken übersäter Haut. Am schlimmsten waren die Augen, die aus Gesichtern glotzten, die jeden Ausdruck aufgegeben zu haben schienen, so dass das, was noch da war, schlaff und dumm wirkte.
»Macht Platz da oben!«, brüllte Draconus. Rufe begrüßten ihn: »Hier ist kein Platz!« und »Nichts mehr frei!«.
Ohne die Proteste zu beachten, begann Draconus die Mauer aus Fleisch hochzuklettern. Gesichter verzerrten sich vor Wut und Schmerz, Augen weiteten sich beleidigt und ungläubig, Hände grabschten nach ihm oder schlugen zu Fäusten geballt auf ihn ein, aber der riesige Krieger nahm das alles gleichmütig hin. Schloot konnte seine gewaltige Kraft spüren, die unerbittliche Bestimmtheit jeder Bewegung, die von etwas Unbezwingbarem zeugte, und er empfand eine Ehrfurcht, die ihm die Sprache verschlug.
Sie kletterten höher, und Schatten rasten in verrückten Mustern durch die brodelnde Düsternis des Sturms, als würde sich das natürliche Zwielicht dieser Welt an die Erdoberfläche klammern. Hier oben war die Luft klarer und reiner.
Und das ruckelnde Vorankommen des Wagens war im Schwanken der Mauer aus Fleisch spürbar, einer Bewegung, die durch die glitschige Verlagerung von Körpern und ein waberndes Lied aus dumpfem, rhythmischem Stöhnen und Grunzen herausgeseufzt wurde. Die Mauer neigte sich schließlich nach innen, und Schloot wurde über Hügel aus Haut gezogen. Die Körper unter ihm waren so dicht gepackt, dass sie beinahe eine feste Oberfläche zu bilden schienen, eine wellige Landschaft, die mit Schweiß und Flecken aus Asche und Schmutz überzogen war. Die meisten hier lagen auf dem Bauch, als wäre es nicht zu ertragen, zum Himmel hinaufzustarren – der sowieso für immer verschwinden würde, sobald der nächste Körper ankam.
Draconus rollte ihn in eine Vertiefung zwischen zwei Rücken, die in entgegengesetzte Richtungen schauten. Ein Mann und eine Frau – der plötzliche Kontakt mit dem weichen Fleisch der Frau, als er gegen sie gepresst wurde, ließ etwas in Schloot erwachen, und er fluchte.
»Nimm, was du kriegen kannst, Magier«, sagte Draconus.
Schloot hörte, wie er sich wieder entfernte.
Er konnte jetzt einzelne Stimmen ausmachen, merkwürdige Geräusche, die ganz aus der Nähe kamen. Jemand krabbelte näher an ihn heran, und Schloot spürte, dass leicht an seiner Kette gezogen wurde.
»Also beinahe ab. Beinahe ab.«
Schloot wollte wissen, wer gesprochen hatte, und drehte sich um.
Ein Tiste Andii. Er war eindeutig blind, beide Augenhöhlen zeigten die schrecklichen Narben von Verbrennungen – nur absichtliche Folter konnte so präzise sein. Er hatte keine Beine mehr, sondern nur noch kurze Stümpfe. Er zog sich neben Schloot, und der Magier sah, dass die Kreatur einen langen zugespitzten Knochen mit einer geschwärzten Spitze in der Hand hielt.
»Hast du vor, mich zu töten?«, fragte Schloot.
Der Tiste Andii verharrte, hob den Kopf. Strähnige schwarze Haare umrahmten ein schmales, hohlwangiges Gesicht. »Was für Augen hast du, mein Freund?«
»Funktionierende.«
Ein kurzes Lächeln, dann schob sich der Tiste Andii näher heran.
Schloot schaffte es irgendwie, sich halb zu drehen, so dass seine verletzte Schulter und der nicht mehr zu gebrauchende Arm unter ihm waren und sein heiler Arm freikam. »Es ist verrückt, aber ich habe immer noch vor, mich zu wehren. Obwohl der Tod – wenn es ihn hier überhaupt gibt – eine Gnade wäre.«
»Es gibt ihn nicht«, antwortete der Tiste Andii. »Ich könnte dich die nächsten tausend Jahre stechen und würde nichts weiter bewirken, als dir eine Menge Löcher zu verpassen. Eine Menge Löcher.« Er machte eine Pause, und erneut flackerte das Lächeln über sein Gesicht. »Aber ich muss dich so oder so stechen, weil du eine Sauerei veranstaltet hast. Eine Sauerei, eine Sauerei, eine Sauerei.«
»Habe ich das? Erklär es mir.«
»Das ist sinnlos, es sei denn, du hättest Augen.«
»Ich habe welche, du verdammter Idiot!«
»Aber können sie sehen?«
Er bemerkte die Betonung des letzten Worts. Konnte er hier Magie erwecken? Konnte er etwas aus seinem Gewirr kratzen – genug, um seine Sicht abzuschwächen? Er musste es versuchen. »Warte mal kurz«, sagte er. Oh, das Gewirr war da, ja, so undurchlässig wie eine Mauer – aber er spürte etwas, das er nicht erwartet hatte. Sprünge, Risse, Dinge, die hinein- und herausströmten.
Die Auswirkungen des Chaos, wie ihm klar wurde. Bei den Göttern, es bricht alles zusammen! Er fragte sich, ob es wohl einen Zeitpunkt geben würde – einen Moment in genau jenem Augenblick, in dem der Sturm sie schließlich einholen würde –, in dem sich sein Gewirr in Reichweite befinden würde. Könnte er fliehen, bevor er zusammen mit allem und allen anderen ausgelöscht werden würde?
»Wie lang, wie lang, wie lang?«, fragte der Tiste Andii.
Schloot stellte fest, dass er tatsächlich einen Rest an Macht zusammenkratzen konnte. Ein paar leise vor sich hin gemurmelte Worte, und schlagartig sah er, was zuvor verborgen gewesen war – er sah, ja, das Fleisch, auf dem er lag.
Tätowierungen bedeckten jedes entblößte Fleckchen Haut, Linien und Bilder zogen sich von einem Körper zum nächsten, doch nirgendwo konnte er etwas Festes sehen – alles bestand aus komplizierten, feinen filigranen Mustern, aus Mustern in Mustern. Er sah Grenzen, die sich neigten und wanden. Er sah längliche Gestalten mit gestreckten Gesichtern und missgestalteten Rümpfen. Kein einziger Körper auf diesem gewaltigen Wagen war davon ausgenommen – außer seinem eigenen.
Der Tiste Andii musste sein erschrecktes Luftholen gehört haben, denn er lachte. »Stell dir vor, du schwebst … ach, sagen wir fünfzehn Mannshöhen weiter oben. Fünfzehn Mannshöhen. Weiter oben, weiter oben. Du schwebst in der Luft, direkt unter der Decke des Nichts, der Decke des Nichts. Und schaust auf all dies herunter, auf all dies, all dies. Klar, von da, wo du jetzt hockst, sieht es schief aus, aber von da oben, von da oben, von da oben – du siehst keine Berge aus Fleisch, keine Knubbel aus Knochen unter gedehnter Haut – du siehst keine Schatten – nur dieses Bild. Dieses Bild, ja, flach hingelegt, das würdest du schwören. Flach! Flach hingelegt, flach hingelegt!«
Schloot bemühte sich zu verstehen, was er sah – auszuprobieren, was der Tiste Andii vorgeschlagen hatte, traute er sich nicht, da er fürchtete, dass die Anstrengung ihn wahnsinnig machen würde; nein, er würde nicht versuchen, sich vorzustellen, dass er von seinem Körper losgelöst war und seine Seele irgendwo da oben schwebte. Es war schwierig genug, die Besessenheit dieser Schöpfung zu verstehen – der Schöpfung eines blinden Mannes. »Du bist schon sehr lange hier oben«, sagte Schloot schließlich. »Hast es geschafft, nicht begraben zu werden.«