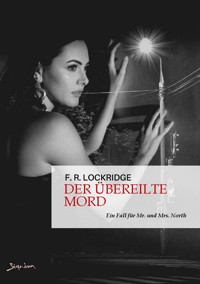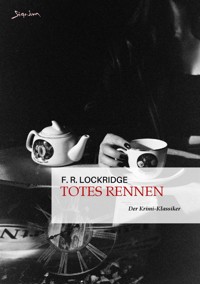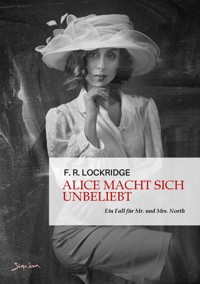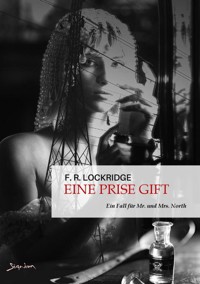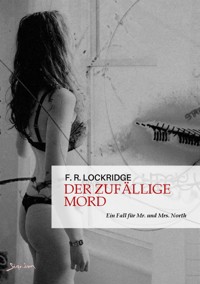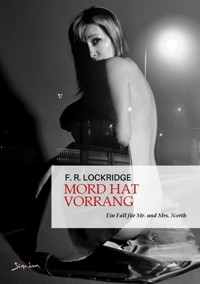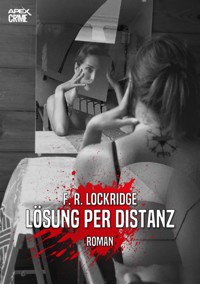5,99 €
Mehr erfahren.
Ein sonniger Nachmittag in New York...
Loren Hartley erwacht auf einer Bank im Park. Bestürzt stellt sie fest, dass in ihrer Erinnerung ein paar Stunden fehlen. Wo war sie? Was hat sie getan? Und was bedeuten die dunklen Flecken auf ihrem Mantel?
Die Antworten auf diese Fragen sind entscheidend für Loren. Denn während des verschwundenen Nachmittags wurde ihr reicher Onkel erstochen...
Der Roman Der gelbe Mantel von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1964; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1965.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
DER GELBE MANTEL
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER GELBE MANTEL
Die Hauptpersonen dieses Romans
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Das Buch
Ein sonniger Nachmittag in New York...
Loren Hartley erwacht auf einer Bank im Park. Bestürzt stellt sie fest, dass in ihrer Erinnerung ein paar Stunden fehlen. Wo war sie? Was hat sie getan? Und was bedeuten die dunklen Flecken auf ihrem Mantel?
Die Antworten auf diese Fragen sind entscheidend für Loren. Denn während des verschwundenen Nachmittags wurde ihr reicher Onkel erstochen...
Der Roman Der gelbe Mantel von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1964; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1965.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
DER GELBE MANTEL
Die Hauptpersonen dieses Romans
Lorie Hartley: Sekretärin.
Alice Jackson: ihre frühere Mitschülerin.
Alexander Hartley: Finanzmann.
Robert Campbell: Lories Vetter.
Dr. Peter Sayers: Rechtsanwalt.
Oscar Lanthrop: Rentner.
Bernard Simmons: Staatsanwalt.
Lieutenant John Stein: vom Morddezernat Manhattan-West.
Der Roman spielt in New York und Umgebung.
Erstes Kapitel
Ihr war entsetzlich heiß, und ihr Kopf schmerzte, als wolle er zerspringen. Das war das erste, was sie empfand, als sie aufwachte, dann ein scheußliches Schwindelgefühl. Ich bin eingeschlafen, dachte sie. Es muss... Ja, was?
Sie konnte sich an nichts erinnern. Es war, als träume sie immer noch einen verschwommenen, nebelhaften Traum. Alles entglitt sofort wieder, wollte sie es fassen. Sie versuchte zu denken: Ich träume, dass ich hier aufwache, benommen von der glühenden Sonnenhitze. Ich träume es nur, später, gleich werde ich richtig aufwachen, mich zwingen aufzuwachen, damit der Traum, der fürchterliche Traum ein Ende nimmt.
Sie schlug die Augen auf, und das Schwindelgefühl wurde so übermächtig, dass sie zu fallen fürchtete.
Sie lag auf einer Parkbank, fest an die Rückenlehne geklammert. Die Sonne stach unbarmherzig auf sie herab. Sie setzte sich auf, hob unwillkürlich die Hand vor die Augen, um sie vor der gnadenlosen Helligkeit zu schützen, und blieb einen Augenblick einfach so hocken. Dann ließ sie die Hand sinken, sah sich um und erkannte, wo sie sich befand. Im Bryant Park, unmittelbar hinter der Bibliothek. Auf der Bank gerade gegenüber, auf der anderen Seite des Weges, saß ein dicker Kerl. Den Mund halb offen, döste er im Sonnenschein vor sich hin. Er trug ein Sporthemd, am Hals weit offen, darüber einen Pullover.
Sie konnte an ihm vorbei, über die weiten Rasenflächen hinweg bis zur 40. Straße sehen. Sogar das hohe, schmalbrüstige Bürohaus war von hier aus zu erkennen.
Ich muss, überlegte sie, auf dem Nachhauseweg vom Büro aus durch den Park gegangen sein, vielmehr begonnen haben, den Park zu durchqueren, obwohl ich doch sonst gar nicht hier entlanggehe; ich muss mich hierher, auf diese Bank gesetzt haben und plötzlich eingeschlafen sein und mich im Schlaf ausgestreckt haben. Ja, so muss es gewesen sein. Eingeschlafen, wie der fette Mann dort drüben. Ein widerwärtiger Kerl; abstoßend hässlich, das Gesicht mit grauen Bartstoppeln überdeckt. Mir ist das alles unbegreiflich. Dass ich das getan haben soll! Ich muss krank sein. Ja, das wird es sein. Irgendetwas Furchtbares, Unerklärliches ist mit mir vorgegangen.
In einem Anfall von Verzweiflung hob sie beide Hände und bewegte die Finger, als schreibe sie auf einer unsichtbaren Schreibmaschine in der Luft. Die Finger gehorchten ihr, die Arme auch. Sie blickte auf ihre Beine, und sekundenlang fürchtete sie sich davor, sie zu bewegen. Dann versuchte sie es. Es ist kein Schlaganfall. Ich bin nicht gelähmt, dachte sie weiter.
Sie blickte auf ihre Armbanduhr. Zwanzig nach fünf. Zwanzig nach fünf am hellen Nachmittag. Ich muss fast zwei Stunden hier gelegen haben, überlegte sie weiter. Onkel Alex wollte so zeitig gehen, dass er bequem den Halb-Vier-Uhr-Zug nach Stamford erreichen konnte, um noch seine neun Löcher Golf zu spielen. Ich muss kurz nach ihm gegangen sein, und...
Nein, rief sie sich zur Ordnung, daran erinnere ich mich ja gar nicht. So hätte es gewesen sein können, so hätte es sein sollen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, nach dem Mittagessen ins Büro zurückgegangen zu sein.
Und dann fiel es ihr plötzlich wieder ein...
»Ich gehe heute etwas früher«, hatte ihr Onkel erklärt. »Du brauchst nachher nicht mehr zu kommen. Es ist nicht dringend, alles hat Zeit bis Montag.«
»Ich habe noch ein paar Briefe zu erledigen, besser ich schreibe sie, solange ich mein Stenogramm noch lesen kann«, hatte sie entgegnet.
Er hatte belustigt aufgelacht. Das könne sie halten, wie sie wolle, hatte er gemeint, aber nötig sei es wirklich nicht.
»Kommst du zum Wochenende nach Hause?«, hatte er dann noch wissen wollen. Und in ihr war der Anflug von Aufsässigkeit aufgeflackert, den sie so häufig verspürte, der unter der ruhigen Oberfläche ihres Empfindens sprungbereit auf der Lauer zu liegen schien. Für ihren Onkel war sie nicht sie selbst, nicht das Wesen aus Fleisch und Blut, das vor ihm stand. Für ihn war sie das kleine Mädchen, das er und Tante Harriet großgezogen hatten. Mit Liebe und – oh, unendlicher Fürsorge! Mit behutsamer, schützender Fürsorge; Fürsorge, die einen zu ersticken schien und die kompromisslos besitzergreifend war. Nach Hause kommen, zum Wochenende?
Zu Hause, das war ihre eigene kleine Wohnung. Zu Hause war, wo sie wohnte. Wo sie jetzt allein wohnte. Nicht das große Haus draußen in North Stamford, wo ein kleines Mädchen mit seinem Onkel und seiner Tante gelebt hatte, beide alt genug, um ihre Großeltern zu sein.
Es ist dumm, ja unfair, es jemandem zu verübeln, dass er einen liebt, sagte sie sich reuevoll an diesem Freitagnachmittag Mitte Juni. Liebe gleichzustellen mit Besitzergreifen, das waren Backfisch-Vorurteile. Inzwischen sollte sie wirklich darüber hinaus sein. Es lag wohl daran, überlegte sie, dass ich mich nicht wirklich gelöst, mich nicht ganz selbständig gemacht habe; dass ich zur Sekretärin ohne tatsächliche Aufgaben und Pflichten geworden bin. Diese Briefe, die sie nach Tisch noch schreiben wollte, waren ja im Grunde genommen gar keine Geschäftsbriefe. Dieses Büro – das prachtvolle, geschmackvoll ausgestattete Büro – war ja nichts anderes als eine fromme Selbsttäuschung ihres Onkels; der Strohhalm, an den er sich klammerte, weil es die einzige Brücke zu dem geschäftigen Leben um ihn herum bildete. Die Stellung, die er ihr bot, hatte er ihr doch nur gegeben, um sie in seiner Nähe zu halten. Es war so leer dort draußen in dem großen Haus, seit Tante Harriets Tod. Es war schon am besten für ihn, jeden Morgen mit dem Halb-Zehn-Uhr-Zug in die Stadt zu fahren und meist nachmittags um vier Uhr siebenundvierzig wieder zurück. So war er nicht völlig ausgeschlossen von allem, nicht abgekapselt in seinem großen, leeren Haus, wie in einem luftleeren Raum. Der Mensch braucht Luft zum Atmen. Nötig hatte er es nicht gehabt, zu arbeiten. Er hätte sich auch so jeden Wunsch erfüllen können.
»Ich weiß noch nicht, vielleicht komme ich«, hatte sie auf seine Frage geantwortet. »Kann ich dich morgen früh anrufen?«
»Nicht nötig«, hatte er erwidert. »Wenn du Lust hast, komm einfach.«
»Ich rufe in jedem Fall an«, hatte sie zurückgegeben, weil sie wusste, dass er es liebte, seine Zeit einzuteilen, Verabredungen festzulegen. »Wahrscheinlich komme ich. Aber ich melde mich vorher noch.«
Alexander Hartley war ein hochgewachsener Mann Ende Sechzig. Sein dichtes weißes Haar unterstrich noch seine frische Gesichtsfarbe, den sonnengebräunten Teint des Golfspielers, der halbe Tage an der frischen Luft verbringt. Hätte man ihn charakterisieren wollen, man hätte nicht lange zu überlegen brauchen, dachte sie mit einer gewissen Zärtlichkeit. Onkel Alex war Vorsitzender verschiedener Aufsichtsräte. Er war ein Mann, der seinen Geschäften in einem repräsentablen Büro nachging, und außerdem stand er als Vorsitzender jederzeit für Anfragen zur Verfügung.
Er hatte ihr wohlwollend zugenickt und damit gleichermaßen seiner Anerkennung für ihren Arbeitseifer Ausdruck gegeben, wie auch dem Dank für ihr halbes Versprechen, zu ihm hinauszukommen, oder wenigstens anzurufen.
»Stelle doch bitte die Klimaanlage an, bevor du gehst, ja?«, bat er.
Sie ging und ließ ihn hinter seinem Schreibtisch zurück. Als sie das Vorzimmer durchquerte, schaltete sie den Wärmeregler ein, und sofort ertönte das tiefe, gleichmäßige Summen der Anlage.
Es muss herrlich sein heute draußen auf dem Land, dachte sie. Wenn der Wetterbericht recht behält, wird es morgen noch heißer. Ich habe nicht das Geringste zu tun in der Stadt, überlegte sie weiter, außer heute Abend natürlich. Zu dumm, dass Peter ausgerechnet dieses Wochenende nach Washington musste. Und in Washington wird die Hitze noch viel unerträglicher sein. Armer Peter!
Sie zog den leichten Sommermantel über. Heute früh hatte sie noch geglaubt, dass sie ihn brauchte. Der Luftzug durch das offenstehende Schlafzimmerfenster war ziemlich kühl gewesen. Schon kurz darauf allerdings, als sie auf den Bus wartete, war ihr klargeworden, dass ihr der Mantel gegen Mittag ausgesprochen lästig sein würde, so leicht er auch war. Dabei liebte sie ihn sehr. Er war so fröhlich, mit seinem zarten und doch leuchtenden Gelb. Eigentlich geradezu frech, zumindest auffallend. Nun, jetzt war es jedenfalls immer noch bequemer, ihn anzuziehen, als ihn über dem Arm zu tragen.
Der einzige Lift des Bürohauses mit der schmalen Vorderfront war, wie immer freitags, gedrängt voll, als sie einstieg. Die Leute wirkten irgendwie ganz anders als sonst. Strahlende Mienen, eine gewisse gespannte Erwartungsfreude umgab Lorie. Als seien es völlig andere Menschen. Man konnte ihnen deutlich anmerken, dass für die meisten von ihnen das Wochenende bereits begonnen hatte. Immer wieder fiel ihr auf, wie sehr sich dieses alte Bürohaus von den meisten anderen großen, modernen in New York unterschied. Es ging darin weniger emsig, hastig, atemlos zu. Dem Gebäude und den Angestellten haftete eine gewisse Würde an. Ich bin einfach noch zu jung für eine solche ehrbare, gelassene Würde, dachte sie.
Sie wandte sich in Richtung der Fifth Avenue, der gelbe, leichte Mantel flatterte. Ungefähr auf der Höhe von Schrafft’s bog sie in die Fifth Avenue ein. Als sie eben die steinernen Löwen, diese beiden pompösen Dinger, erreicht hatte, hörte sie ihren Namen rufen.
»Lorie! Lorie Hartley!«
Eine Frauenstimme, vibrierend vor freudiger Überraschung.
Jetzt hatte die Frau sie erreicht. Lorie Hartley blieb stehen. Lächelnd wandte sie sich um.
Die Frau oder besser das junge Mädchen – sie musste etwa in Lories Alter sein – war klein und rundlich, um nicht zu sagen untersetzt. Ihre Wangen glühten, das blonde Haar bot mit dem winzigen darauf thronenden Blumenhütchen ein Bild vollkommenster Frisierkunst, mühevoll toupiert und jedes Löckchen sorgfältig auf seinen Platz gezupft und dort festgelackt. Die puppenhaften blauen Augen waren kugelrund vor begeistertem Entzücken.
Ich kenne sie gar nicht, habe sie noch nie im Leben gesehen!, dachte Lorie. Und dann, unglücklich: Dass mir das immer wieder passieren muss! Weshalb nur? Andere Menschen erinnern sich stets an alle Leute. Weshalb kann ich als einzige...
»Oh«, rief sie aus, »hallo!«
Die Munterkeit, die Begeisterung der Stimme fehlte. Sie wusste es. Es war ja immer das gleiche. Das erwartungsvolle, freudig erregte junge Mädchen – ganz offensichtlich aus einer Kleinstadt stammend – musste den falschen Eon heraushören. Erkennen, dass diese Wiedersehensfreude nur geheuchelt war. Und Lorie wusste auch schon, wie es weitergehen würde. Das erwartungsvolle Strahlen würde schlagartig verschwinden und stattdessen Verwirrung, ja Gekränktsein Platz machen. Das ist doch gar nicht meine Absicht, hätte Lorie dem Mädchen am liebsten gesagt. Ich kann einfach nicht anders. Es hat nicht das geringste mit Ihnen, mit dir, zu tun. Es bedeutet nicht, dass man gerade dich sofort vergisst. Es heißt ganz einfach, dass ich...
Das entzückte Strahlen schwand langsam aus den blauen Kinderaugen; das erwartungsvolle Lächeln verblasste.
»Du kannst dich nicht mehr an mich erinnern«, sagte das Mädchen enttäuscht.
Diesmal ist es besonders schlimm, quälte sich Lorie. Sie ist so rührend hilflos.
»Du hast keine Ahnung, wer ich bin«, stellte die junge Frau gekränkt fest.
Und plötzlich empfand Lorie bei allem Mitleid so etwas wie Gereiztheit. So wichtig war es denn nun doch auch wieder nicht, oder?
»Ich...«, setzte sie an.
»Alice Jackson«, fiel ihr das blauäugige Mädchen ins Wort. »Auf der Mittelschule. In Miss Dressers Klasse. Ich saß neben Kenny, dem hochaufgeschossenen Jungen. Dem, der solche Schwierigkeiten mit der Grammatik hatte.«
»Ach ja, natürlich!«, rief Lorie mit so viel Begeisterung, so viel Nachdruck wie ihr zur Verfügung stand, aus. Aber von Ach ja, natürlich, konnte gar nicht die Rede sein. Es sagte ihr nicht das geringste – weder der Name Alice Jackson noch Kenny, der Junge. Miss Dresser – ja, an Miss Dresser konnte sie sich deutlich erinnern. Eine unscheinbare, kleine, kugelrunde Person war sie gewesen, diese Miss Dresser. Mit einer ungestümen Liebe zur Poesie, besonders zu Longfellow, was die Kinder als schrecklich lächerlich empfunden hatten.
»Alice Jackson«, wiederholte Lorie noch einmal – mit der Betonung auf Jackson – und hoffte, es klänge so, als sei sie sich nur vorübergehend nicht ganz im Klaren gewesen, welche von den vielen Alices hier vor ihr stand.
Als sie das erwartungsvolle Entzücken langsam in das hübsche, ihr nach wie vor vollkommen unbekannte Gesicht zurückkehren sah, fiel Lorie ein Stein vom Herzen.
»Ich wusste es doch, dass du dich erinnern würdest«, seufzte Alice Jackson beseligt. »Mein Gott, was haben wir damals für Spaß miteinander gehabt, wie?«
Wer hätte das nicht gehabt! Die Schulzeit war eine bunte Kette von Ängsten und tausenderlei Späßen gewesen.
»Ich wette, du rätst niemals, wem ich heute früh schon in die Arme gelaufen bin«, plapperte Alice Jackson eifrig weiter. »Wer heute Mittag zu mir in meine Wohnung zum Essen kommen wird.«
Lorie tat ihr Bestes, gespannt auszusehen. Nun, da sie einmal damit angefangen hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als die Komödie fortzusetzen.
»Bertha Mason!«, jubelte Alice Jackson triumphierend. »Du erinnerst dich doch an Bertha?«
Das war keine Frage, das war eine Feststellung. Und diesmal hatte Alice sogar recht. Lorie Hartley, die hier im sengenden Sonnenschein vor den beiden pompösen Steinlöwen auf der Fifth Avenue stand, und sich mit einer jungen Frau unterhielt, die sie nie zuvor gesehen hatte, erinnerte sich lebhaft an Bertha Mason. Ein großes, mageres Mädchen, dessen Gesicht niemals ruhig war, ein Mädchen, das Miss Dresser mit ihrem Longfellow-Fimmel in einer Art und Weise imitieren konnte, dass Lorie und alle Mitschüler sich den Bauch gehalten hatten vor Lachen. Ein Mädchen, das seinen Vornamen hasste, aber einen atemberaubenden Zirkus aus diesem Widerwillen gegen ihren Namen zu machen verstand.
»Sie ist Schauspielerin geworden«, erklärte Alice Jackson. »Nun, das war ja vorauszusehen, nicht?«
»Ja, sie hat ja immer schon davon geredet, dass sie zur Bühne gehen wollte«, antwortete Lorie. »In allen Schulaufführungen spielte sie die Hauptrolle und...«
»Die kommende Monroe«, fiel ihr Alice Jackson ins Wort. »Sagte das Jahrbuch damals schon. Weißt du noch? Und sie hat sich kein bisschen verändert. Oh, ich meine, irgendwie haben wir uns natürlich alle verändert. Ich jedenfalls, darüber bin ich mir im Klaren. Kein Wunder, dass du mich nicht auf Anhieb wiedererkannt hast. Sei ehrlich, das hast du doch nicht, oder?«
»Nun, im ersten Augenblick nicht«, gab Lorie zu.
»Ich bin Lehrerin geworden«, fuhr Alice Jackson fort. »Hättest du das für möglich gehalten?«
Weshalb nicht? Das ebenso gut wie alles andere, dachte Lorie.
»In Sandusky«, sagte Alice. »Sandusky, Ohio. Eins von diesen Nestern, wo man immer den Staat dazu sagen muss. Jetzt bin ich hier, weil ich bei Dyckman einen Sommerkurs belegt habe. Und, stell dir vor, ich habe das wonnigste kleine Appartement gefunden, das du dir nur denken kannst. Gar nicht weit von hier – Lorie!«
Offensichtlich war Alice eben ein überwältigender Einfall gekommen.
»Ich habe dir doch erzählt, dass Bertha Mason zum Mittagessen zu mir kommt«, platzte sie atemlos vor Eifer heraus. »Willst du nicht auch kommen? Du und sie, ihr wart doch so befreundet! Es wäre – oh, eine regelrechte Wiedersehensfeier! Bitte, sag, dass du kommst!«
Was blieb Lorie schon anderes übrig. Trotzdem zögerte sie.
»Ich...«, begann sie, das Wort endlos dehnend.
»Wirklich, es ist gleich um die Ecke«, bat Alice hastig. Aus den großen und, wie Lorie bei sich fand, kindlich unschuldigen blauen Augen sprach eine flehentliche Erwartung, die stärker war als alle Worte. »Bitte, Lorie.«
»Ich arbeite, weißt du«, setzte Lorie an, aber Alice ließ sie nicht zu Ende sprechen.
»Du wolltest jetzt doch gerade essen gehen, nicht wahr?«, drängte sie weiter.
Lorie nickte ergeben.
»Na also!«, seufzte Alice im Ton tiefster Befriedigung. Sie war offenbar unendlich stolz, den schwachen Punkt in Lories Abwehr getroffen zu haben. Lorie kam diese Begeisterung ziemlich übertrieben vor. »Wenn du mit zu mir kommst, brauchst du auch nicht länger, als wenn du in ein Restaurant gehst«, fuhr Alice eifrig fort. »Es kostet dich keine Minute. Ich habe schon alles im Kühlschrank fertig stehen.«
Darauf wäre Lorie jede Wette eingegangen. Es würde einen Salat geben, mit Obst darin und Schlagsahne obenauf. Voll Entsetzen sah sie schon die Bananenscheibchen vor sich, wo sie Banane doch gar nicht mochte! Lächerlich, jetzt an so etwas zu denken! Manchmal fand sich Lorie selbst unausstehlich. Nachdem sie Alice anfangs so gekränkt hatte, war sie es ihr einfach schuldig, nett zu ihr zu sein. Eine alte Freundin aus der Schulzeit, verloren in dieser riesigen Stadt. Sie war irgendwie rührend hilflos in ihrem Bemühen, menschliche Nähe, Wärme, Anschluss an jemanden, den sie kannte, zu finden. Eine Stunde etwa... Eine Stunde, was bedeutete das schon? Für Lorie so wenig, für die andere so viel.
»Und«, drängte Alice weiter, »freust; du dich nicht, Bertha wiederzusehen? Es ist so lustig, mit ihr zusammen zu sein, sie ist immer so vergnügt und steckt voller Späße. Ihr wart doch auf der Schule befreundet! Fast das erste, wonach sie sich erkundigte, war, ob ich jemals wieder etwas von Lorie Hartley gehört hätte. Ich musste verneinen. Und jetzt – kaum ein paar Stunden später – ist es nicht ein toller Zufall?«
Das sicher, fand Lorie, in gewisser Weise schon.
Außerdem, überlegte sie, würde es interessant sein, zu sehen, wie sich Bertha Mason in den dazwischenliegenden Jahren wohl verändert hatte, und in den Augen einer ehemals engen Freundin abzulesen, wie man selbst sich in der gleichen Zeitspanne verändert hatte. Ob Bertha Mason sie überhaupt wiedererkennen würde?
»Ich muss aber anschließend ins Büro zurück«, sagte Lorie. »In – in einer Stunde muss ich wieder dort sein.«
Die letzte Hintertür, die sie sich offenhielt.
»Dann komm!«, forderte Alice sie in entschlossenem Ton auf. Gleichzeitig eilte sie zur Ecke und fuchtelte mit beiden Armen wild in der Luft herum. Das Winken hatte Erfolg, ein Taxi fuhr an den Bordstein und hielt. Und mit dem Taxi war die Sache entschieden.
Gleich um die Ecke, wie Alice behauptet hatte, war allerdings reichlich untertrieben. Sie kurvten um Ecken, Ecken und nochmals Ecken. Endlich, in der 30. Straße, in der Nähe der Madison Avenue, waren sie am Ziel, im Murray Hill Bezirk – der Erfüllung von Alices Träumen. Es war ein altes, dem langsamen Verfall preisgegebenes Haus, in dem sich offenbar sowohl Büros als auch Wohnungen befanden. Die Tür des Selbstbedienungsliftes schloss sich automatisch hinter ihnen, so hastig, dass es Lorie vorkam, als schnappe er gierig nach ihnen. Alice drückte den Knopf mit der kleinen weißen Acht. Der Fahrstuhl hielt, die Tür glitt lautlos und rasch zur Seite.
»Das Ding reagiert immer so verteufelt schnell!«, bemerkte Alice noch und trat eilig hinaus auf den Flur. Unmittelbar hinter Lorie klappte die Tür wieder zu.
Während sie den Flur hinuntergingen, überlegte Lorie sich, dass Alice es mit großem Geschick fertiggebracht hatte, eine Wohnung zu finden, die so weit wie nur möglich von der Dyckman-Universität entfernt lag. Natürlich, Lorie gab sich keinen Täuschungen darüber hin, dass Untermieter es sich nicht leisten konnten, wählerisch zu sein. Aber trotzdem merkwürdig.
»Gott sei Dank!«, seufzte Alice erleichtert. »Ich hatte schon Angst, Bertha könnte vor uns gekommen sein und hätte warten müssen.«
Vor einer Tür blieb sie stehen, und Alice kramte den Schlüssel aus der Tasche. In einem kleinen Metallrahmen steckte ein Zettel, auf dem in Maschinenschrift Alices Name stand. Alice Jackson.
Das Appartement war winzig. Ein schmales, schlauchartiges Wohnzimmer, mit einer Tür an jedem Ende. Durch das gegenüberliegende Fenster blickte Lorie auf nichts als Häusermauern. Ein dünner Sonnenstrahl lag auf dem Fensterbrett. Kaum hatte sie ihn bemerkt, war er schon wieder verschwunden.
»Es ist so aufregend, in New York zu sein!«, rief Alice begeistert aus. »Du ahnst ja gar nicht, wie ich dich beneide. Wo wohnst du denn?«
»In der Innenstadt«, antwortete Lorie.
»Nicht draußen, im Villenviertel?«, fragte Alice mitleidig. »Oh, ich habe gesucht und gesucht, bis ich endlich hier etwas gefunden habe.«
»In der zehnten Straße«, ergänzte Lorie.
In der obersten Etage eines vornehmen Hauses, das in einer Reihe gleich untadeliger Häuser stand. Nicht in einem altmodischen Dachkämmerchen. Aber wozu dieser begeisterten jungen Frau aus Sandusky unnötigen Kummer zufügen, mit der sie, wie sich herausgestellt hatte, einmal in Stamford gemeinsam die Schulbank gedrückt hatte. Gar nicht so weit von New York entfernt, wirklich nicht weit. Ich, überlegte Lorie, war als Kind häufig in New York. Hat Ohio es vermocht, so rasch alle Erinnerungen auszulöschen, so provinzlerisch zu machen?
»Was studierst du denn auf der Dyckman-Universität?«, erkundigte sich Lorie.
»Ach, so allerlei«, erwiderte Alice. »Dies und das. Wenn ich mit einem Titel nach Hause komme, erhalte ich einen bedeutend besseren Posten. Ich habe Bertha doch gesagt, um halb eins. Hoffentlich ist sie nicht aufgehalten worden, oder was weiß ich. Du, was hältst du davon?«
Es war bereits zwanzig vor eins.
»Trinken wir doch inzwischen etwas, während wir warten«, schlug Alice vor. »Magst du?«
Lorie mochte ganz und gar nicht. Und sie setzte bereits an, dies zu sagen, schwieg dann aber doch. Immer noch unter dem Druck eines gewissen Schuldgefühls stehend, dem inneren Zwang, entgegenkommend zu sein zu dieser alten Schulkameradin, die sie dadurch betrübt hatte, dass sie sie nicht sofort wiedererkannt hatte, wollte Lorie sie nicht bereits wieder aufs Neue kränken. Alice hielt es für großartig, jetzt einen Aperitif zu nehmen. Die Lehrerin aus Sandusky gab sich genussvoll ihrer Vorstellung von der großen Welt hin, berauschte sich an New York. Aber allein genossen, war alles im Leben nur ein halber Genuss.
»Schrecklich gern«, sagte Lorie also. »Aber für mich, bitte, einen mit wenig Alkohol. Vergiss nicht, ich muss ja nachher noch ins Büro.«
Und zwar so bald als möglich. Lorie war fest entschlossen. Es war ein Fehler gewesen, hierher mitzukommen; alles war ein einziger großer Fehler, von Anfang an. Und dass Bertha noch immer nicht auftauchen wollte, machte es nur noch schlimmer. Worüber sollte sie bloß reden? Es gab keine gemeinsamen Gesprächsthemen zwischen ihnen.
»Eine Bloody Mary?«, fragte Alice. »Ist das recht? Wodka und – aber was erzähle ich dir das, du weißt es ohnehin besser als ich.«
»Herrlich, genau das richtige«, dankte Lorie.
Mit ungraziösen Bewegungen verschwand Alice durch eine der Türen. Man hörte die Kühlschranktür klappen, Eiswürfel klirren, die üblichen Geräusche.
Lorie sah sich inzwischen um. Der Raum war klein, vollgestopft mit Möbeln, dabei völlig unpersönlich. Eigentlich ähnelte er einem Hotelzimmer, fand Lorie. Er hatte einfach keinen persönlichen Stil, nichts, was auf seine Bewohnerin hinwies oder die Gemütlichkeit des Benutzten ausströmte, die Wärme liebevoll gesammelter Dinge. Er stand ganz einfach in keinerlei Beziehung zu seiner Bewohnerin. Die Wohnungseigentümer hatten alle persönlichen Gegenstände weggeräumt, bevor sie in die Sommerferien fuhren, was man ihnen schließlich nicht verübeln konnte, und Alice hatte wohl noch keine Zeit gelebt, sich wirklich einzurichten. Falls es ihr überhaupt gelang...
»So, endlich!«, seufzte Alice erleichtert, als habe sie eine schwierige Arbeit glücklich zu einem befriedigenden Abschluss gebracht.
Sie balancierte ein Tablett in der Hand, auf dem zwei große Gläser mit einer roten Flüssigkeit standen.
»Dieser Büchsenöffner ist ein derart kompliziertes Patent! Du hast sicher schon geglaubt, ich käme gar nicht mehr wieder. Hoffentlich habe ich nicht zu viel Worcester-Sauce hineingegeben.«
»Nein, es schmeckt ausgezeichnet«, meinte Lorie beruhigend, nachdem sie einen Schluck gekostet hatte.
Dabei schmeckte das Zeug abscheulich. Natürlich war zu viel Worcester-Sauce darin. Zuviel davon, oder von irgendetwas anderem.
»Wirklich ausgezeichnet. So, und nun erzähle mir, wie ist es in Sandusky? Lebst du gerne dort?«
Zweites Kapitel
Soweit kann ich mich erinnern, grübelte Lorie, während sie elend auf ihrer Bank im Bryant Park saß. Aber dann – was war dann geschehen?
Was dann geschehen war, darüber konnte wohl wenig Zweifel bestehen, dachte Lorie. Und bei diesem Gedanken wurde ihr noch elender, ihr Gefühl beschämter Verwirrung nahm noch zu. Sie musste diese eine Bloody Mary ausgetrunken haben, dann noch eine – und noch etliche. Bertha Mason war schließlich doch noch erschienen, und Alice hatte ihre Gläser aufs Neue gefüllt. Wir müssen uns unterhalten und dabei weiter getrunken haben, ohne auf die Wirkung zu achten. Aber ich trinke doch sonst nicht, nie! Nicht einmal auf Partys, mögen sie noch so lustig sein. Ich mag Leute nicht, die zu viel trinken. Aber heute muss ich zu viel getrunken haben. Der Faden ist mir einfach gerissen – völlig gerissen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Mir bleibt einfach eine Zeitspanne, die ich nicht unterbringen kann. Und jetzt sitze ich hier auf einer Parkbank in der Sonne, beobachte den fetten Mann dort auf der Bank gegenüber, der ganz so aussieht, als hätte er zu viel getrunken und schliefe nun hier seinen Rausch aus. Genau wie ich!
Der Faden muss mir ganz plötzlich gerissen sein, überlegte sie weiter. Ich kann mich ja nicht einmal mehr erinnern, wann Bertha gekommen ist. Aber gekommen sein muss sie ja, denn allein hätte ich niemals dort herumgesessen, getrunken und geredet – Himmel, worüber wohl – mit diesem Mädchen, an das ich mich nicht einmal jetzt erinnern kann. Ich würde doch wiederholt haben, dass ich ins Büro zurückmüsste, würde diese Alice Jackson gebeten haben, Bertha meine herzlichsten Grüße. zu bestellen, wenn sie käme, und...
Bertha musste gekommen sein. Wir müssen herumgesessen und uns stundenlang unterhalten haben. Ja, so muss es sich abgespielt haben. Das ist zwar keine Entschuldigung für mich, aber es wäre doch zumindest eine Erklärung. Was müssen die beiden nur von mir denken; wie werden sie mich verachten!
Oder vielleicht ist es doch nicht ganz so schlimm, dachte Lorie. Ich kann ja nicht so offensichtlich betrunken gewesen sein, sonst hätten sie sich doch meiner angenommen... Bertha hätte das bestimmt getan. Man konnte – ja, man konnte früher mit ihr Pferde stehlen; sich hundertprozentig auf sie verlassen. Sicher, damals ging es natürlich nicht um so scheußliche Dinge, wie das, was mir heute zugestoßen ist, aber... Nein, sie würde mich niemals allein haben fortgehen lassen, wenn man mir angemerkt hätte, dass ich derart betrunken war. Ich muss also allein dort weggegangen sein, einen noch halbwegs nüchternen Eindruck gemacht haben. Ich muss versucht haben, ins Büro zurückzugehen, aber nicht so weit gekommen sein, nur bis hierher. Oder noch anders: Ich muss unterwegs gemerkt haben, dass etwas mit mir nicht stimmt. Nicht stimmt, das klingt immer noch besser, als würde ich sagen, dass ich betrunken war. Ich muss mich hier für einen Augenblick hingesetzt haben, weil ich hoffte, dass mein Schwips verfliegen, mein Kopf wieder klar werden würde.
Es war sinnlos, hier noch länger halbbenommen in der glühenden Hitze herumzusitzen und zu grübeln. Ebenso unsinnig war es, jetzt noch ins Büro zu gehen. Onkel Alex war ohnehin nicht mehr dort, er musste vor gut zwei Stunden schon seinen Zug nach Stamford genommen haben. Ihm würde es nichts ausmachen, dass sie nicht noch einmal zurückgekommen war; er hatte ihr ja selbst vorgeschlagen, den Nachmittag freizunehmen. Aber es würde ihn ärgern, dass sie, nachdem sie anfangs so darauf bestanden hatte, ihre Arbeit heute noch zu erledigen, nicht einmal angerufen hatte, dass sie nun doch nicht mehr kam. Er würde ihr den Vorwurf machen, dass sie unzuverlässig sei.
Ob es möglich ist, zermarterte sie sich weiter den Kopf, dass ich ihn angerufen habe und – was? Ihm gesagt habe, dass ich leider zu betrunken sei, um zurückzukommen? Oder dass ich einer alten Schulkameradin begegnet sei, und deshalb, falls er nichts dagegen hätte, die Briefe gern bis Montag liegenlassen würde? Kann es sein, dass es sich so abgespielt hat, und dass ich mich einfach nicht mehr daran zu erinnern vermag?
Alles ist möglich, dachte sie. Das ist ja gerade das... das Grauenhafte an der Sache. Von kurz vor eins bis kurz nach fünf erinnere ich mich an überhaupt nichts. Ich könnte während dieser Zeitspanne alles getan haben. Einfach alles. Es ist sinnlos, dachte sie, noch länger hier herumzusitzen. Ich habe immer noch Kopfschmerzen, aber ich bin wenigstens nicht mehr benommen. Ich werde jetzt nach Hause gehen und eine kalte Dusche nehmen. Vielleicht kann ich damit alles von mir abspülen. Dann werde ich mir einen starken Kaffee aufbrühen und Onkel Alex in Stamford anrufen, ihm sagen – ihm irgendetwas zu sagen. Ich...
Sie stand auf und warf einen letzten Blick auf den fetten Mann, der schlafend auf der gegenüberliegenden Bank saß. Dann ging sie durch den Park bis zur 42. Straße, diese entlang, bog in die Fifth Avenue ein und bestieg dort einen Bus in Richtung Washington Square. Im Bus saß sie sehr gerade und aufrecht, während sie in Gedanken alles Punkt für Punkt immer wieder durchging. Aber es blieb dabei: Der Faden war ihr tatsächlich gerissen, sie konnte sich an einen Teil des Nachmittags einfach nicht mehr erinnern.
Sie schloss ihre Wohnungstür auf und trat ein. Während sie den Schlüssel in die Handtasche zurücksteckte, bemerkte sie den Zettel; einen glatten, kleinen Zettel. Sie zog ihn heraus. Es war eine Telefonnummer darauf notiert. Und vor der Nummer standen zwei Buchstaben, ein A und ein J. Sie musste – weshalb bloß – Alice um ihre Telefonnummer gebeten haben. Und diese hatte sie ihr aufgeschrieben. Weshalb konnte sie nur darum gebeten haben? Alices Nummer? Wahrscheinlich hatte sie etwas von in Verbindung bleiben gesagt; so wie man es alle Tage hinsagt, ohne sich etwas dabei zu denken, ohne es wirklich zu meinen. Oder hatten sie etwa eine Verabredung miteinander getroffen? Eine Verabredung, die telefonisch noch genauer festgelegt oder bestätigt werden sollte? Sie hatte keine Ahnung. Keine Ahnung, was sich zwischen kurz vor eins und kurz nach fünf ereignet hatte.
Sie zog den auffallenden gelben Mantel aus und warf ihn auf einen Stuhl. Dort lag er, ein jämmerliches, zusammengeschrumpftes Etwas, nicht mehr im Geringsten auffallend. Nachdem sie ihre feuchten Sachen ausgezogen hatte, duschte sie, lange und mit Genuss. Sie ließ das kalte Wasser an sich herabströmen, versuchte ihren Körper zu reinigen, die wohltuende Kühle in ihn eindringen zu lassen, sich gründlich zu erfrischen. Jetzt war ihr wohler. Sie ging in die Küche, gab Eiswürfel in ein hohes Glas, schüttete Kaffeepulver darauf, ließ das Glas voll Wasser laufen und rührte kräftig um. Es war kalt und bitter, aber half, oder schien zumindest zu helfen. Ihr Kopf wurde klarer. Die dumpfen, bohrenden Schmerzen ließen nach. Dennoch blieb der Nachmittag ein einziges großes, leeres Loch.
Sie nahm das Glas Eiskaffee mit hinüber zum Telefon und wählte die Nummer ihres Onkels draußen in Stamford. Charles meldete sich.
»Ich bedaure, Miss Lorie«, sagte Charles. »Mr. Hartley ist im Club. Er sagte, es könne ziemlich spät werden heute. Tut mir leid, Miss Lorie.«
Es war albern von ihr gewesen, so früh anzurufen. Achtzehn Löcher war das übliche, was er spielte, und anschließend nahm er ein, zwei Drinks. Niemand hat es eilig, nach Hause zu gehen in ein leeres Haus.
»Sagen Sie ihm bitte, ich hätte angerufen«, bat sie.
»Natürlich, Miss Lorie«, antwortete Charles. »Dürfen wir Sie für das Wochenende hier draußen erwarten?«
»Ich weiß noch nicht«, gab sie zurück. »Ich rufe morgen früh noch einmal an.«
»Danke, Miss Lorie«, sagte er.
Der gelbe Mantel lag immer noch als unordentliches Bündel auf dem Stuhl. Ich betrinke mich am hellen Nachmittag, dachte sie; ich werfe mit meinen Sachen herum wie eine Schlampe, ja, das ist es. Das ist das richtige Wort, dachte sie gehässig.
Sie hängte ihren Mantel auf den Bügel, sehr sorgsam, betont ordentlich. Sie tat dasselbe mit dem Kleid, das sie den Tag über getragen hatte und steckte die Unterwäsche in den Korb. Das nasse Badehandtuch lag noch auf dem Fußboden, sie nahm es auf und glättete es über der dafür bestimmten Stange, nachdem sie es vorher einmal genau in der Mitte gefaltet hatte. Ich muss aufräumen, gründlich aufräumen, dachte sie dabei. Auch in mir selbst, in meinem Kopf.
Ich bin Lorie Hartley – heute haben wir Freitag, den fünfzehnten Juni. Ein Sechstel dieses Freitags, des Fünfzehnten, habe ich verloren, über ein Sechstel weiß ich nichts. Und dann fiel ihr mit Schrecken ein, sie war ja zum Abendessen eingeladen! Fieberhaft suchte sie nach ihrer Uhr, natürlich, dort lag sie ja, dort, wo sie sie hingelegt hatte, bevor sie duschte – in einer halben Stunde würde Robert Campbell kommen, um sie zum Essen abzuholen.
Er würde pünktlich sein. Lorie kannte ihn zwar erst seit ein paar Wochen, aber so gut kannte sie ihn schon, um das zu wissen. Er hatte gesagt, um halb acht. Heute etwas später, falls er noch im Büro aufgehalten werden sollte. Pünktlich um halb acht, auf die Sekunde, würde er an der Tür klingeln.
Ich kann heute nicht ausgehen, dachte sie. Ich kann einfach nicht. Aber dann fiel ihr ein, dass es schon zu spät sei, um noch abzusagen. Das kann ich unmöglich tun. Ich habe heute schon so viel Unmögliches getan.
Sie zog ein weißes, ärmelloses Kleid an und schminkte sich mit großer Sorgfalt. Bob Campbell, dachte sie benommen, er ist ja ein Vetter von mir. Zweiten Grades, glaube ich. Mein Vater und Onkel Alex hatten eine Schwester. Sie heiratete einen Mann namens Campbell und hatte einen Sohn namens Robert, und dieser Robert ist ihr Enkelsohn – Robert Campbell junior. Also ist er eigentlich gar kein Vetter von mir, er ist schon die nächste Generation, dabei ist er älter als ich. Etliche Jahre älter. Er ist Junggeselle und hat eine Schwester namens – an ihren Namen kann ich mich nicht mehr erinnern.