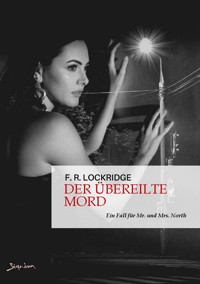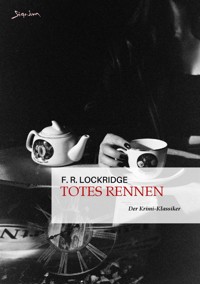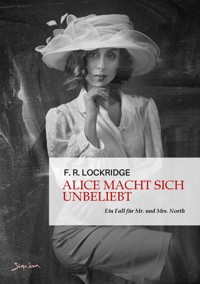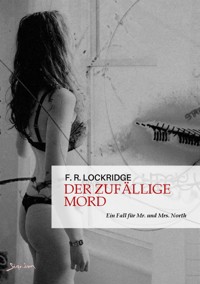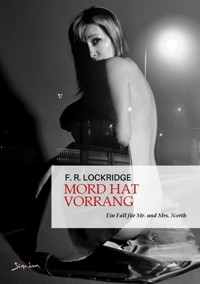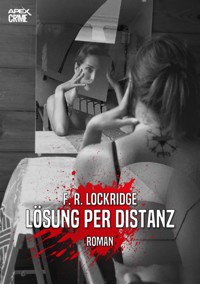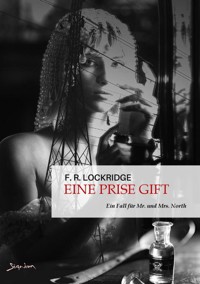
6,99 €
Mehr erfahren.
Am nächsten Morgen erinnerte er sich an diesen Gedanken mit dem ehrfürchtigen Schauder eines Menschen, den ein außergewöhnliches Schicksal im Vorübergehen berührt hat. Er erinnerte sich daran, während er an Roses Bett saß und ihr wieder und wieder seine Fahrt beschrieb, bis er das letzte Quäntchen Drama herausgepresst hatte. Und Rose, die so blass und krank aussah, die aber, wie die Ärzte sagten, wieder ganz gesund werden würde, Rose blickte aus den Kissen voll Bewunderung zu ihm auf, wie zu einem Helden, der nach bestandenem Abenteuer zurückgekehrt war. Als er sie ansah, verstummte Max nach einem Augenblick, dann nahm er ihre Hand. Sie lag warm und lebendig in der seinen. Er drehte sie um und strich vorsichtig mit dem Daumen über das Handgelenk, bis er den gleichmäßigen Pulsschlag spürte. Plötzlich war ihm, als habe er etwas sehr Wichtiges zu sagen...
Der Roman Eine Prise Gift von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1948; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1962.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
EINE PRISE GIFT
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
EINE PRISE GIFT
Die Hauptpersonen dieses Romans
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Das Buch
Am nächsten Morgen erinnerte er sich an diesen Gedanken mit dem ehrfürchtigen Schauder eines Menschen, den ein außergewöhnliches Schicksal im Vorübergehen berührt hat. Er erinnerte sich daran, während er an Roses Bett saß und ihr wieder und wieder seine Fahrt beschrieb, bis er das letzte Quäntchen Drama herausgepresst hatte. Und Rose, die so blass und krank aussah, die aber, wie die Ärzte sagten, wieder ganz gesund werden würde, Rose blickte aus den Kissen voll Bewunderung zu ihm auf, wie zu einem Helden, der nach bestandenem Abenteuer zurückgekehrt war. Als er sie ansah, verstummte Max nach einem Augenblick, dann nahm er ihre Hand. Sie lag warm und lebendig in der seinen. Er drehte sie um und strich vorsichtig mit dem Daumen über das Handgelenk, bis er den gleichmäßigen Pulsschlag spürte. Plötzlich war ihm, als habe er etwas sehr Wichtiges zu sagen...
Der Roman Eine Prise Gift von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1948; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1962.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
EINE PRISE GIFT
Die Hauptpersonen dieses Romans
Gerald »Jerry« North: ein New Yorker Verleger.
Pamela »Pam« North: seine Frau.
Captain William Weigand: vom Morddezernat der Kriminalpolizei.
Dorian Weigand: seine Frau.
Sergeant Aloysius Mullins: sein Assistent.
Lois Winston: Volontärin.
Randall »Buddy« Ashley: ihr Halbbruder.
Dave McIntosh: Kaufmann.
John Graham: Prokurist.
Margaret Graham: seine Frau.
Michael: ihr Sohn.
Erstes Kapitel
Dienstag, 28. Juli, 16.50 bis 17.30 Uhr
Max Fineberg saß auf dem Trittbrett und spürte die Julihitze auf seinen Schultern. An diesem Nachmittag lastete die Hitze auf allem; wie eine feuchte, dampfende Bürde lag sie über der Stadt New York. Die Luft war leicht dunstig, doch die Sonne stach mit unverminderter Kraft hindurch. Hitzewellen flimmerten über dem glänzenden Verdeck von Max Finebergs Taxi und wurden von den Fensterscheiben auf der anderen Straßenseite zurückgeworfen.
Max Fineberg hatte den Kopf in die Hände gestützt. Er war bekümmert und niedergeschlagen. Er wünschte, er wäre jetzt woanders, hätte einen anderen Job. Er wünschte, es würde ihm jemand sagen, wie er die nächste Rate für sein Taxi bezahlen sollte und wie es Rose in der Klinik ging, und dass ihm sein Lehrer in der Handelsschule, wo er bis vor kurzem die Abendkurse besucht hatte, erklären würde, was ein Taxifahrer mit einem Dollar fünfzehn auf der Uhr nach zehn Arbeitsstunden anfangen sollte.
Auf diese letzte Frage gab es, so nahm er an, wohl nur eine Antwort: die Nacht durcharbeiten und sich zu diesem Zweck als erstes einen neuen Standplatz suchen. Die Idee, sich hier aufzustellen, war wirklich nicht sehr glücklich gewesen, so gut sie ihm auch vor zwei Stunden erschienen war. Er hatte sich gewundert, dass keiner seiner Kollegen auf den Gedanken gekommen war, hier zu warten, an der Endstation einer Autobuslinie, auf der nur in größeren Abständen Busse verkehren und wo manch ein erledigter, müder Fahrgast doch gewiss gern den Differenzbetrag bezahlen würde, um sich rasch mit dem Taxi zur nächsten U-Bahnstation bringen zu lassen.
Jetzt wunderte er sich nicht mehr; es gab keine erhitzten, müden Fahrgäste, oder zumindest keine, die genügend Geld für ein Taxi übrighatten. Am besten fuhr er wieder zur U-Bahnstation, wo wenigstens etwas Betrieb war. Max stand auf und ging ohne Begeisterung um den Wagen herum. Nun kam eine Frau den sonnenbeschienenen Bürgersteig entlang, und Max fühlte eine leise Hoffnung in sich aufsteigen. Er stellte sich neben den Wagen und versuchte alles möglichst einladend erscheinen zu lassen.
Er versuchte auch selbst eine einladende Haltung einzunehmen, indem er ein bisschen gerader stand, als ihm eigentlich zumute war, und lächelte, wie ein guter Geschäftsmann lächeln sollte. Er bemühte sich, die Müdigkeit aus seiner Stimme zu verbannen, als er sagte: »Taxi, die Dame?« Dabei legte er die rechte Hand auf den Türgriff und begann auffordernd die Tür zu öffnen.
Die Dame schien ihn nicht zu sehen, und Max’ Hoffnung schwand. Aber, lieber Himmel, irgendwann musste er ja eine Fahrt bekommen!
»Taxi, Miss?«, wiederholte er hartnäckig. »Es ist hübsch heiß, um zu Fuß zu gehen, nicht?«
Das klang schon eher nach einem jungen Mann, der zwei Jahre lang die Handelsschule besucht hatte und, wenn alles geklappt hätte, vielleicht ein guter Geschäftsmann geworden wäre. Jedenfalls hoffte es Max. Und tatsächlich, die Dame blieb stehen und sah Max an. Max lächelte wieder sein gewandtes Verkaufslächeln. Ihm wurde bewusst, dass es unter anderen Umständen leicht wäre, ihr zuzulächeln wie – nun, wie Max Fineberg, wer auch immer das war. Wie der Max Fineberg, der so gerne... Die junge Dame unterbrach seinen Gedankengang, indem sie erklärte, ja, das finde sie auch, und er möchte sie bitte zur nächsten U-Bahnstation bringen.
Es war besser als nichts, dachte Max, während er ihr die Tür aufhielt. Er ging um den Wagen herum zu seinem Sitz und ließ den Motor an. Nachdem er das Schild mit der Aufschrift Frei heruntergeklappt hatte, drehte er sich zu der jungen Dame um und fragte, ob er das Verdeck herunterlassen solle.
»Nein«, sagte sie, »lassen Sie nur. Es ist mir ganz gleich!«
Ihre Stimme klang fast so, wie ihm zumute war, dachte Max, während er anfuhr. Nicht, dass sie den geringsten Grund dazu gehabt hätte – nicht mit diesen Kleidern und allem. Max wusste genau, wie Frauenkleider aussehen sollten. So oft er konnte, fuhr er mit seinem Wagen an den großen Modegeschäften der Fifth Avenue entlang und betrachtete die Schaufenster, während er nach Fahrgästen Ausschau hielt.
Ja, die Kleider der jungen Dame hier kamen aus solchen Schaufenstern. Man sah den Unterschied genau, vor allem, wenn man seit ein paar Jahren verheiratet war und jemanden hatte, der einen auf solche Details aufmerksam machte. Man sah es auch an der Art, wie die Leute sich hielten, und an der Gesichtsfarbe und, vor allem bei Frauen, an ihrem Haar. Die Frisur seines jetzigen Fahrgastes zum Beispiel stammte aus einem guten Salon. Diese Dame hier gehörte nicht zu den Leuten, die zu müde werden und sich fragen, wie sie die nächsten Raten bezahlen sollen. Sie gehörte zu denen, die Glück gehabt hatten. Wenn sie wollte, könnte sie sich von ihm bis dorthin bringen lassen, wo sie hinwollte, selbst wenn das halbwegs drüben in Riverside war, ohne dass es ihr etwas ausmachte. Sie hätte trotzdem noch genug zu essen. Er hielt vor einem roten Licht an und dachte an Rose in der Klinik und an den einen Dollar fünfzehn – jetzt vielleicht ein Dollar fünfundfünfzig plus zehn Cent Trinkgeld – auf der Uhr.
»Ich hab’s mir anders überlegt«, sagte die Dame. »Ich glaube, ich fahre lieber den ganzen Weg mit Ihnen.«
Sie nannte eine Adresse, und Max’ Gesicht hellte sich auf. Das würde ungefähr drei Dollar auf der Uhr ausmachen; dazu vielleicht noch einen Vierteldollar Trinkgeld.
»Ja, wirklich, Miss«, sagte er. »Es ist ziemlich heiß für die Untergrundbahn.« Er machte eine Pause, als überlegte er. »Ich will Ihnen was sagen, Miss. Ich könnte den Parkway entlangfahren. Da ist es kühler. Es weht immer eine leichte Brise vom Fluss her. Wäre Ihnen das recht, Miss?«
»Wie Sie wollen«, erwiderte sie. »Mir ist alles recht. Fahren Sie ruhig den Parkway hinunter.«
Max’ Stimmung hob sich beträchtlich. Damit würde er etwa drei Dollar fünfzig auf der Uhr haben. Und er konnte auf dem Parkway ja so schnell fahren, dass durch das Tempo tatsächlich eine Art von Brise entstand. Es war also doch kein so schlechter Standplatz gewesen, dort an der Bushaltestelle.
Es war der Gedanke an die Untergrundbahn, der Lois Winston veranlasst hatte, ihren Entschluss zu ändern – der Gedanke an die langsame Fahrt stadteinwärts, während sich die Wagen allmählich füllten, bis sich die schweigende Menge Schulter an Schulter um sie drängte und fremde Ellenbogen in ihren Rücken bohrten; der Gedanke an das wilde Gedränge am Hauptbahnhof, an die ermüdende Weiterfahrt bis Lexington und den pflichtbewussten Fußmarsch von dort nach Hause. Ihre Prinzipien in diesem Punkt waren für gewöhnlich durchaus richtig, dachte sie mit einem schwachen Lächeln, doch heute war entschieden nicht die rechte Zeit dafür. Nicht nach diesem Nachmittag.
Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr und beruhigte sich mit dem Gedanken, dass es für heute zu spät war, um noch irgendetwas zu unternehmen. Die Frage, die sie während des Marsches durch die Hitze beschäftigt hatte und die sie auch hier im Taxi noch nicht losließ – in diesem Taxi, dessen Besitzer, wie sie mit einem mäßig interessierten Blick auf die Zulassungskarte vorne feststellte, Max Fineberg hieß –, nun, diese Frage würde bis morgen warten müssen. Sie würde sie sich aus dem Kopf schlagen, sagte sie energisch zu sich selbst, und sie würde an etwas anderes denken. Sie würde auch nicht an Buddy und seine Madge denken und ebenso wenig – jedenfalls nicht während der nächsten Stunde – an Dave McIntosh, der seinem Namen so gar nicht ähnlich sah und sich doch zuweilen so richtig – à la McIntosh benehmen konnte. Sie beschloss, fürs erste nur noch daran zu denken, dass sie jetzt bald zu Hause war, wo sie eine kühle Dusche nehmen und sich anschließend eine Weile bei geschlossenen Jalousien hinlegen würde, während die Klimaanlage auf höchsten Touren lief.
»Vielleicht«, sagte sie, »können Sie jetzt doch das Verdeck herunterlassen.«
»Selbstverständlich, meine Dame«, erwiderte Max und drückte auf einen Knopf. Die hintere Hälfte des Verdecks glitt gehorsam zurück. Wirklich ein prima Wagen, dachte Max – wenn man ihn bezahlen konnte.
»Schrecklich heiß heute, nicht wahr?«, bemerkte er. »Achtunddreißig Grad waren es um vier Uhr, sagte das Radio. Soll ich das Radio anstellen, Miss?«
Bei dem tröstlichen Ticken des Zählers vergaß Max beinahe, wie es ihm zuwider war, weibliche Fahrgäste mit meine Dame und Miss anzureden, und wie heftig ihn die Tatsache erbitterte, dass er es dennoch immer tat.
»Nein«, antwortete die Dame. »Es kommen sicher doch nur Sportmeldungen.«
»Da haben Sie recht, Miss«, meinte Max. »Sport oder Politik. Etwas anderes kriegt man ja kaum noch zu hören. Wenn sie nur öfters Musik bringen wollten.«
»Ja«, entgegnete die Dame. Es klang, als hätte sie Max’ Anwesenheit schon wieder vergessen. Doch Max hatte seit Stunden mit niemandem mehr gesprochen.
»Wissen Sie, Miss«, fuhr er fort, »dass dies seit heute Morgen um elf meine erste Fahrt ist? Tatsächlich. Was soll man da bloß tun?«
Wirklich, dachte Max, was sollte man bloß tun, wenn man nichts verdiente und die Frau in der Klinik lag?
»Ich weiß nicht, Mr. Fineberg«, sagte die Dame. Ich weiß es tatsächlich nicht, dachte Lois Winston. Was soll Mr. Fineberg tun?
Es freute Max, dass sie ihn Mr. Fineberg genannt hatte. Er war es leid, mit Fahrer angesprochen zu werden. Es kam heutzutage kaum noch vor, dass ihn jemand Mr. Fineberg nannte.
»Man hat’s wirklich schwer heute, Miss«, sagte Max über die Schulter. Es war höchste Zeit, dass er mal jemandem erklärte, wie schwer man es hatte – jemandem, der von solchen Problemen keine Ahnung hatte. »Ich bin verheiratet. Wie stellen die sich das eigentlich vor?«
Lois Winston betrachtete die schmalen, jugendlich mageren Schultern – vielleicht war die Jugend nicht der einzige Grund. Aus dem schmutzigen blauen Hemdkragen ragte ein magerer Nacken hervor. Auch Max’ Gesicht, das er ihr beim Sprechen halb zuwandte, war mager, und die feingeschwungenen Backenknochen warfen leichte Schatten auf die schmalen Wangen. Er war sehr jung, sah sie, und sehr bekümmert.
»Ich weiß«, sagte sie. Vielleicht wusste sie es nicht. Nicht aus eigener Erfahrung. Aber wenn man überhaupt aus dem, was man sah, etwas lernen konnte, wusste sie es. Sie sah ja täglich genügend magere, bekümmerte Gesichter. Weiß Gott, dachte sie müde.
Max achtete nicht auf das, was sie sagte. Ihre Worte waren für ihn nur ein ermutigendes Echo.
»In der Klinik ist sie«, sagte er. »Sie bekommt ein Baby. Meine Frau nämlich.« Er unterbrach sich, und sie sah, wie eine leichte Röte in seinen Nacken stieg. »Tut mir leid, Miss«, fuhr er fort. »Ich hätte Sie nicht damit belästigen sollen.« Du bist ein Idiot, sagte Max zu sich selbst. Warum jammerst du ihr etwas vor? Was interessiert sie das schon?
»Oh!«, rief sie. »Ein Baby. Noch ein Baby!«
»Hören Sie, Miss«, sagte Max. »Reden wir nicht mehr darüber. Ich hab’ bloß den ganzen Tag mit keinem Menschen gesprochen, und da ist mir das so ’rausgerutscht. Aber es ist nicht noch ein Baby. Es ist unser erstes Baby.« Sie sah, wie er trotzig die Schultern straffte. »Gibt es irgendeinen Grund, warum wir kein Baby haben sollten?«
Ich könnte ein Dutzend aufzählen, sagte sie zu sich selbst. Wenn Sie eines Tages einmal in unser Büro kämen, Mr. Fineberg, könnte ich Ihnen zeigen...«
»Nein, Mr. Fineberg«, antwortete sie. »Es gibt nicht den geringsten Grund, warum Sie kein Baby haben sollten. Ich habe – ich hatte gerade an etwas anderes gedacht.«
»Natürlich«, sagte Max. »Sie müssen mich entschuldigen, meine Dame. Tut mir leid, dass ich damit angefangen habe.«
Es war merkwürdig, dachte Lois in dem danach eintretenden Schweigen, das allem Anschein nach nun bis zum Ende der Fahrt dauern würde, wie die Umstände ihre Gedanken wieder zu jenem Problem zurückführten. Nun beunruhigte er sie aufs Neue – dieser sonderbare Punkt, den sie an diesem Nachmittag entdeckt hatte, etwa eine Stunde, bevor sie dem gesprächigen, egozentrischen und seltsam rührenden Mr. Fineberg begegnet war. Wenn er überhaupt irgendetwas bedeutete, so bedeutete er etwas höchst Unwahrscheinliches, etwas, das ganz und gar außerhalb des normalen
Ablaufs der Dinge lag. Sie war nicht sicher, was und ob sie überhaupt irgendetwas tun sollte. Vielleicht hatte sie bereits zu viel getan. Es bestand kein Zweifel, dass sie sich, als dieser ganz abwegige Verdacht in ihr aufgestiegen war, so gründlich wie nur denkbar verraten hatte. Vielleicht lag es daran, dass sie, trotz all ihrer Erfahrung, ein Amateur war; das, was man höflich eine Volontärin nannte. Vielleicht stießen die hauptberuflichen Mitarbeiter so oft auf sonderbare Dinge, dass sie es allmählich lernten, jedes Zeichen der Überraschung zu unterdrücken. In anderen Worten, vielleicht hatte Dave recht und sie sollte die Arbeit wirklich lieber denen überlassen, die dafür ausgebildet waren und davon lebten. Vielleicht hatten diese, wie Dave behauptete, wirklich eine Einstellung zu ihrem Beruf, die kein Volontär jemals erlangen konnte. Vielleicht war etwas an dem Bewusstsein, dass man seine Arbeit jederzeit und ohne irgendwelche materiellen Nachteile an den Nagel hängen konnte, das einen daran hinderte, sich ihr wirklich restlos hinzugeben.
Und doch stand fest, dachte Lois, während sie bei der 79. Straße nach Süden abbogen und dann die 72. Straße in östlicher Richtung entlangfuhren, und doch stand fest, dass sie gute Arbeit leistete. Oder bis heute geleistet hatte. Jetzt machte sie vielleicht aus einer Mücke oder dem Schatten einer Mücke einen Elefanten. Die Chance, dass sie einem reinen Zufall Bedeutung beimaß, stand etwa hundert zu eins.
Schließlich, sagte sie zu sich selbst, warum? Es wäre völlig unlogisch. Sicher ist es nur meine Einbildung, sonst nichts.
Wenn dies der Fall war, so hatte sie sich allerdings vor dem Ende der Unterredung töricht genug benommen. Dieser plötzliche Wechsel von der gewohnten Freundlichkeit, die sogar bis zum Austausch von belanglosem Familienklatsch ging, zu amtlich steifer Zurückhaltung. Dieser Hinweis auf weitere nun zu unternehmende Schritte, der in so krassem Gegensatz zu allem Vorhergegangenen stand. Die so klar aus allen ihren Äußerungen im Lauf der letzten fünf Minuten zu entnehmende Andeutung, dass neue Probleme aufgetaucht seien. Und wenn sich herausstellte, dass das Ganze nur der Einbildung einer müden jungen Frau an einem heißen Nachmittag entsprungen war...
Na, dachte Lois, einen Preis werde ich nicht bekommen. Und trotzdem muss ich es Mary Crane erzählen.
Es lag etwas Tröstliches in der Aussicht, sich bei Mary Crane aussprechen zu können. Mary würde sie verstehen und kein großes Theater wegen der Geschichte machen. Dann würde sie auf ihre taktvolle, unaufdringliche Weise einen Rat geben, sodass man hinterher das Gefühl hatte, ganz von selbst auf diese Idee gekommen zu sein. Ja, heute war es schon zu spät, aber morgen würde sie alles Mary Crane erzählen. Ob heute oder morgen, machte ja wirklich nichts aus.
Das Taxi fuhr ein Stück die Park Avenue hinunter, dann die 64. Straße entlang nach Osten, um einen Block herum und schließlich in umgekehrter Richtung durch die 63. Straße, während Max nach der Hausnummer Ausschau hielt. Sehr schick, bemerkte er zu sich selbst, als er sie fand und anhielt. Der livrierte Portier öffnete den Wagenschlag und wartete voll höflicher Aufmerksamkeit, während Lois Winston das Taxi bezahlte. Sie nahm das Wechselgeld zurück, und auf Max’ ausdrucksvollem Gesicht malte sich enttäuschte Verbitterung. Doch als sie die Münzen in die Tasche gesteckt hatte und die Hand wieder zum Vorschein kam, hielt sie etwas anderes in den langen, schmalen Fingern, und der Portier machte ein überraschtes Gesicht.
»Hören Sie, Miss«, begann Max. »Ich weiß nicht...«
»Sie können etwas für das Baby kaufen«, sagte Lois. »Oder für seine Mutter. Auf Wiedersehen, Mr. Fineberg.« Sie lächelte ihm zu. »Es war viel kühler auf dem Parkway.«
Max starrte erst auf sie und dann auf den Fünfdollarschein in seiner Hand. Er warf dem Portier einen finsteren Blick zu, und der Portier betrachtete ihn mit einigem Misstrauen. Dann zuckte Max die Achseln und fuhr los. So etwas passierte einem nicht alle Tage. Aber sie musste ja im Geld schwimmen, also machte es ihr wahrscheinlich nichts aus. Er warf einen Blick zurück zu dem Appartementhaus, wo der Portier gerade Miss – wie hatte er sie genannt? – Miss Winstead oder so ähnlich – sorglich durch die Gefahren geleitete, die zwischen Bürgersteig und Haustür lauerten. Na, sie war ja wohl recht nett, aber manche Leute hatten eben das Glück für sich gepachtet, darum kam man nun mal nicht herum, dachte Max, während er langsam durch die Park Avenue nach Norden fuhr und nach möglichen Fahrgästen um sich spähte. Manche Leute hatten das Glück gepachtet!
Am nächsten Morgen erinnerte er sich an diesen Gedanken mit dem ehrfürchtigen Schauder eines Menschen, den ein außergewöhnliches Schicksal im Vorübergehen berührt hat. Er erinnerte sich daran, während er an Roses Bett saß und ihr wieder und wieder seine Fahrt beschrieb, bis er das letzte Quäntchen Drama herausgepresst hatte. Und Rose, die so blass und krank aussah, die aber, wie die Ärzte sagten, wieder ganz gesund werden würde, Rose blickte aus den Kissen voll Bewunderung zu ihm auf, wie zu einem Helden, der nach bestandenem Abenteuer zurückgekehrt war. Als er sie ansah, verstummte Max nach einem Augenblick, dann nahm er ihre Hand. Sie lag warm und lebendig in der seinen. Er drehte sie um und strich vorsichtig mit dem Daumen über das Handgelenk, bis er den gleichmäßigen Pulsschlag spürte. Plötzlich war ihm, als habe er etwas sehr Wichtiges zu sagen.
»Rose«, begann er. »Ich sage dir, Rose, so etwas lässt einen nachdenklich werden.«
Er sagte es mit einer Art Erstaunen, als sei es wirklich etwas sehr Wichtiges.
Zweites Kapitel
Dienstag, 17.30 bis 21.45 Uhr
Es war eine Überraschung, Buddy zu Hause vorzufinden. Es war schon eine Überraschung, dass er überhaupt in der Stadt war. Er rief ihr vom Salon aus zu, als sie in die Diele des Dachgartenappartements trat.
»Lois?«
»Ja«, entgegnete sie, während sie Mary zunickte, die lächelnd am Fuß der Treppe zum nächsten Stock stand.
»Komm doch mal einen Augenblick herein, ja?«
»Schicken Sie bitte Anna in ein paar Minuten zu mir, Mary«, sagte Lois. »Nachdem ich mit Mr. Ashley gesprochen habe. – Ich komme schon, Buddy.«
Buddy konnte beim Eintreten einer Dame mit einer solchen Nonchalance aufstehen, dass es aussah, als sei er sitzen geblieben. Dies tat er auch jetzt.
»Wir dachten, du hättest vielleicht gern etwas zu trinken«, meinte er. »Nach deinen Diensten an der leidenden Menschheit.«
Bei Buddys Anblick musste sie im Stillen zugeben, dass er für einen Mann, der mit dreiundzwanzig schon so viel trank wie er, recht gut aussah. Er war drahtig und mager, obgleich man seine Magerkeit niemals mit der von – na, zum Beispiel von ihrem kleinen Taxichauffeur verwechseln konnte. Außerdem sah er unzufrieden aus, und aus seiner Stimme hatte bei den Worten leidende Menschheit deutlicher Spott geklungen.
»Hallo, Buddy«, sagte Lois. »Guten Abend, Madge.« Sie verstummte mit einem zögernden Lächeln zu der dritten Person im Zimmer hinüber, einer jungen Frau mit olivfarbenem Teint in einem sehr verführerisch geschnittenen Sommerkleid, die lässig zurückgelehnt in einem tiefen Sessel saß.
»Carol Halliday«, stellte Buddy beiläufig vor. »Das ist meine Schwester Lois. Genauer gesagt, meine Halbschwester Lois Winston.«
»Oh ja«, entgegnete Carol. »Guten Tag, Miss Winston.«
»Ihr habt es hier ja beneidenswert gemütlich«, meinte Lois. »Und kühl.«
»Buddy hat uns einfach das Leben gerettet, Lois. Buchstäblich.« Das war Madge.
Lois erklärte, das freue sie. Buddy fragte: »Was möchtest du, Lois?« Es klang ein bisschen, als rechne er mit einer Ablehnung. Doch sie nahm einen Cocktail und nippte im Stehen langsam daran.
Er hat mich hereingeholt, um mir zu beweisen, dass er Madge hierhaben kann, wann immer er will, dachte Lois. Und ihre Freunde. Er ist manchmal schon unglaublich unreif.
»Was ich wirklich will«, sagte sie, »ist eine Dusche und etwas Trockenes zum Anziehen.«
Sie trank ihren Cocktail aus und stellte das Glas hin. Meinetwegen kann er ein Dutzend Madges haben, dachte sie. Mein dummer kleiner Bruder. Ich bin nicht verantwortlich für das, was er tut. Doch sie wünschte, sie könnte sich wirklich davon überzeugen. Als Buddy den Shaker hochhob, schüttelte sie den Kopf.
»Jetzt nicht«, erklärte sie, lächelte den dreien noch einmal zu und wandte sich zur Tür. »Vielleicht später.«
Vielleicht, dachte sie, nehme ich nachher wirklich noch einen Drink. Die Kühle der Wohnung, von Motoren erzeugt, die sich irgendwo unermüdlich drehten, verringerte ihre Müdigkeit. Es war schön, sich wieder frisch zu fühlen. Es war schön, zu Hause zu sein, Platz und Ruhe zu haben und sich bedienen zu lassen.
Es ist schon angenehm, Geld zu haben, dachte sie, als ihr Max Fineberg einfiel. Geld und keine wirklichen Sorgen – außer vielleicht ein bisschen wegen Buddy. Und natürlich, setzte sie in Gedanken hinzu, auch ein bisschen wegen Dave. Und wegen dieser rätselhaften Geschichte vom Nachmittag.
Aber schließlich, dachte sie, bin ich ja nur eine Volontärin. Ich kann jederzeit aufhören und mich nur noch amüsieren. Und ich bin jung und nicht übel anzusehen und...
Und, dachte sie ein paar Minuten später, als sie unter der Dusche stand und beifällig an sich heruntersah, und ich bekomme kein Baby. Nicht wie die arme kleine Mrs. Fineberg.
Als Lois aus der Dusche kam, hatte Anna in ihrer geräuschlosen flinken Art bereits alles vorbereitet. Die Bettdecke war zurückgeschlagen, die Jalousien geschlossen, alles war so, wie Lois es sich ausgemalt hatte, als sie durch die Hitze auf Max Finebergs Taxi zuschritt und sich vergeblich einzureden versuchte, dass sie ihren Prinzipien treu bleiben und zu Fuß zur U-Bahnstation gehen sollte. Nun sagte sie Anna, dass sie sie frühestens in – sie nahm ihre Uhr vom Nachttisch – in einer Stunde wieder brauche. Anna erwiderte: »Gut, Miss«, und wandte sich zum Gehen. Da kam Lois zu einem plötzlichen Entschluss.
»Ach, Anna«, rief sie, »bringen Sie mir doch, bitte, das Lexikon. Den Band mit den V.«
»Das Lexikon, Miss?«, wiederholte Anna. »Der Band, wo die V drinstehen?«
»Ja, bitte«, sagte Lois. »Ich möchte gern etwas nachschlagen.«
Als Anna den Band brachte, stellte ihn Lois aufrecht auf ihren Magen und begann in dieser unbequemen Lage zu lesen. Plötzlich rief sie: »Hm!«, legte sich zurück und blickte eine Weile stumm zur Decke. »Das hab’ ich mir doch gedacht«, murmelte sie nach ein paar Minuten. »Ich muss mit Mary Crane sprechen.« Dann schlief sie ganz unerwartet ein.
Es war fast sieben Uhr, als Anna vorsichtig an die Tür klopfte. Lois erwachte, rief »Herein!« und versuchte, sich an den wirren Traum zu erinnern, der langsam in ihr Unterbewusstsein versank. Es war etwas gewesen – aber sie konnte sich schon nicht mehr daran erinnern. Als Anna ihr sagte, wie spät es war, blieb Lois noch einen Augenblick ruhig liegen und sah sie an. Dann war sie ganz wach, sprang aus dem Bett und bat Anna, das blaue Seidenkleid herauszulegen. Sie selbst setzte sich indessen an ihren Toilettentisch und betrachtete sich im Spiegel. Ihre Wangen waren vom Schlaf leicht gerötet. Sie sah ausgeruht und frisch aus.
»Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, Miss«, meinte Anna und begann mit ruhigen, geschickten Bewegungen Lois’ Haar zu frisieren. Lois rieb ihr Gesicht mit Cold Cream ein und tupfte sie dann wieder ab. Doch, sagte sie, sie habe ganz wunderbar geschlafen. Jemand klopfte an die Tür.
»Ja?«, rief Lois.
»Ich möchte gern einen Augenblick mit dir sprechen.«
Das war Buddys Stimme. Es lag etwas wie eine Forderung darin.
»Ich bin gerade beim Anziehen«, erwiderte Lois. »Und Dave kommt gleich, um mich abzuholen. Du kannst ja morgen mit mir sprechen.«
»Ich brauche nicht lang, um zu sagen, was ich zu sagen habe«, fuhr Buddy hartnäckig fort. »Und ich möchte es noch heute Abend sagen.«
Er sprach, als sei nur das wichtig, was er wollte. Lois machte eine ungeduldige Bewegung und blinzelte Anna im Spiegel zu. Anna antwortete mit einem Blick voll unaufdringlichen Mitgefühls.
»Nein«, sagte Lois. »Du wirst dich bis morgen gedulden müssen, Buddy. Und wenn es sich darum handelt
»Du weißt genau, um was es sich handelt«, unterbrach sie Buddy. Er hatte die Tür halb geöffnet. »Ich möchte dir nur sagen – schick doch bitte Anna hinaus, ja?«
Lois war aufgesprungen und hatte sich zu ihm umgedreht.
»Ich habe nein gesagt«, rief sie. »Ich habe dir gesagt, dass ich beim Anziehen bin. Geh sofort hinaus, Randall! Und bleib draußen, bis ich dich auffordere, hereinzukommen!« Sie sah ihn an, und er erwiderte ihren Blick. »Also«, sagte sie. »Mach, dass du hinauskommst!«
Sie war stärker; sie war immer stärker, wenn es wirklich darauf ankam. Sie brauchte ihn nur Randall statt Buddy zu nennen; irgendwie kam er sich dabei immer wie ein kleiner gemaßregelter Junge vor. Natürlich machte ihn das böse, und auch jetzt lag dumpfer Ärger in seinem Blick, als er sie noch einige Sekunden lang anstarrte. Dann zuckte er die Achseln und zog die Tür hinter sich zu. Lois’ Augen ruhten einen Moment auf der Tür, dann setzte sie sich wieder vor den Spiegel. Auf Annas freundlichem Gesicht malte sich teilnahmsvolle Zustimmung.
»Natürlich wird es wieder um Madge gehen«, sagte Lois halb zu sich selbst. »Wenn er es doch nur sein lassen würde! Zumindest, bis Mutter zurückkommt.«
»Mrs. Ashley will morgen kommen, Miss«, warf Anna ein. »Nur für einen Tag. Um Besorgungen zu machen. Sie hat, glaube ich, heute Vormittag mit Mary telefoniert. Ich dachte, Mary hätte es Ihnen gesagt.«
»Oh«, meinte Lois. »Nein – ich habe Mary nur ganz kurz gesehen. Ich nehme an, sie hat es meinem Bruder gesagt?«
»Ich glaube, sie hat es Mrs. Ashley gesagt.«
Annas Stimme klang neutral. Sie ging vorsichtig über das Thema hinweg, das außerhalb des Bereiches lag, wo Anna sich zur Stellungnahme befugt fühlte.
»Ja«, erwiderte Lois. »Natürlich. Vorne bitte etwas höher, Anna.«
Das erklärte Buddys Hartnäckigkeit. Er möchte mit mir sprechen, bevor ich mit Mutter spreche, dachte Lois. Um herauszukriegen, was ich Mutter sagen werde. Sie lächelte in sich hinein. Arme Mutter, fuhr sie in ihrem stummen Monolog fort. Doch schließlich, was kümmert’s mich? Doch jemand musste objektiv bleiben. Und das konnten weder Mrs. Ashley noch Buddy. Das konnte nur sie sein, Lois – und wieder lächelte sie – und Madge. Diese allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Aber man konnte wahrhaftig nicht leugnen, dass Madge die Dinge logisch durchdachte.
Sie hörte gedämpfte Schritte den teppichbelegten Korridor entlangkommen. Das war sicher Mary, die Mr. David McIntoshs Ankunft melden wollte. Sie hoffte, dass heute Abend der ruhige, verlässliche David an der Reihe war, der David à la McIntosh, wie sie ihn getauft hatte. Nicht der, der sie manchmal hart anzupacken versuchte, oder der, der ein- oder zweimal vor Eifersucht so ausfallend und bitter geworden war und ein solches Theater um jede Lappalie gemacht hatte. Gerade heute wünschte sie sich den netten, umgänglichen David oder den vergnügten David oder eben den David à la McIntosh.
Sie hielt die Arme hoch, während Anna das blaue Kleid vorsichtig über ihren Kopf gleiten ließ. Es war ein hübsches Kleid, entschied sie, als sie sich vor dem langen Spiegel drehte und sah, wie der Stoff in sanften Falten um ihre Knie schwang.
Und, überlegte sie, ihrem Spiegelbild zulächelnd, weiter, das Mädchen, das drinsteckt, ist auch nicht so übel. Das kann man wirklich nicht behaupten.
David zeigte sich von seiner gemäßigten McIntosh-Seite. Er war ruhig und freundlich und machte ihr nette Komplimente über ihr Aussehen.
»Dein Anblick wirkt erfrischend wie eine kühle Brise«, sagte er.
»Na«, gab sie zurück, »ich weiß ja nicht, ob das so ganz die Wirkung ist, die...«
Er fiel ihr ins Wort. Darüber brauche sie sich keine Sorgen zu machen. Das wisse sie übrigens ganz genau. Dann fragte er, wo sie hingehen wollten? Er schlage vor, ins Dachgartenrestaurant im Ritz-Plaza. Oder hätte sie einen anderen Wunsch? Der Crescent Club am Fluss vielleicht?
»Nein«, antwortete sie. »Lieber ins Ritz-Plaza. Der Blick von dort oben ist so hübsch. Und nach dem heutigen Tag habe ich wirklich eine Aufmunterung nötig.« Er wollte etwas sagen. »Schon gut«, fuhr sie hastig fort. »Ich weiß, wie du über meine Arbeit denkst. Und du weißt, wie ich darüber denke. Lass uns erst wieder – na, sagen wir, Freitag in vier Wochen darüber sprechen, ja?«
Ein Taxi hielt neben ihnen an.
»Zum Ritz-Plaza«, sagte Dave.
Vor einer Ampel an der Park Avenue mussten sie eine Weile warten, dann arbeiteten sie sich langsam durch den Verkehr in westlicher Richtung voran. Es war noch immer sehr warm in den Straßen, doch durch das offene Verdeck kam eine schwache Brise in den Wagen.
Auch oben im Restaurant, zwanzig Stockwerke über der Straße, wehte ein leichter Wind. Die Jalousien waren zum Schutz gegen die sinkende Sonne herabgelassen, und die höheren Gebäude ringsum warfen schon lange Schatten über die Stadt. Am Eingang zum Restaurant war eine Kordel zwischen Messingstangen gespannt, und mehrere Männer und Frauen standen mit ratlosen Gesichtern auf der falschen Seite dieser Schranke. Ihnen selbst aber winkte Nicholas lächelnd zu.
»Ich habe einen Tisch für Sie, Mr. McIntosh«, sagte er. »In der Nähe der Tanzfläche, nicht?«
»Nicht zu nahe«, meinte David.
»Aber gewiss«, beruhigte ihn Nicholas. »Natürlich nicht zu nahe.«
Mit der Geschicklichkeit eines Seiltänzers schlängelte er sich zwischen den Stühlen hindurch und entfernte blitzschnell ein Schild mit der Aufschrift Reserviert von einem Tisch, der, wie er versprochen hatte, nahe an der Tanzfläche und doch nicht zu nahe war. Er strahlte vor Wohlwollen über den Tisch, über McIntosh, der ihn bekam, und über sich selbst, der ihn hergab. Dann half er Lois mit zartfühlender Aufmerksamkeit auf ihren Platz und winkte die Kellner mit dem Selbstvertrauen eines Zauberkünstlers heran, dem noch nie ein Trick misslungen war.
»Ist es dir recht so?«, fragte David.
»Wunderbar«, entgegnete Lois lächelnd. Sie wartete, bis auch er Platz genommen hatte, und erkundigte sich dann scherzhaft: »Aber, was hättest du gemacht, wenn ich lieber in den Crescent Club gegangen wäre?«
Dave sah sie verwundert an.
»Wieso?«, meinte er. »Das wäre doch ganz gleich gewesen.«
»Obwohl du bereits hier einen Tisch reserviert hattest?«
Er sah sie einen Augenblick lang verwundert an. Dann erinnerte er sich.
»Ach das«, sagte er. »Das war nur einer von Nicholas kleinen Tricks. Für gute Kunden und so. In Wirklichkeit war der Tisch gar nicht reserviert.«
Die Kellner und Pikkolos eilten geschäftig um sie herum, füllten die Gläser, stellten Butterschälchen auf den Tisch, legten die Speisekarten vor. Dann wurden die eisgekühlten Daiquiries serviert, deren süßsäuerlicher Geschmack angenehm erfrischte. Doch Lois lehnte einen zweiten ab.
»Ob du es glaubst oder nicht«, sagte sie, »ich habe Hunger.«
Man sollte sich wirklich nicht dauernd um unnötige Dinge Sorgen machen, dachte Lois, während sie aßen und sich zwischendurch leise unterhielten. All die kleinen Probleme des Tages verschwanden nun, da in den Häusern ringsherum langsam die Lichter angingen und die Stadt ihre nächtliche Wandlung begann.
Nach dem Essen tranken sie eisgekühlten Kaffee aus hohen Gläsern. Dann, da es so viel kühler war, als Lois erwartet hatte, so viel kühler und friedlicher, tanzten sie.
Sie gingen zurück an ihren Tisch, plauderten und tanzten wieder. Danach bestellte Dave etwas zu trinken – Cognac mit Soda für sich selbst und für sie einen Cuba Libre –, und sie drehten die Gläser spielerisch herum, bis die Eiswürfel leise klirrten.
»Es ist herrlich hier«, meinte Lois. »Ich möchte überhaupt nicht mehr weg.«
Später, als die Kapelle wieder zu spielen begann, streckte ihr Dave die Hand hin, und sie tanzten wieder.
Die Tanzfläche war diesmal gerade angenehm besetzt, und als sie zurückgingen, drängten sich einige Paare auf dem Weg zu den eigenen Tischen an dem ihren vorbei. Durch die vielen Menschen war es wärmer geworden, und der kühle Drink schmeckte erfrischend. Lois, die vorher nur daran genippt hatte, trank einen tiefen Schluck und dann, während sie sich unterhielten, noch einen.
»Es wird plötzlich viel wärmer, nicht?«, bemerkte sie, als sie fühlte, wie ihre Wangen heiß wurden.
David lächelte ihr zu.
»Das Tanzen«, erklärte er kurz. Dann sah er sie genauer an. »Du siehst wirklich ziemlich erhitzt aus«, sagte er. »Ich habe es vorher nicht gemerkt.«
Wieder trank sie, durstig, die Kehle sonderbar trocken. David sah sie an. Sie spürte seinen Blick und lächelte. Ihr Gesicht begann zu glühen, und sie leerte ihr Glas. Doch obwohl sie die Eiswürfel zwischen den Lippen zergehen ließ, wurde ihr immer heißer.
Es ist alles Einbildung, sagte sie zu sich selbst. Mir fehlt nicht das geringste. Sie spürte, wie David sie forschend beobachtete. »Nicht wahr, David?«, fragte sie. Sie merkte kaum, dass sie laut gesprochen hatte. Doch sein Blick wurde plötzlich besorgt.
»Es ist natürlich nur die Hitze«, sagte sie. »Wie heute Nachmittag mit dem kleinen Mr. Fineberg, wo wir doch nur das Verdeck aufzumachen und den Parkway hinunterzufahren brauchten. Hab’ ich nicht recht, David? Nur sollte man kein Baby bekommen, denn vielleicht könnten wir es nicht behalten, und dann würden es Madge und Buddy bekommen. Und du kennst doch Buddy, nicht wahr, David?«
Das kann ich doch nicht wirklich sagen, dachte sie. Das alles kann ich doch nicht wirklich sagen! Warum schaut mich David die ganze Zeit an? Er sieht aus, als glaubte er, ich sei betrunken. Aber von dem, was ich getrunken habe, kann man doch nicht betrunken sein. Irgendetwas geht mit mir vor. Etwas Schreckliches geht mit mir vor!
Das Atmen fiel ihr schwer, ihre Lungen schienen nach Luft zu schnappen, und sie spürte, wie ihre Brust sich hastig, verzweifelt hob und senkte. Und während der ganzen Zeit, selbst nachdem sie die Worte nicht mehr voneinander unterscheiden konnte, hörte sie sich reden – reden. David stand mit erschrockenem Gesicht ihr gegenüber, und wie von weit her vernahm sie seine Stimme.
»Lois!«, rief er. »Was ist los, Lois? Lois!«
Nach Luft ringend stand sie auf. Ihr ganzer Körper schien zu brennen. Jetzt fühlte sie ihr Herz hämmern und...
Sie streckte die Hand nach David aus, doch als er um den Tisch herum auf sie zustürzte, glitt sie langsam zu Boden, und ihre Stimme, die wie im Delirium zusammenhanglose Worte geformt hatte, wurde schwächer und erstarb. Als David sie aufhob, stand bereits eine Anzahl von Kellnern um ihn herum, und der Empfangschef kam mit tief beunruhigter Miene zwischen den Tischen herangeeilt. Seine Missbilligung war selbst auf zehn Meter Entfernung nicht zu übersehen.