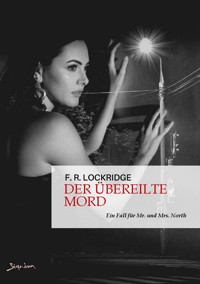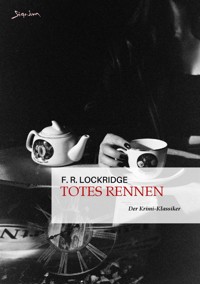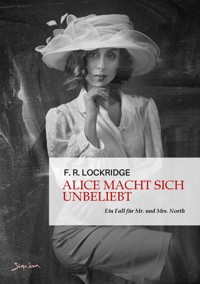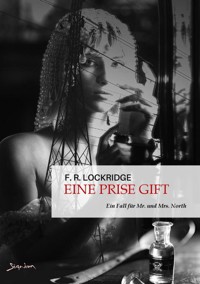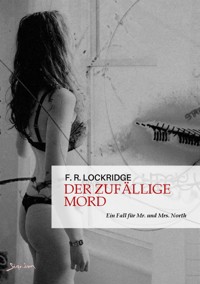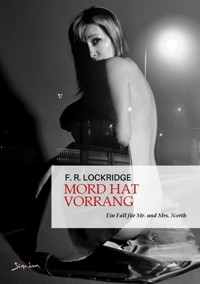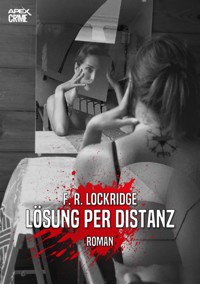6,99 €
Mehr erfahren.
Dorcas versuchte, während sie den Mantel fest um sich zog, ihr Gehör vor seinen Worten zu verschließen, doch die üblen, gemeinen Schimpfwörter schnitten wie Messer in ihr Gehirn. Sie fühlte die unglaublichen Redensarten fast wie Peitschenhiebe auf dem Leib, Hiebe, die den dünnen Mantel durchschlugen.
Sekundenlang vermochte sie nur stumm sitzenzubleiben und sich, mit dem Mantel umhüllt, unter den wütend ausgestoßenen Worten zu ducken. In diesen Sekunden war es, als sei alles Unschuldige und Helle aus der Welt vertrieben und alles so hässlich geworden wie die Flüche des Alten.
Der Roman Die Betonung liegt auf Mord von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1950; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1958 (unter dem Titel Professor Brinkleys Einladung).
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
DIE BETONUNG
LIEGT AUF MORD
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DIE BETONUNG LIEGT AUF MORD
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Das Buch
Dorcas versuchte, während sie den Mantel fest um sich zog, ihr Gehör vor seinen Worten zu verschließen, doch die üblen, gemeinen Schimpfwörter schnitten wie Messer in ihr Gehirn. Sie fühlte die unglaublichen Redensarten fast wie Peitschenhiebe auf dem Leib, Hiebe, die den dünnen Mantel durchschlugen.
Sekundenlang vermochte sie nur stumm sitzenzubleiben und sich, mit dem Mantel umhüllt, unter den wütend ausgestoßenen Worten zu ducken. In diesen Sekunden war es, als sei alles Unschuldige und Helle aus der Welt vertrieben und alles so hässlich geworden wie die Flüche des Alten.
Der Roman Die Betonung liegt auf Mord von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1950; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1958 (unter dem Titel Professor Brinkleys Einladung).
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
DIE BETONUNG LIEGT AUF MORD
Erstes Kapitel
Walter Brinkley, Professor für Englische Literatur an der Dyckman-Universität, jetzt im Ruhestand, kam, während er die letzte Zeile von Seite 352 seiner Abhandlung Bemerkungen zu den Unterschieden der Aussprache des Amerikanischen in den einzelnen Landesteilen tippte, zu dem Entschluss, dass es geradezu seine Pflicht sei, eine kleine Party für Paul Craig und die neue Mrs. Craig zu geben. Dieser Entschluss entstand so plötzlich und war anscheinend so unmotiviert, dass Mr. Brinkley ein bisschen blinzelte und das zuletzt Geschriebene noch einmal durchlas, in der Hoffnung, in dem Text die Erklärung dafür zu finden.
Das gelang, ihm sogleich. Er hatte sich da – kurz, auf nur vier Seiten – zu den feinen, vielen Leuten gar nicht auffallenden Unterschieden in der Aussprache der Worte Mary und marry geäußert und im Anschluss daran, mit gebührender Zurückhaltung, noch bestimmte Theorien über gewisse örtliche Gebräuche im Zusammenhang mit diesen Begriffen entwickelt. Zurückhaltend in seinem Urteil war Mr. Brinkley, weil dieses Thema eigentlich gar nicht zu seinem Spezialfach gehörte. Nein, sein Forschungsgebiet waren die Dichtungen Miltons. Sein Werk Miltons Kindheit vom 12. bis zum 16. Lebensjahr war – daran zweifelte er nicht – ein Buch von bleibendem Wert. Über regionale Akzente im Amerikanischen konnte er bestenfalls als gut beschlagener Amateur mitreden. Eben deshalb hatte er den Titel seiner Abhandlung über die sprachlichen Unterschiede durch die Worte Bemerkungen zu bescheidener formuliert, denn dieses definitive Unterschiede der Aussprache usw. hätte doch wohl etwas frech und anmaßend geklungen.
Aha, ja, das Wort marry – heiraten also – war natürlich das Stichwort zu seinem Entschluss gewesen. Paul Craig hatte sich, vor fast einem Jahr nun schon, zum zweiten Male verheiratet. Allerdings hatte er erst jetzt, vor einer Woche, seine junge Frau in das große Haus der Craigs in North Wellwood eingeführt. In dieses Haus, das so lange geschlossen gewesen war, dass viele der neuen Ansiedler im Ort es beinah wie ein Denkmal aus alter Zeit betrachteten.
Mein junger Freund Craig wird sicher die Situation sehr verändert finden, dachte Walter Brinkley, während er das Original und die Durchschläge der Seite 352 trennte und die Blätter auf die einzelnen Stapel legte. Freuen wird sich Craig darüber wahrscheinlich nicht, dachte er. Mein junger Freund Craig...
Aber nein, als jung sollte ich ihn mir wirklich nicht mehr vorstellen. Paul Craig ist ja – Brinkley rechnete rasch nach – über fünfzig. Etliche Jahre über fünfzig bereits. Und ich, dachte er, immer noch ungläubig und mit der betrübenden Enttäuschung, die sich bei solchen Überlegungen unfehlbar einschlich – ich bin siebenundsechzig. Ein zum Gnadenbrot auf freier Weide entlassener Mensch. Trotzdem werde ich, um den jungen Craig und seine neue Frau zu bewillkommnen, eine kleine Cocktailparty geben.
Mit diesem Gedanken sprang Walter Brinkley, ein ziemlich kleiner, behaglich korpulenter Herr mit dichtem, leuchtend weißem Haar und fast faltenlosem rosa Gesicht, lebhaft vom Platz vor seiner Schreibmaschine auf. Seine Frische und die fixen Bewegungen waren erstaunlich. Mit federnden Schritten eilte er aus dem im ersten Stock seiner weißen Villa an der Hayride Lane gelegenen Arbeitszimmer zum Treppenpodest und rief halblaut hinunter: »Harry?«
Harry, der im Wohnzimmer beschäftigt gewesen war – mit dem Abstauben vermutlich kam in den Flur, blickte zur Treppe empor und sagte: »Yäs, Ssö-e. Bittä, Professoh?«
Wie er seine Rolle liebt!, dachte Brinkley, der sich innerlich vor Lachen krümmte, davon jedoch nichts merken ließ, sondern nur seine gute Laune zeigte. Das alte Familienfaktotum, der getreue Diener aus dem tiefsten Süden. Haha! Welch einen Sport macht sich Harry Washington doch aus dieser Vortäuschung vom tiefen Süden, ohne es zur Groteske zu treiben, und ohne jede Bitterkeit!, dachte Brinkley. Wie er die Rolle zum eigenen Vergnügen und – ja, auch zu meinem – Spielt! Und weiß doch ganz genau, dass ich genau weiß, dass er in New Jersey geboren wurde, dort zur Volksschule gegangen ist und – sobald er das Komödienspielen sein lässt – genauso spricht wie andere in New Jersey geborene und aufgewachsene Leute. Eine interessante Abweichung übrigens, der typische Akzent von New Jersey...
»Yäss, Ssö-e?«, wiederholte Harry Washington duldsam. Er war groß und hager, seine Hautfarbe mittelbraun. Was der Professor dachte, wusste er sehr wohl, denn der schwieg manchmal, gerade wenn er etwas sagen wollte, ganz plötzlich und verfolgte stumm einen bestimmten Gedanken. Sehr interessanter Mann, sein Professor.
»Harry«, sagte Brinkley, »ich habe mich entschlossen, eine Party zu geben.«
»Eine Party?«, gab Harry zurück, ehrlich erstaunt. Und verbesserte sich rasch, indem er nun sagte »Ein Paahti?«
Das war ja was ganz Neues! Zwei oder drei Personen abends zum Essen, ja, das kam vor. Aber eine Party – nein. Das war in den fünf Jahren, seit er Butler bei Professor Brinkley war, noch nie vorgekommen. Als Mrs. Brinkley noch lebte, sicherlich. Doch das lag vor seiner Zeit.
»Sie mein’ ein richtiges Paahti, Professoh?«, fragte Harry, teils um sich vom Ernst der Sache zu überzeugen, und teils, um wieder in seine Rolle zurückzugleiten, aus der er vor Verwunderung für einen Moment gefallen war.
»Cocktailparty«, erwiderte Brinkley. »Für Mr. und Mrs. Craig. Die bewohnen jetzt das große Herrenhaus wieder.«
»Wa’haffig wah’?«, sagte Harry, ein bisschen zu dick auftragend.
Er wusste ja ganz genau, dass Mr. Paul Craig den riesigen Bau mit den braunen Ziegeldächern und den vielen Türmchen, an der Craig Lane, wieder geöffnet hatte, dass Mr. Craig sich wieder verheiratet hatte und mit seiner zweiten Gattin zunächst ein Jahr in der Welt umhergereist war. Wusste auch, dass die jetzige Mrs. Craig um allerhand Jahre – zwanzig, oder noch mehr – jünger war als ihr Mann. Dass sie groß und schlank war, schwarzes dichtgelocktes Haar hatte – ein Bild von Weib, sagten die Leute – und dass das Ehepaar sich eine weiße Köchin und zwei ebenfalls weiße Hausmädchen mitgebracht hatte. Dass Ellen White, die Weiß hieß, es aber nicht war, fünf Tage in der Woche, täglich sechs Stunden, für eindreiviertel Dollar die Stunde, zum gründlichen Reinemachen ins Haus kam; dass sie aber außerdem Joe Parks als Hilfskraft für Garten und Park behalten und dessen Frau verpflichtet hatten, gegebenenfalls auch im Hause auszuhelfen.
»Sie mein’ das groß braune Haus an die Straße nach Brewster?«, fragte Harry Washington wieder in seiner normalen Sprechweise. »Das große alte, ist es dem, was Sie mein’, Professor?«
Ich muss wohl lernen, mich präziser auszudrücken, dachte Brinkley, innerlich wieder lachend. »Ganz recht, Harry, das meinte ich«, antwortete er. »Das alte Haus der Familie Craig.«
»Ach, das!?«, sagte Harry.
Wahrscheinlich, dachte Brinkley, gibt er die Rolle im Moment auf, weil er bei Party zuerst versagt hat. Er wartete auf mehr.
»Wann?«, fragte Harry, der jetzt auch innerlich lachte, äußerlich aber vollkommen ernst blieb.
»Mal überlegen«, sagte Brinkley. »Heute ist Dienstag.«
»Nein, Sir«, antwortete Harry. »Mittwoch, Professor. Mittwoch der achtzehnte.« Er machte eine Pause, dann setzte er hinzu: »Juni.«
»Oh«, meinte Brinkley, aber nicht zweifelnd, denn in diesen Dingen hatte Harry stets recht. »Dann also... nächsten Sonntag?«
»Wie Sie’s beliebt, Professor.«
Demnach also lieber nicht Sonntag. Brinkley schlug den Samstag vor, und Harry wiederholte seinen höflichen Satz. »Also schön, Harry«, sagte Brinkley, »wann geben wir also die Party?«
»Wann Sie’s beliebt, Ssö-e. Samstag in ein’ Woche möchte sein richtig. Müssen gleich einladen die Leute. Und jemand dazu, mich zu helfen. Gewiss werden Zwanzig, dreißig Pesohnen...«
»Oh nein«, sagte Brinkley, »eigentlich wollte ich nur...«
»Nein, Ssö-e, wa’scheinlich fünfunddreißig«, sagte Harry.
Brinkley hatte allerdings, noch ein bisschen unbestimmt, an etwa nur ein Dutzend Gäste gedacht. Aber sicher sah Harry die Sache wieder richtig – wie immer bei dergleichen. Brinkley erinnerte sich daran, dass früher – wie betrüblich, und doch im Grunde auch erwärmend, an die alten Zeiten zu denken! – dass früher die Partys jedes Mal größer geworden waren, als er in seiner Arglosigkeit vorausgesetzt hatte. Sobald man daranging – nein: sobald Grace daranging, eine Liste aufzustellen. Na ja. Warm erfüllte der Kummer das Herz Walter Brinkleys, der seine Frau geliebt hatte. Er machte stumm kehrt, um wieder in sein Arbeitszimmer zu gehen, jetzt aber gar nicht federnd.
»Eis schon im Glas, Professoh«, sagte Harry ganz sanft, so sanft, dass Brinkley gerührt, wieder ans Treppengeländer ging.
»Ist beinah schon eins Uhr, Professoh«, ergänzte Harry. »Wünsch, dass ich den Ma’tini jetzt mixen? Und, wenn’s Sie recht ist, Ssö-e, v’leicht ein Omelett? Mit Pilz’ in Sahne? Heute mo’gen ich habe ein schönes Kopf Salat geschneiden. Ist jetzt schön knuspig, Ssö-e.«
Geht so sanft mit mir um, wie mit einem kleinen Kind, dachte Brinkley. Gar nicht wie mit einem alten Mann, der sich in einem zu großen Hause einsam fühlt.
Er begann, die Treppe hinunterzugehen. Harry blieb unten noch ein Weilchen stehen und blickte zu ihm empor, dann nickte er einmal, als sei er zufrieden, und als Brinkley dasselbe getan hatte, begab er sich zur Küche, während der Professor – der viel lieber mit Mr. angeredet sein wollte, was jedoch fast nie geschah – ins Parterre herabkam und durch den Flur und das Wohnzimmer auf die schattige Terrasse hinausging, zuletzt wieder mit dem gewohnten federnden Schritt.
Harry brachte ihm den Martini in einem kleinen Krug mit viel Eis darin und dazu ein hohes, dünnes, vom Stehen im Eisschrank noch beschlagenes Glas. Rasch, bevor die Frostschicht wegschmolz, schenkte er ein.
»Schönen Dank, Harry«, sagte Brinkley, und Harry gab zurück »Yäs, Ssö-e, Professoh. Sie nun machen Ihr’ Liste, Ssö-e.«
»Wer ist eigentlich Walter Brinkley?«, fragte Margo Craig, indem sie eine Einladungskarte hochhielt. »Er wünscht uns zum Cocktail bei sich zu sehen, am« – sie blickte wieder auf die Karte – »heute in acht Tagen.«
Es war Samstag nachmittags und die Post soeben eingetroffen, heraufgeholt vom Briefkasten der Landpost an der Craig Lane, wo der lange, gewundene Fahrweg von dem großen braunen Haus, dem mächtigen Herrenhause mit den Türmen, in die nach mehreren Generationen der Craigs benannte Seitenstraße mündete. Die Post kam spät, weil das Haus am Ende der langen Strecke lag, die der Fahrer vom Postamt in North Wellwood zurücklegen musste.
Margo Craig sprach weich, aber jedes Wort hob sich so ab, als mache es ihr Freude, sie alle einzeln ganz exakt zu formen. Wie sie da saß, unter dem Zeltdach auf der Terrasse des riesigen Hauses – als sie es vor zwei Wochen zum ersten Male gesehen hatte, war ihr ganz unerwartet der Vergleich mit einem großen Bären eingefallen, einem plumpen, beinah monströsen, aber in seiner Zottigkeit doch sympathischen Bären – wie Margo Craig dort saß, waren alle Linien ihrer Gestalt klar und rein. Sie sieht eigenartig vornehm aus, dachte Paul Craig, der sie beobachtete.
So rank und schlank, mit den langen unbestrumpften Beinen von dem besonders getönten, in einem sonnigen Winter erzeugten Braun, das so schön aussah, wenn etwas Sonnenlicht darauf fiel, bot sie einen sehr hübschen Anblick. Paul Craig betrachtete sie beifällig, und er gehörte nicht zu den Leuten, die leicht mit etwas zufrieden sind. Die meisten Frauen, dachte er, würden, säßen sie in einem so niedrigen Sessel, nachlässig wirken. Margo nicht. Gute Rasse, dachte er. Habe klug gewählt. Es war durchaus angemessen, dass er diese körperlich und geistig untadelige junge Frau gewissermaßen zu einer Craig gemacht hatte.
»Ein Professor für Englisch«, beantwortete er ihre Frage. »Jetzt im Ruhestand, glaube ich. Die Brinkleys haben hier in der Gegend schon seit der Revolution gewohnt. Tatsächlich sogar beinah so lange wie wir Craigs. Von der Party erwähnte er kürzlich etwas, gestern oder vorgestern – im Dorf. Soviel ich verstand, sind wir, meine Liebe, eigentlich die Veranlassung zu dieser Party. Die Ehrengäste.«
Margo sagte nur »Oh!«
»Ein Willkommen zu meiner Rückkehr«, ergänzte Craig. Auch er war groß von Gestalt, hager und ergraut, und wirkte sogar in den weißen Strandhosen und Polohemd adrett und korrekt gekleidet. Er saß in einem bequemen Sessel. Es ist gar nicht leicht, an einem Sommernachmittag auf einer Terrasse würdevoll und ernst auszusehen, vor allem nicht, wenn man eine Frau bei sich hatte, deren schlanke Beine in kurzen Sporthosen dargeboten, von beunruhigend schöner Symmetrie waren – doch Paul Craig gelang die erhabene Miene ganz gut. Keineswegs aber war er unempfänglich für Margos Reize, weder für ihre hübschen Beine, noch für das Gesicht mit den großen Augen oder ihre Büste, die sich in der Hemdbluse zart abhob, oder die feinen Bewegungen ihrer Finger, die Brinkleys Einladung hielten. Er war stolz auf sie, sehr stolz. Wahrhaftig ein Glücksfall, so eine Frau zur zweiten Ehe gefunden zu haben. Im Grunde passte sie sogar besser zu ihm als die arme Helen gepasst hatte. Helen war, das ließ sich nicht abstreiten, ziemlich leicht erregbar gewesen, zuweilen auch recht übellaunig.
»Vermutlich werden wir also zu Professor Brinkleys Party gehen?«, fragte Margo Craig.
»Ich denke, ja«, erwiderte ihr Mann. »Ist eigentlich recht aufmerksam von Walter.«
»Könnte mir vorstellen, dass es eine – eine ziemlich intellektuelle Gesellschaft wird, hm?«, fragte Margo.
Craig lächelte dünn, trank einen Schluck und schüttelte den Kopf. »Soviel ich seinen Worten entnahm, hauptsächlich Leute aus der näheren Umgebung. Einige, die schon immer hier Wohnten – die Sands, die Farnleys bestimmt, und – möglicherweise – auch ein paar von den neu Zugezogenen.«
»Die von den neuen Ranchhäusern auch?«
Er lächelte wieder, ganz schwach, und sagte, auch das sei durchaus möglich. »Walter ist ein recht geselliger Mensch«, erklärte er. »War er schon immer. Tolerant sollte man’s vielleicht nennen. Oder – weltfremd.«
Margo nickte, und sie schwiegen eine Weile, bis sie wieder begann: »Der Ort hat sich wohl sehr verändert seit – in den letzten Jahren?«
Eigentlich hatte sie sagen wollen seit der alten Zeit. Paul war ja, was ihren Altersunterschied betraf, nicht übertrieben empfindlich – ließ sich’s jedenfalls nicht merken –, aber in dem Hinweis auf die alte Zeit hätte er vielleicht eine gewisse Nebenbedeutung gefunden. Deshalb hatte sie ihren Satz geändert.
Er schien das nicht bemerkt zu haben. Nichte und gab zurück, dass sich zwar vieles verändert habe, weiß der Himmel, aber das sei ja wohl typisch für alle die Gemeinden, die sich so wie diese rings um North Wellwood ausbreiteten.
»Während ich hier aufwuchs«, sprach er dann weiter, »gab es nur die bedeutenden Familien und Häuser. Wie unseres hier.« Er machte eine Pause. »Na ja, vielleicht nicht genauso gebaut wie dieses. Großvater – na ja, Großvater hat sich im Stil ein bisschen vergriffen, nachdem das alte Haus abgebrannt war. Und für Grundstücke war eine Größe von zwanzig Morgen eigentlich wohl das Minimum. Und heutzutage? Parzellen von zwei Morgen! Und imitierte Ranchhäuser. Seitdem es für Berufstätige möglich geworden ist, morgens mit der Bahn über Brewster rechtzeitig nach New York zum Beruf zu kommen und abends zurück.« Er zündete sich eine Zigarette an. »Fortschritt nennt man das ja wohl«, betonte er, sich davon deutlich distanzierend.
»Keine anderen?«, fragte sie, die Augenbrauen hebend. »Ich meine, in deiner Kindheit hier? Farmer. Leute, die noch Land bestellen und so?«
»Ach so. Solche Leute auch, natürlich«, antwortete er. »Es gab sogar ein Gebiet, das allgemein Budenstadt genannt wurde. Heute würde man es gewiss als dörfliches Slum bezeichnen. Nein, ich hatte an die Leute aus unseren Kreisen gedacht.«
»Natürlich«, sagte Margo, jetzt in ganz höflich sachlichem Ton. »Gehen wir schwimmen?«
Paul Craig war ein sehr guter Schwimmer. Und was er gut konnte, tat er auch gern. Das hatte Margo Craig in den elf Monaten ihrer Ehe mit ihm gemerkt, wie auch sonst mancherlei.
Sie war klein und sehr flink und hatte das intensiv dunkelrote Haar aller Camerons – Haar, das manche, vielleicht missgünstige Frauen skeptisch betrachteten, gewiss mit dem Gefühl, selber von der Natur unerhört schlecht behandelt worden zu sein. Sie trug weiße Shorts und ein weißes Hemd, auf dessen Brusttasche ein kleiner grüner Drache gestickt war. Sie blickte durch ein offenes Fenster zur Hayride Lane hinab und sagte: »Heute kommt er sogar noch später als – ah, da erscheint er gerade!« Sie sagte das zu ihrer Cousine, eilte aus dem Hause und den Fahrweg hinab, um die Post zu holen.
Caroline Wilkins, die soeben das Geschirr vom späten Samstagmittagessen abgespült hatte, trocknete ihre Hände, trat in die Tür und sah zu, wie ihre Cousine schnell, mit beinahe überschwänglichen Bewegungen zum Postkasten am Tor ging. So voller Hoffnung, begreiflicherweise, auf einen Brief von ihrem Alan wie ich auf einen von meinem Brady, dachte sie. Und dann, was im Moment eigentlich gar nicht passte: Ach, die verflixte Marine!
Doch Caroline Wilkins verfluchte natürlich nicht im Ernst die Marine. Auch die Familie kann einen irritieren, aber deshalb verflucht man sie ja nicht im Ernst. Vor drei Jahren – nein, beinahe vier schon – hatte Caroline die Marine geheiratet, in Gestalt des Lieutenant Captains, damals First Lieutenants z. S., Brady Wilkins. Also war sie nun eine Marinefrau. Doch davor war sie – außer in drei Monaten, die nicht mitgezählt, nie wieder ins Gedächtnis kommen sollten – eine Marinetochter gewesen, Tochter des Vizeadmirals a. D. Jonathan Bennett. Als Vierjährige war sie in China gewesen, als Sechsjährige in Singapur, und von ihrem zehnten bis zum zwölften Lebensjahr in Frankreich. Marinefamilien mussten sich ja oft zeitweise, versuchsweise, an neuen Wohnorten einrichten. Wie auch jetzt wieder.
In diesem Fall war die Dauer des Verweilens vielleicht noch ungewisser als früher. Als Lieutenant Captain Brady Wilkins von Norfolk zur Dienststelle des Kommando Seeküste Ost in New York, Church Street Nr. 90, versetzt wurde, schien dem Ehepaar ein gemietetes Haus im Nordteil von Westchester als zeitweilige Residenz ganz vernünftig. Caroline hatte angenommen – das heißt, sie hatten beide angenommen, dass für etwa zwei Jahre – weiter voraus plante man bei der Marine nicht – Lieutenant Captain Wilkins ein Leben führen würde, das dem anderer in New York arbeitender und auswärts wohnender Leute sehr ähnelte. Als ob er vielleicht jeden Morgen mit dem Zug hin- und an den meisten Abenden – sofern er nicht über Nacht Offizier vom Dienst war – auch mit dem Zug heimfahren werde.
So jedoch verliefen die Dinge dann nicht, und das hätten sie sich eigentlich schon denken müssen. Dass Wilkins zum Admiral Seeküste Ost kommandiert wurde, erwies sich – wie eigentlich auch zu erwarten gewesen – in der Hauptsache als ein Vorwand. Er konnte in dem Hause an der Church Street seinen Wehrsold kassieren und seine Gesundheitsatteste aufbewahren lassen, und die Marinepersonalverwaltung konnte mit amtlichem Finger auf den Stadtplan tippen und erklären: »Dort ist er.« Aber dort war er selten. Vielmehr in Alaska, in Florida, oder womöglich sogar in London. Das hatten dem Lieutenant Captain Wilkins seine zwei Jahre fleißigen Studiums an der Technischen Hochschule in Boston eingebracht. Dass er nun ständig, und zeitlich immer unvorhersehbar, unterwegs war, vom Hauch des Geheimnisvollen umhüllt.
Und infolgedessen kam sich Caroline schon seit dem vorigen Sommer, nachdem sie die weiße Villa an der Hayride Lane gemietet hatten, beinahe wie eine Marinewitwe vor.
»Für eine Weile, für eine ganze Weile werde ich mal da, mal dort sein«, hatte Brady ihr eines Abends auf der Terrasse gesagt. »Wenn du nun hier auf dem Lande bleiben möchtest, wäre es doch besser, es wohnte noch jemand bei dir. Vielleicht Dorcas?«
Und Dorcas, ihre Cousine, die Tochter von Carolines Tante Cameron, kam dann auch ins Haus, und das war eine im großen Ganzen erfreuliche Regelung. Vier Jahre jünger – was sie vor zehn, zwölf Jahren sehr viel fanden, während es jetzt gar nicht von Belang war – schien Dorcas nun dazu bestimmt zu sein, auch in die Marine zu heiraten, falls die Marine den First Lieutenant Alan Kelley mal etwas weniger herumhetzte, sodass er die Zeit fand, sie zu ehelichen. Diese kleine flotte, fröhliche Dorcas mit dem glänzenden Kupferhaar, die nach ihrem eigenen, etwas bedauernden Urteil niedlich war. »Du bist eine Schönheit«, hatte sie bei dem Thema zu Caroline gesagt. »Ich bin... bin bloß niedlich.« Das war jedoch eine Herabsetzung, dachte Caroline, als sie ihr nachblickte. Dorcas ist mehr.
Am Briefkasten angekommen, hielt Dorcas gleich den rechten Arm hoch und wedelte mit einem weißen Papier. Also hatte er geschrieben. Jedenfalls einer der beiden. Mit einem ganzen Stapel von Postsachen kam Dorcas zurück, trat ganz rasch wieder ins Haus und warf die Post auf den Kaffeetisch im Wohnzimmer. »Hier ist er«, sagte sie und reichte Caroline einen Brief.
»Meiner schreibt nicht, der Strolch.« Sie blätterte schnell die übrige Post durch. Das meiste waren Drucksachen, für den Mülleimer. Außerdem aber die Zeitungen, der North Wellwood Advertiser und die Samstagausgabe der New York Herald Tribune mit dem so leicht einreißenden Papier.
Und dann war da noch ein kleines Kuvert, ein weißes schmales, vorn fast ganz von der Adresse ausgefüllt.
Captn. Brady Wilkins und Gattin
& Miss Dorcas Cameron
North Wellwood
»Ein Glück, dass wir nicht noch mehr Personen sind«, summte Dorcas unhörbar vor sich hin und öffnete das Briefchen. Und dann sagte sie hörbar: »Ach, der liebe Kerl« – doch Caroline hatte Wichtigeres zu tun, als ihr zuzuhören. So wartete sie, bis Caroline zu Ende gehört hatte, was Lieutenant Captain Brady Wilkins ihr aus weiter Ferne mitzuteilen hatte – denn weit weg war es ja vermutlich, mit einer Aufgabe betraut, die so geheim war, dass sie gar keine Bezeichnung hatte und er sich jetzt – Dorcas hatte sich erlaubt, den Poststempel zu betrachten – in San Diego befand, doch vermutlich inzwischen schon wieder woanders.
Als Caroline den Brief gelesen hatte, hielt sie ihn noch mit beiden Händen im Schoß. Sie ist noch weit fort, dachte Dorcas, so weit fort. Ob ich auch so aussehe, wenn ich einen Brief von Alan lese, seine Stimme zu hören glaube? Genau nicht, natürlich. Bei uns ist ja alles morgen, oder übermorgen, für sie aber ist es Gegenwart. Das Vollkommene.
Caroline schaute sie an.
»Was macht dein Seemann? Von See zurück?«, fragte Dorcas. Sehr sachlich klang das, wahrhaftig.
»Scheint ihm gutzugehen«, antwortete Caroline. »Wird vielleicht sogar Auch sie sprach sächlich, doch ihre Stimme bebte ein bisschen. »Wird uns vielleicht mit seinem Besuch beehren«, sagte sie. »Nächstes Wochenende sogar schon. Falls etwas, das er nicht erwähnen darf, mit einer Sache klappt, über die er nichts schreiben darf, an einem Ort, der nie genannt werden soll.« Sie hob fragend die Augenbrauen.
»Nein, keine Zeile«, sagte Dorcas, »gar nichts mit ewig dein oder dergleichen. Ich...«
»Nun, schließlich sind ja erst drei Tage vergangen«, überlegte Caroline. »Und falls er ein Seekommando bekommt, wird’s wahrscheinlich heißen in Marsch setzen und melden bei X und es werden vielleicht ein paar Tage zugelegt, die als Urlaub zählen.« Caroline, die Sechsundzwanzigjährige, drei Jahre verheiratet, betrachtete ihre Cousine – zweiundzwanzig, Hochzeit vorbereitet und vollziehbar, sobald es der Marine der Vereinigten Staaten in ihrer Weisheit beliebte, den First Lieutenant Alan Kelley ein Weilchen entbehren zu können. Wie die Augen dieses Kindes bei dem Wort Urlaub gleich leuchten! dachte Caroline. »Die übrige Post in den Müll, ja?«
»So ziemlich alles«, sagte Dorcas. »Nein, dies hier nicht. Der süße alte Herr gibt eine Party!« Sie hielt die Einladung des Dr. phil. Walter Brinkley hoch, dem das süß wahrscheinlich gefallen hätte, wenn’s ihm so gesagt worden wäre.
»Cocktails, 5 bis 8 Uhr«, las Caroline vor. »28. Juni. Und u. A. w. g.«
»Das Häschen«, sagte sie.
Den süßen alten Herrn kannten sie knapp ein Jahr, denn so lange wohnten sie ja erst in der Villa an der Hayride Lane, etwa einen Kilometer nördlich von der alten Residenz der Brinkleys. In diesem Haus, das noch gerade nahe genug bei New York lag, um es Dorcas zu ermöglichen, täglich ihren Schreibtisch als Redakteurin in der City zu erreichen. Ein Haus, über dessen Leere Marinefrauen, eine richtige und eine künftige, sich gegenseitig trösten konnten.
Und wo sie eine Schrotflinte griffbereit halten konnten, um Diebe abzuschrecken, die aber gar nicht erschienen.
Professor Brinkley hatte ihnen im vorigen Herbst, an einem glühend heißen, gelben Herbsttage, während er Post aus seinem Torbriefkasten angelte und sie im offenen Auto vorbeifuhren, so nett zugewinkt, als kenne er sie schon eine Weile. Später hatten sie ihn mal zum Tee eingeladen – was ihnen für einen weißhaarigen Professor im Ruhestand das passende Getränk zu sein schien – und Walter Brinkley hatte sich ohne Protest diesem Tee gewidmet. In den Weihnachtsferien dann, als es besonders trübselig war, allein zu sein, denn Brady Wilkins war, geheimnisvoll wie immer, in Alaska gewesen – hatte der süße alte Herr, bei ihnen auch Häschen genannt, sie zu sich eingeladen, ebenfalls zum Tee. Allerdings hatte er nachher gesagt: »falls Sie das Zeugs wirklich mögen«, wonach es dann, erfreulicherweise, die üblichen Getränke gab.
»Nachbarn?«, fragte Dorcas.
Caroline hob die schlanken Schultern unter dem weichen
Flaum ihres Sommerpullovers, »Sicherlich«, antwortete sie, »vielleicht noch ein paar Professoren.«
»Wenn’s solche sind wie er, können sie ja sehr nett sein. So wollig.«
Auf der Staatspolizeistation in Hawthorne trafen Einladungen selten ein, der größte Teil der Post bestand aus Verpfeifungen, die meistens langatmig sind, und aus amtlichen Mitteilungen, die kaum je etwas mit den fröhlicheren Seiten des täglichen Lebens, zum Beispiel Partys, zu tun haben. Aber das kleine Kuvert, adressiert an Captain Heimrich, persönlich, hatte pflichtgemäß seinen Weg in den richtigen Korb Ein gefunden, wo es schnell unter dickeren Papieren verschwand. Da Captain Heimrich ein Mann war, der immer den Dingen auf den Grund ging, auch in den Postkörben, entdeckte er zu gegebener Zeit, dass er von einem gewissen Walter Brinkley in Wellwood zum Cocktail eingeladen war.
Im ersten Moment hatte Heimrich gar keinen Begriff, wer dieser Mann sein konnte. Er schloss die Augen, um besser denken zu können. Es gab doch einen Brinkley – jedenfalls war der Name sehr ähnlich –, den sie wegen schwerer tätlicher Beleidigung eingebuchtet hatten? Und dann gab’s einen Brinkley – nein, der hieß wohl Barkley –, der eine neue Methode, seine Frau umzubringen, erfunden zu haben glaubte und feststellen musste, dass er sich geirrt hatte. Also der auch nicht. Dieser Brinkley aber...
Heimrich schüttelte den Kopf, als es ihm wieder einfiel. Ein freundlicher, rundlicher Mensch, mit rosa Babygesicht, weißem Haar und – ja, einer sorgenvoll wirkenden Miene. Ein ganz penibler Herr, der sich mal über schwer bestimmbare Unterschiede bei der Aussprache eines Vokals geäußert und damit eine kurze polizeiliche Untersuchung zu einem annehmbaren Abschluss gebracht hatte. Ja, Professor Brinkley. Richtig, das war der!
Für einen Kriminalbeamten, vor allem wenn er hauptsächlich mit Mordfällen zu tun hat, ist es immer schwierig, ein u. A. w. g. mit Zuversicht positiv zu beantworten. Es werden ja auch zu Cocktailzeiten Leute umgebracht wie zu jeder sonstigen Zeit, und an Samstagen nicht seltener als an anderen Tagen.
Und andererseits wollte doch Susan, seine Frau, gerade an dem Samstag ihren jungen, Michael mit den ernsten Augen, ins Sommerferienlager fahren. Und nachher saß dann ein betrübter riesiger Hund allein mit ihr im Auto. Susan also war für diese Party nicht verfügbar. Aber – falls kein potentieller Mörder aktiv wurde, wäre es eigentlich nett, Professor Brinkley wiederzusehen, auch wenn diesmal nichts von der Lautfärbung eines Vokals abhing.
Zweites Kapitel
Ist doch überraschend, dachte Walter Brinkley um halb fünf nachmittags am Samstag, dem 28. Juni, wie man ganz von selbst von einem Gast auf weitere kommt. Einst war es anders gewesen, da hatte die zärtlichste, ihm liebste aller Stimmen gesagt: »Schatz, in einer Stunde ungefähr kommen schon die ersten, willst du dich nicht lieber jetzt umziehen?« oder »Zu der braven alten Thelma wirst du doch ganz besonders nett sein, ja, Walter?« Aber schon damals waren es meistens mehr Gäste geworden, als er erwartet hatte, und heute verstand er besser als je zuvor, warum das so war. Tatsächlich führte sozusagen jeder Gast zu einem weiteren.
Die Sands waren eingeladen. Selbstverständlich. Und die Farnleys. Und Jerry Hopkins, dieser streitsüchtige alte Taugenichts. Wenn aber die Sands, dann ja auch – wollte man nicht unhöflich sein – auch die Abernathys, die doch mit den Sands viel verkehrten. Und wenn die Abernathys, auch die Thayers, denn die waren doch ebenso gute Bekannte. Und die liebe alte Mrs. Beiden – eine Dame, die man eigentlich richtig zum Tee, anstatt zu Cocktails, einlud – wäre sicher überrascht und vielleicht, in ihrer milden Weise, sogar gekränkt gewesen, wenn er andere Altansässige wie die Farnleys eingeladen hätte und nicht auch sie. Und dass er von Mrs. Beiden auf die Schwestern Monroe kam, war ja unvermeidlich gewesen. Die zwei Unverheirateten, die im Telefonbuch als Monroe, Schwestern, die verzeichnet waren, was ihm Spaß machte. Und da er die Party ja dem jungen Craig zu Ehren gab – schon wieder jungen, als wären sie beide noch Knaben! –, wäre es unverzeihlich gewesen, die Knights auszulassen, obwohl er sich aus Jasper Knight wenig machte. Da war doch diese Geschichte gewesen, als Jasper, im methodischen Turnus der Republikanischen Partei städtischer Grundstücksinspektor wurde und bei der Aufteilung des Baulands in Zweimorgenparzellen ein großes Stück reserviert ließ, ein Gelände, das zufällig Jasper Knights Eigentum war. Ach, ich sollte wirklich nicht immer Vorurteile gegen die Republikaner haben, dachte Professor Brinkley ein bisschen bekümmert.
Er rückte seinen blauen Querbinder zurecht und wusste genau, dass der schon lange vor dem Ende der Party wieder ganz schief sitzen und er nie daran denken würde, ein bisschen daran zu zupfen. Dann begab er sich nach unten, um sich zu erkundigen, ob für genügend Eis gesorgt war.
Harry Washington trug ein schneeweißes Jackett. Er versicherte ihm, dass eine Masse Eis in der Tiefkühltruhe bereitliege, ein ganzer Sack voll. Und dass Ellen White, da sie samstags nicht bei den Craigs arbeitete, verfügbar sei und schon ganz früh kommen werde, um die Delikatesshappen herumzureichen. Und ja, der Gasthof hatte die schon geschickt, und Ben sei genau instruiert, wo er die Autos parken sollte, und die Bar sei aufgestellt und Schnäpse aller Sorten ständen bereit, so viele, dass Runden und Runden und Runden getrunken werden könnten, wenn die jüngeren Leute, diese von den Ranchhäusern, viele Runden brauchten.
»Ich habe dreiundvierzig Gäste gezählt«, sagte Brinkley. »Haben wir denn Platz genug für so viele, Harry?«
»Bloß an die Baa nicht«, sagte Harry. »Nun Sie bleib’ schön ruhig, Professoh. Sind sich abe finfunviezig, wenn Mista und Missös Sands ihr Woch’endgästen mitbring, was sie gern wollten tun,«
Brinkley ging auf die Terrasse, setzte sich in den Schatten und freute sich sehr, dass das Wetter schön war, denn so konnten sich die Gäste, wenn sie Lust hatten, auch auf der Terrasse ausbreiten. Und, was bei Partys auf dem Lande wichtig war: Die Autos der Gäste, die man bei schlechtem Wetter auf dem Rasen parken musste, konnten auf dem Anfahrtsweg stehen, ohne in Matsch zu sinken. Manchmal waren noch tagelang Gäste wiedergekommen, oft sogar mit einer Zugmaschine, und wie der Rasen nachher aussah...
Ich bin nun bald so weit, dass ich mir schon Sorgen darüber mache, dass ich keine Sorgen habe, dachte Brinkley. Ein fusseliger alter Mann, der bei den harmlosesten Dingen schreckliche Konsequenzen fürchtet. Was kann denn eigentlich bei einer kleinen Hausgesellschaft an einem schönen Nachmittag im Frühsommer schiefgehen, noch dazu, wenn Harry sich um alles kümmert! Aus welcher Gegend des Südens wollte eigentlich Harry mit seinem sorgsam markierten Akzent so gern angeblich stammen? Professor Brinkley rief sich einige seiner Ausdrücke ins Gedächtnis. Georgia? Nicht ganz. Also Tennessee? Vielleicht ein bisschen näher an Tennessee. Wäre interessant zu wissen, wo Harrys Eltern aufgewachsen sind, denn diese weiche Betonung ahmt er sicherlich ihnen nach.
Ein Auto – der denkbar älteste Rolls-Royce, mit dem denkbar ältesten Chauffeur und dito Diener, bog langsam, behutsam von der Hayride Lane in die Einfahrt. Das mussten die Misses Monroe sein. Die waren gewiss überrascht, ganz flatterig, als erste zu erscheinen. Flatterig, anders kenne ich sie gar nicht, dachte Professor Brinkley, innerlich lachend, und schritt über die Terrasse zum Anfahrtsweg, um sie zu begrüßen.
Lieutenant Captain Brady Wilkins war in San Diego gewesen und dann in Texas – was hatte die Marine in Texas zu suchen? – und anschließend in Florida. Und jetzt war er entweder in New York, wahrscheinlich im Haus Nr. 90 auf der Church Street, oder auf dem Wege nach North Wellwood. Sie hatten auf ihrer Terrasse gesessen, noch beim Lunch, als im Wohnzimmer das Telefon klingelte und Caroline, ganz rasch und merklich erregt, sagte: »Ich gehe hin.« Sie ging durch die geöffnete Flügeltür, und Dorcas hörte ihre Schritte auf den Wohnzimmerdielen, viel schneller als sonst, beinahe wie laufen. Und dann lauschte sie selbst gespannt. Merkte, dass sie den Atem anhielt, Gutes für Caroline erhoffend.
»Hallo«, hörte sie Caroline sagen, und dieses alltägliche Wort schien zittrig zu klingen. Aber dann sagte Caroline »Oh, Liebster!« und Dorcas stand aus ihrem Sessel auf und ging zum Rasen hinunter, bis sie die Stimme ihrer Cousine nicht mehr hörte dieses Eifrige, das Glückliche in einer Stimme, die nur zwei Menschen gehörte und nicht bespitzelt werden sollte. Ich freue mich so, freue mich ja so sehr für sie, dachte Dorcas Cameron.
Sie ging auch nicht gleich wieder auf die Terrasse, sondern blieb auf dem Rasen, bis Caroline wieder draußen war, dort auf der Terrasse in der Sonne stand, unter der ihr honiggelbes Haar gleißte, und sie mit einem Kopfwinken bat, wieder zu ihr zu kommen. Erst dann ging Dorcas zurück, und zwar schnell. Und zu sagen brauchte ihr Caroline nichts, denn ihr leuchtendes Gesicht genügte. Aber sie sagte es trotzdem.
»Brady«, sagte sie. »Ist in New York und – kommt her. Heute Nachmittag. Leiht sich ein Auto und
»Wie herrlich, Liebes!«, sagte Dorcas. »Ich freue mich ja so.« Sie ergriff Carolines ausgestreckte Hände, und vor lauter Freude machten die zwei jungen Frauen im Sonnenschein auf der Terrasse einen Rundtanz.
Das Telefon hatte aber noch mehr gebracht. Lieutenant Captain Wilkins war in New York und wollte kommen, das stimmte schon. Jedoch – wann er eintreffen würde, hinge noch von etwas ab, das, nicht er selber bestimmen könne, sondern – wie es stets bei dieser dunklen Geheimniswirtschaft zu sein schien – von einem Mann, mit dem er etwas besprechen müsse, wovon der nichts erwähnen dürfe. Und auch nicht erwähnen würde, selbst vor seiner Frau nicht, einer so prächtigen Frau wie Caroline. Falls er und jener Unbekannte mit ihrer Besprechung früh genug fertig würden, käme er gewiss noch zeitig zu der Party. Um mal eben reinzuschauen.
»Ich glaube, lange dableiben möchte er gar nicht«, sagte Caroline. »Vielmehr – wir möchten’s beide nicht.«
»Finde ich auch«, sagte Dorcas.
»Es gibt ja so viel – ich meine, so viel zu erzählen«, sagte Caroline.
»Das kann ich mir gut vorstellen«, erwiderte Dorcas ganz ernst, aber in ihren Augen funkelten Gelächter und Freude.
»Du?!«, gab Caroline ebenso betont ernst zurück.