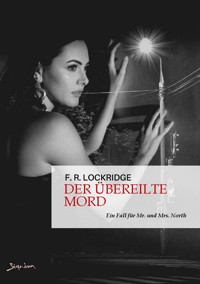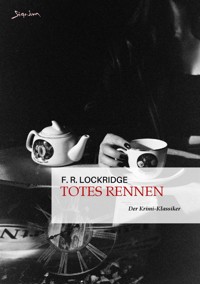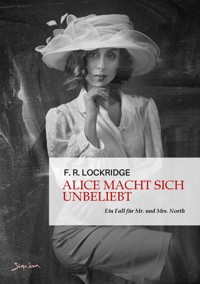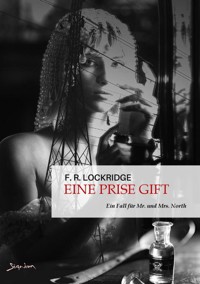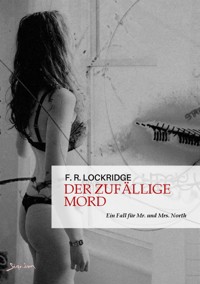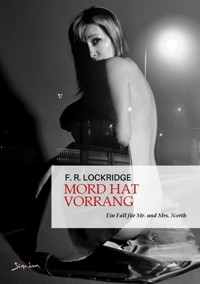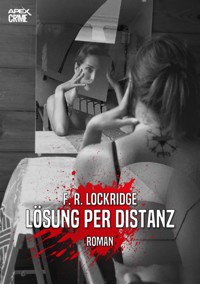5,99 €
Mehr erfahren.
Clayton Carter, der berühmte Fernsehmoderator der IBC, kennt keine Freizeit. Selbst zu Hause hat er immer einen tragbaren Monitor bei sich. Jeder weiß das. Und einige haben die Möglichkeit, aus dem Gerät ein Mord-Instrument zur konstruieren. Männer wie Carter haben viele Feinde...
Der Roman Der Tod zur vollen Stunde von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1974; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr (unter dem Titel Gemischtes Doppel).
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
Der Tod zur vollen Stunde
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER TOD ZUR VOLLEN STUNDE
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Das Buch
Clayton Carter, der berühmte Fernsehmoderator der IBC, kennt keine Freizeit. Selbst zu Hause hat er immer einen tragbaren Monitor bei sich. Jeder weiß das. Und einige haben die Möglichkeit, aus dem Gerät ein Mord-Instrument zur konstruieren. Männer wie Carter haben viele Feinde...
Der Roman Der Tod zur vollen Stunde von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1974; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr (unter dem Titel Gemischtes Doppel).
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
DER TOD ZUR VOLLEN STUNDE
Erstes Kapitel
Er klopfte an die Verbindungstür zwischen ihren Büros. Das war eine Höflichkeit, die sie auch nach zwei Jahren noch immer etwas verblüffte. Bevor sie zu IBC gekommen war, war sie meistens durch ein Klingelzeichen gerufen worden. Oder die Leiterin des Schreibzimmers hatte gesagt: »Miss Osborne! Zu Mr. Jones.« Oder zu Mr. Smith. Oder sogar zu Mr. Lawrence. Aber sie war jetzt natürlich eine Assistentin, keine Sekretärin mehr.
»Ja, Mr. Carter«, antwortete sie, und ihre Stimme klang dabei anders als ihre gewöhnliche Bürostimme. Aber nebenan war nur Clayton Carter, der ihre Freizeitstimme inzwischen kennen musste. Er achtete sorgfältig auf Nuancen; Stimmen waren wichtig für ihn – Stimmen und das, was sie sagten.
Er öffnete die Tür, und sie hatte das Gesicht vor sich, das Millionen an fünf Tagen der Woche um 19 Uhr auf dem Fernsehschirm sahen. Clayton Carter war Leiter der Abteilung Nachrichten und Chefkommentator der Independent Broadcasting Company, der jüngsten und vorerst noch kleinsten US-Fernsehgesellschaft. Einer ihrer Washingtoner Korrespondenten war vom FBI überprüft worden, was IBC mit CBS auf eine Stufe stellte, obwohl CBS natürlich viel größer war. Aber Clayton Carter und den meisten anderen Direktoren war diese Einmischung sehr recht gewesen. Keine Fernsehgesellschaft will schließlich auf die Dauer ignoriert werden.
Carter war groß und schlank und hatte ein fast rechteckiges kantiges Gesicht mit energischem Kinn und ausdrucksvollem Mund. Er hatte blaue Augen und trug sein blondes Haar kurz. Carter war zweiundvierzig, sah aber einige Jahre jünger aus.
»Schluss für heute, Miss Osborne«, sagte er lächelnd.
Sie sah auf ihre Armbanduhr und fragte: »Schon?« Als Carter nickte, stand sie vom Schreibtisch auf. Sie war fast so groß wie er und hatte die gleichen blonden Haare, aber ihre Augen waren dunkelblau. Carter lächelte noch immer und nickte wieder, als wolle er bestätigen, dass es an diesem Samstag Ende Juli Viertel nach zwölf war.
»Wir essen unterwegs eine Kleinigkeit«, sagte Carter. »Hast du deine Sachen mitgebracht?«
»Ja, Mr. Carter«, antwortete Janet mit ihrer Bürostimme. Sie trat an den Einbauschrank und zog ihren Tenniskoffer aus dem untersten Fach. »Weißt du bestimmt, dass Dr. Streeter mit mir rechnet?«
»Ganz bestimmt«, versicherte Carter ihr. »Bringen Sie doch eine Partnerin für ein gemischtes Doppel mit, falls es nicht regnet. Vielleicht Ihre Miss Osborne, wenn sie Tennis spielt. Paul ist eine Flasche, und Agnes spielt nicht viel besser. Aber die beiden sind stolz auf ihren neuen Tennisplatz. Und vielleicht ist es dort oben kühler.«
»Kühler ist es wahrscheinlich überall«, meinte Janet Osborne. »Nur im Fegefeuer nicht.«
Carter nahm ihr den Tenniskoffer ab und folgte ihr in den Flur hinaus. Sie fuhren vom 18. Stock in die Tiefgarage hinunter, wo sein Wagen stand. Dort unten war nichts von der Hitzewelle zu spüren, unter der New York in diesem Juli stöhnte. Im Wagen wurde es rasch kühler, als Carter die Klimaanlage einschaltete und von der 57th Street zum West Side Highway abbog.
Auch in dem Restaurant am Saw Mill River Parkway war es angenehm kühl. Von ihrem Tisch aus sahen sie den Saw Mill River, der um diese Jahreszeit nur ein Rinnsal war. Der Ober servierte eiskalte Martinis.
»Erzähl mir von Dr. Streeter und seiner Frau«, forderte Janet Carter auf, nachdem sie sich zugetrunken hatten. »Was für ein Doktor ist er?«
»Ein Doktor der Philosophie«, antwortete er. »Streeter hat Soziologie studiert und war dann an der Westküste bei Rundfunk und Fernsehen. Vor einiger Zeit ist er nach Osten gekommen und Professor für Kommunikationslehre an der Dyckman University geworden. Letztes Jahr hat er als Sachverständiger vor einem Senatskomitee ausgesagt, das die Praktiken zu untersuchen hatte, mit denen Konglomerate Nachrichtenmedien aufkaufen. Damit hat Paul sich in Regierungskreisen nicht gerade beliebt gemacht.«
»Er scheint ein netter Kerl zu sein«, sagte sie. »Er hat die richtigen Feinde.«
»Jedenfalls unsere«, stimmte Carter zu. Er nickte dankend, als der Ober die großen Speisekarten brachte. »Ich kenne Paul, seitdem er hier im Osten ist. Er hat mich einmal zu einem Vortrag vor seinen Studenten eingeladen. Wir verstehen uns recht gut.«
Sie bestellten die Muscheln, die sehr gut waren, und tranken dazu eine Karaffe Weißwein.
»Ich habe das Gefühl, dass ich Dr. Streeter kennen sollte«, meinte Janet. »Aber ich weiß nur, dass mir sein Name vage bekannt vorkommt. Und dass er kein guter Tennisspieler ist.«
»Seine Rückhand ist erbärmlich«, sagte Carter. »Die New York Chronicle hat ziemlich ausführlich über seine Aussage vor dem Senatskomitee berichtet. Er war dagegen, dass Konglomerate die Nachrichtenmedien aufkaufen – und das ist die Chronicle auch. Sie hat ihn praktisch für die nächste freiwerdende Stelle in der FCC nominiert. Er soll für den alten Hopkins nachrücken. Aber dieser Vorschlag war natürlich aussichtslos.«
»Warum aussichtslos?«
»Paul Streeter? Bei dieser Regierung?« Carter schüttelte den Kopf. »Bist du wirklich so ahnungslos, Mädchen?«
»Schon gut«, wehrte Janet ab. »Willst du mich ins Schreibzimmer zurückschicken, Clay?«
»Das muss ich mir noch überlegen«, antwortete Carter ernst. »Nehmen Sie sich in Acht, Miss Osborne!« Er lächelte. »Paul ist ein Endvierziger mit silbergrauen Schläfen. Und es wäre eine freundliche Geste, nicht allzu oft auf seine Rückhand zu spielen. Auf taktvolle Weise, damit er nichts merkt.«
»Ich bin nicht wirklich dumm, Clay.«
Er griff nach ihrer Hand. »Nein, natürlich nicht. Möchtest du einen Nachtisch? Oder nur Kaffee? Wir haben reichlich Zeit, wenn wir uns nicht verfahren. Gegen halb vier, hat Agnes gesagt.«
»Danke, ich möchte nur Kaffee«, sagte Janet. »Warst du noch nie bei den Streeters?«
»Nicht in ihrem neuen Haus. Sie haben es erst seit einigen Monaten. Vor ein paar Wochen war die Einweihungsparty – an einem Freitag, wo ich natürlich keine Zeit hatte. Deshalb habe ich versprochen, diesmal zu kommen.«
»Wieder zu einer Party?«
»Nein, außer uns ist nur noch ein Paar eingeladen. Ein gewisser Simmons oder so ähnlich und seine Freundin. Wie Carter und...«
»Und seine Assistentin«, warf Janet ein.
Er zuckte mit den Schultern und winkte den Ober heran, um Kaffee zu bestellen.
Sie tranken ihren Kaffee in aller Ruhe. Als sie wieder im Wagen saßen, war es Viertel vor drei. Im Auto war es heiß, und Carter öffnete die Fenster. Dann holte er einen zusammengefalteten Zettel aus der Innentasche seiner Jacke, breitete ihn auf dem Sitz zwischen ihnen aus und fragte: »Bist du gut im Kartenlesen?«
»Nein, schrecklich«, sagte sie und griff nach der Skizze. »Aber das hier sieht klar genug aus. Nach der Mount Kisco Avenue die erste Straße links.«
Sie fuhren auf dem Parkway nach Nordosten. Nach der Mt. Kisco Avenue bogen sie links ab, hatten nach der Unterführung nur noch zwei Ampeln vor sich und waren endgültig aus dem Stadtverkehr heraus.
»Nach links in die Pinetree Lane hinein«, stellte Janet fest und sah von der Karte auf. »Sie müsste irgendwo in der Nähe... das ist sie, Clay! Hinter dem Fliederbusch.« Carter bog nach dem Fliederbusch ab.
»Ungefähr viereinhalb Meilen«, las Janet vor. »Das Haus liegt auf der rechten Straßenseite, und ihr Name steht auf dem Briefkasten. Hier ist es hübsch, Clay. Sind wir noch immer in Westchester?«
»Hübsch«, bestätigte Clay. Er musste sich auf die enge, kurvenreiche Straße konzentrieren. »Noch immer Westchester.« Er hupte, als er um eine unübersichtliche Kurve fuhr.
»Wenn das beide Fahrer tun, hört keiner den anderen«, meinte Janet. Clay brummte etwas Zustimmendes.
Ein Schild warnte Achtung Ausfahrt! Clay fuhr langsamer, sah das Namensschild am Briefkasten und bog hinter einem riesigen Ahorn auf die kiesbestreute Zufahrt ab, die leicht ansteigend zu dem niedrigen zweigeschossigen grauen Haus führte. Rechts davon lag ein Tennisplatz, auf dem zurzeit niemand spielte. Clay stellte den Wagen am linken Rand des Wenderaums ab. Eine schlanke Frau in Tenniskleidung kam aus dem Haus, als sie ausstiegen.
»Hallo!«, rief sie und winkte ihnen vergnügt zu.
»Hallo, Agnes«, sagte Clayton Carter. Agnes lächelte. »Das hier ist Janet Osborne«, fuhr er fort. »Agnes Streeter, Janet.«
Janet schüttelte eine schlanke sonnengebräunte Hand. Agnes war fast einen halben Kopf kleiner als sie. »Ein wunderbares Haus, Mrs. Streeter«, meinte sie.
»Oh, uns gefälltes ganz gut«, antwortete Agnes Streeter. »Habt ihr eure Sachen mitgebracht?«
»Wie befohlen«, bestätigte Clay. Agnes und Janet gingen zum Haus, während er den Kofferraum öffnete. Dann kam ein großer hagerer Mann in Tenniskleidung ins Freie. Janet erkannte ihn nach Clays Beschreibung als Dr. Streeter. Er kam näher und erkundigte sich: »Kann ich Ihnen behilflich sein, Clay?«
Carter, der nur zwei Tenniskoffer zu tragen hatte, schüttelte den Kopf. »Danke, ich schaff’s schon, Paul. Janet, das hier ist Paul Streeter, von dem ich dir erzählt habe.«
»Miss Osborne«, sagte Streeter. »Er hat uns auch von Ihnen erzählt.«
Sie gingen gemeinsam ins Haus – in einen geschmackvoll eingerichteten Wohnraum, aus dem eine Treppe in den ersten Stock führte.
»Wir können uns einen Drink machen«, schlug Agnes vor. »Oder wir können einen Satz spielen, bevor Bernie und Miss Curran kommen. Oder wir können uns draußen an den Swimmingpool setzen, wenn euch das lieber ist.«
»Tennis«, sagte Paul Streeter hinter ihnen. »Solange das Licht noch so gut ist.«
»Natürlich«, antwortete Janet für sie beide.
Agnes führte sie in den ersten Stock in eines der Gästezimmer, damit sie sich umziehen konnte. Als Janet fertig war, sah sie aus dem Fenster auf den Tennisplatz hinunter. Paul Streeter saß im Halbschatten am Platzrand und streckte seine langen Beine in die Sonne. Janet hatte sekundenlang das Gefühl, diesen Mann schon einmal gesehen zu haben. Aber es verschwand ebenso schnell wieder. Sie hatte es bereits vergessen, als sie mit ihrem Tennisschläger nach unten ging und ins Freie trat.
Ein Auto kam die Zufahrt herauf. Auf dem Weg zum Tennisplatz begegnete Janet Dr. Streeter, der ihr entgegenkam. Dabei hatte sie wieder das gleiche Gefühl wie vorhin am Fenster. Aber auch diesmal verschwand es rasch wieder.
»Ich bringe die beiden gleich mit«, erklärte Streeter ihr.
Er ging auf den Wagen zu, der neben Carters parkte. Offenbar waren Bernie Soundso und Miss Curran angekommen. Janet wandte sich ab, erreichte den Allwetterplatz und nickte anerkennend, nachdem sie sich umgesehen hatte. Der Platz war bestimmt nicht billig gewesen. Der ganze Landsitz musste einen Haufen Geld gekostet haben. Universitätsprofessoren waren anscheinend wohlhabender, als sie vermutet hätte.
Janet setzte sich auf einen Safaristuhl und streckte die Beine wie Streeter in die Sonne. Wenig später erschien auch Carter in Tenniskleidung auf dem Platz. Er hatte seinen Schläger in der rechten und den Apparat in der linken Hand.
Der Apparat war eine miniaturisierte Radio-TV-Kombination mit einem winzigen Bildschirm. Das Gerät war für Netz- und Batteriebetrieb eingerichtet. Clayton Carter trug den Apparat überall und ständig mit sich herum. Jetzt stellte er ihn ins Gras, bevor er sich neben Janet setzte.
»Gar nicht übel, was?«, fragte er. Seine Handbewegung umfasste Haus und Grundstück. »Im Vergleich zu früher ist das ein gewaltiger...«
Er sprach nicht weiter, weil die Streeters jetzt mit zwei weiteren Gästen auf den Platz kamen. Der Mann war einige Zentimeter größer als Streeter. Er hatte das röteste Haar, das Janet Osborne je gesehen hatte. Wenn die Sonne darauf schien, sah es aus, als stehe sein Kopf in Flammen. Er war so hager wie Paul Streeter, was seine Größe noch betonte. Seine Begleiterin war eine schlanke junge Frau mit dunkelbraunem Haar und einem ärmellosen gelben Kleid.
Carter und Janet standen auf, als die vier herankamen. Alle lächelten das erwartungsvolle Lächeln von Leuten, die darauf warten, miteinander bekannt gemacht zu werden.
Die schlanke Braunhaarige war Nora Curran. Janet schätzte sie auf Mitte 20 – und ärgerte sich ein bisschen darüber, dass Clay sich so sehr auf sie konzentrierte, was andererseits verständlich war. Der Mann war Bernard Simmons.
»Nehmen Sie sich vor ihm in Acht, er verkörpert Recht und Gesetz«, sagte Streeter, was Janet rätselhaft, aber nicht witzig erschien.
Der Rothaarige hatte ein freundliches Lächeln. Alle wiederholten die Namen ihrer neuen Bekannten.
»Mabel zeigt euch, wo ihr euch umziehen könnt«, erklärte Agnes Streeter den beiden. »Und sie mixt euch einen Drink. Dann könnt ihr zurückkommen, euch in den Schatten setzen und zusehen, wie wir die Bälle verfehlen.«
Streeter öffnete eine neue Dose Tennisbälle, als Simmons und Nora Curran ins Haus gingen.
»Agnes und ich spielen meistens zusammen, wenn niemand was dagegen hat.« Niemand hatte etwas dagegen. »Kopf oder Zahl, wer den Aufschlag bekommt?« Auch das war in Ordnung. Clay Carter warf die Münze hoch; Streeter rief: »Kopf!«, und gewann. Zu Janets Überraschung ging er vor Agnes her auf die Westseite des Platzes, wo er beim Aufschlag die Sonne im Rücken hatte. Offenbar der Typ, der keine Chance ungenutzt lässt, dachte sie.
Sie spielten sich einige Minuten lang ein. Agnes’ Vorhand war oft geschnitten; ihr Mann neigte dazu, lange Bälle mit Topspin zu spielen. »Okay?«, fragte Streeter schließlich, und Clay antwortete: »Jederzeit.«
Janet stand an der Grundlinie und wartete auf den ersten Aufschlag. Streeter konnte natürlich zu den Männern gehören, die beim gemischten Doppel die Partnerinnen schonen. Aber er schlug bei ihr nicht anders auf als bei Clay – und verlor prompt das erste Spiel.
Damit war das Match praktisch schon entschieden. Wenn der Mann beim gemischten Doppel seinen Aufschlag verliert, ist der Rest nur noch eine gesunde Körperertüchtigung im Freien. Der Satz endete 6:2 für Clay und Janet, wobei Carter mehrmals die Augen zudrückte und Ausbälle übersah, um das Ergebnis wenigstens etwas schmeichelhafter zu machen.
Inzwischen waren Bernard Simmons und die Braunhaarige in Tenniskleidung zurückgekommen, saßen am Platzrand und sahen zu.
»Jetzt ihr vier«, schlug Agnes vor. »Paul und ich bereiten inzwischen alles vor.« Sie sah zu ihrem Mann hinüber. »Klar«, stimmte Paul Streeter zu. »Bevor das Licht zu schlecht wird.«
Der hagere Rothaarige und Nora Curran waren gleichwertige Gegner. Das stellte sich schon nach den ersten Ballwechseln heraus. Beim Spielstand von 6:6 stand die Sonne so tief, dass die Osthälfte des Platzes fast unbenutzbar war.
»Will jemand unbedingt weiterspielen?«, fragte Simmons.
Alle schüttelten den Kopf. Sie gingen gemeinsam ins Haus zurück. Die Männer blieben im Erdgeschoss; Janet und Nora stiegen die Treppe hinauf.
»Ist Mr. Simmons eigentlich Richter oder so was?«, fragte Janet dabei.
»Richter oder...?« Nora zog die Augenbrauen hoch. »Oh, was Paul vorhin gesagt hat. Nein, er ist Staatsanwalt.«
Zweites Kapitel
Es war fast sechs Uhr, als sie sich auf der schattigen Terrasse am Swimmingpool trafen. Janet entschied sich für einen gepolsterten Liegestuhl, neben dem ein Glastischchen stand. Die Streeters, die als erste gekommen waren, hatten bereits Drinks. Paul Streeter, der jetzt ein weißes Polohemd zu einer grünen Leinenhose trug, stand sofort auf.
»Wir haben nicht gewartet«, sagte er. »Was darf’s sein?« Er sah über Janet hinweg. »Und für Sie, mein Freund?«
Clay Carter stellte den Apparat auf die Steinplatten und zog sich einen Gartenstuhl heran. Er antwortete nicht gleich, sondern genoss einige Sekunden lang die Aussicht: sonnenbeschienene Flügel, die sich jenseits des Swimmingpools in blaue Fernen erstreckten. Dann sah er zu Paul Streeter auf, der ihn lächelnd beobachtete.
»Sehr hübsche Flügel«, meinte Clay. »Gin und Tonic-Water?«
»Uns gefallen sie auch«, stimmte Streeter zu. »Kommt sofort. Miss Osborne?«
»Bitte das gleiche«, antwortete sie.
Paul Streeter servierte die Drinks in hohen Gläsern, die außen beschlagen waren. Er stellte sie auf das Tischchen zwischen Clay und Janet.
»Am besten sage ich Mabel gleich, dass sie...«, begann Agnes. Aber dann sprach sie nicht weiter, weil das Dienstmädchen mit einem großen Tablett aus dem Haus kam. Hinter ihr erschien der Rothaarige.
»Danke, Mabel«, sagte Agnes Streeter. »Sie können es dort drüben hinstellen. Wir bedienen uns dann selbst.«
Mabel stellte das Tablett auf einen Glastisch und drehte sich um. »Noch etwas, Ma’am?«
»Danke, das war alles«, antwortete Agnes lächelnd.
Bernard Simmons war zu Streeter an die Bar getreten. Er sieht nicht wie ein Staatsanwalt aus, dachte Janet. Sein Haar ist zu rot. Und sein gelbes Polohemd würde genau zu Nora Currans Kleid passen.
»Nora kommt gleich nach«, erklärte Simmons ihnen. »Wir mussten den Swimmingpool unbedingt ausnutzen. In der Stadt hat man nicht viel Gelegenheit dazu.« Er setzte sich in einen Safaristuhl neben Clayton Carter, stellte sein Glas ab und betrachtete interessiert den Apparat. Dann zog er die Augenbrauen hoch.
»Der kleinste Fernseher der Welt«, beantwortete Clay die unausgesprochene Frage. »Mit UKW, Mittelwelle und Kassettenrecorder. Sozusagen mein Werkzeugkasten, Counselor.«
»Was lassen die Japse sich wohl als nächstes einfallen?«, meinte Simmons anerkennend.
»Das hier ist ein deutsches Fabrikat«, antwortete Carter.
»Auch ein Land, dem wir mehr abkaufen, als es uns abnimmt«, stellte Simmons fest. »Das habe ich schon mehrmals von Ihnen gehört.«
Janet fiel auf, dass Clay zu wissen schien, wer und was Bernard Simmons war. Im Restaurant war er sich seiner Sache noch nicht so sicher gewesen. Hatte Paul Streeter ihn identifiziert? Oder hatte Clay ihn erkannt, als er ihn gesehen hatte? Sie war davon überzeugt, Dr. Streeter schon einmal gesehen zu haben, und ärgerte sich, weil ihr nicht einfiel, wo das gewesen war.
»Warum so nachdenklich?«, fragte Paul Streeter. Er saß auf der anderen Seite der Terrasse, wo er den Swimmingpool und die Hügel hinter sich hatte. »Ist der Drink in Ordnung?«
»Ich bewundere nur die Aussicht, Doktor«, sagte sie rasch. »Sie haben’s hier wunderschön. Und der Drink ist ausgezeichnet.«
Streeter nickte zufrieden. »Sagen Sie bitte einfach Paul zu mir«, forderte er Janet auf. »Ja, wir wohnen gern hier draußen. Wir haben das Haus erst vor ein paar Monaten gekauft. Aber das hat Clay Ihnen vielleicht schon erzählt. Meine alte Tante Emily hat uns unerwartet ein Vermögen vermacht. Deshalb haben wir jetzt ein Haus, von dem wir sonst nur hätten träumen können. Entschuldigen Sie mich bitte? Ich sehe ein leeres Glas.«
»Natürlich, Paul«, antwortete sie lächelnd.
Das leere Glas gehörte Agnes. Streeter nahm es mit an die Bar und mixte ihr einen neuen Drink.
»Sie arbeiten mit Mr. Carter zusammen, nicht wahr?«, fragte Nora Curran, die den zweiten Liegestuhl neben Janet hatte. »Das weiß ich von Agnes.«
»Ich bin seine Assistentin«, bestätigte Janet. »Ich gehe die einlaufenden Meldungen durch und sortiere sie vor. Danach diktiert er mir die endgültige Fassung, die meistens etwas verändert ist.«
Nora nickte verständnisvoll. »Meine Arbeit ist ganz ähnlich«, sagte sie. »Aber ich habe natürlich mehr Zeit dafür. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ziemlich unter Zeitdruck stehen.«
»Zwischen sechs und sieben Uhr wird die Sache meistens hektisch. Und während der Sendung gehen oft noch Blitzmeldungen ein. Das ist dann eine zusätzliche Belastung für ihn.«
»Aber das merkt man ihm nie an«, stellte Nora fest. »Während der Sendung, meine ich. Er wirkt immer so selbstsicher. Nein, das ist nicht der richtige Ausdruck. Er ist einfach Herr der Situation. Ich sehe mir seine Nachrichtensendung fast jeden Abend an. Er... er steht auf meiner Seite, glaube ich. Oder ich auf seiner.«
»Er hat auch Gegner«, sagte Janet. »Nehmen Sie zum Beispiel das FBI, das versucht hat, einen unserer Washingtoner Korrespondenten zu bespitzeln. Dabei...« Sie sprach nicht weiter, weil Nora Curran nicht mehr zuzuhören schien. Sie starrte jedenfalls die grünen Hügel an.
»Bei uns gibt’s andere Gefahren«, erklärte Nora ihr nach einer kurzen Pause. »Ich bin Lektorin beim Materson Verlag, wissen Sie. Ist Ihnen die Firma Bartwell Industries ein Begriff?«
»Bei der habe ich schon gearbeitet«, antwortete Janet. »Im New Yorker Büro. Warum, Nora?«
»Gerüchten nach soll sie versuchen, Materson aufzukaufen«, sagte Nora Curran. »Das macht uns natürlich Sorge. Der Verlag ist schon über hundert Jahre alt und hat Tradition. Einer der Direktoren ist noch immer ein Materson. Und dann sollen wir einfach verschluckt werden...«
»Bartwell Industries hat einen großen Magen«, bestätigte Janet. »Ölgesellschaften, Weizenfarmen, Brauereien, Hotels, Zeitungen, Werften, Hüttenwerke – und eine Fabrik für Büroklammern. Unter anderem baut die Firma auch Kriegsschiffe und erzielt dabei überhöhte Gewinne. Darüber haben wir vor einiger Zeit in einer Sondersendung berichtet. Das war Clays Idee. Und jetzt will sie den Materson Verlag schlucken?«