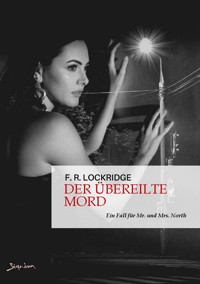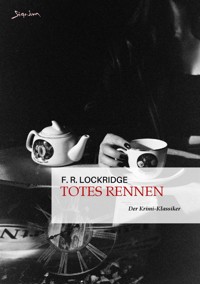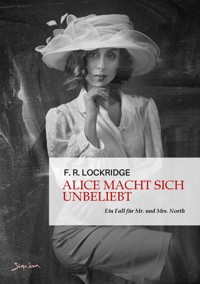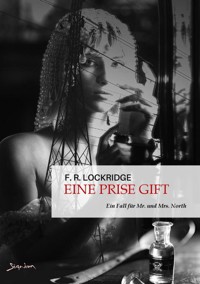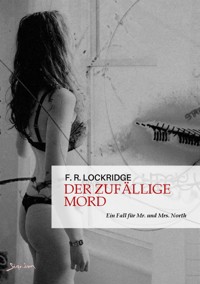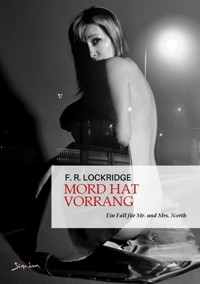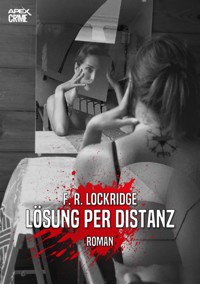5,99 €
Mehr erfahren.
Endlich wieder zu Hause! Lucy wird mich erwarten, denkt James McLaren, als er von einer Geschäftsreise zurückkehrt.
Aber die Wohnung ist leer. Seine Frau Lucy ist nicht da. Nur einen Brief findet er - einen Abschiedsbrief: Lucy hat ihn verlassen!
Hat sie ihn wirklich verlassen? Erst zweifelt er nur, doch dann packt ihn Entsetzen. Der Abschiedsbrief ist nämlich höchst verdächtig.
Was wird hier gespielt? Die Polizei ist skeptisch. Doch James drängt: »Meine Frau wurde entführt. Ihr Leben ist in Gefahr!«
Der Roman Die offene Hintertür von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1965; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
Die offene Hintertür
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DIE OFFENE HINTERTÜR
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Das Buch
Endlich wieder zu Hause! Lucy wird mich erwarten, denkt James McLaren, als er von einer Geschäftsreise zurückkehrt.
Aber die Wohnung ist leer. Seine Frau Lucy ist nicht da. Nur einen Brief findet er - einen Abschiedsbrief: Lucy hat ihn verlassen!
Hat sie ihn wirklich verlassen? Erst zweifelt er nur, doch dann packt ihn Entsetzen. Der Abschiedsbrief ist nämlich höchst verdächtig.
Was wird hier gespielt? Die Polizei ist skeptisch. Doch James drängt: »Meine Frau wurde entführt. Ihr Leben ist in Gefahr!«
Der Roman Die offene Hintertür von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1965; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
DIE OFFENE HINTERTÜR
Erstes Kapitel
Wie herrlich, wieder in New York zu sein! Ein wundervolles Gefühl, das dichtgedrängte Häusermeer auftauchen zu sehen, als die Düsenmaschine den Kennedy-Flughafen ansteuerte. Es tat gut, nach zwei langen Wochen das ausgedehnte Los Angeles wieder hinter sich zu lassen; nach zwei Wochen, die angefüllt gewesen waren mit Konferenzen in Anwaltsbüros, endlosen Wortklaubereien vor Richtern, im Gerichtssaal und in verschwiegenen Vorzimmern. Wortklaubereien dachte er, war eigentlich nicht gerade die Bezeichnung, die seine Berufskollegen ihrer Tätigkeit zu geben pflegten; und doch lief es genau darauf hinaus. Und es würde immer wieder darauf hinauslaufen - übermorgen, kommende Woche, nächstes Jahr.
Im Taxi, das ihn vom Flughafen nach Hause brachte, war es stickig heiß. Hitze brütete über dem Pflaster, als er vor dem Appartementhaus in der 60. Straße ausstieg. Oben, in der Wohnung, würde es angenehm kühl sein, dachte James McLaren hoffnungsvoll. Sie würde die Klimaanlage eingeschaltet haben. Jetzt um vier Uhr nachmittags saß sie bestimmt vor dem Flügel und probte, was sie abends vortragen wollte. Sie würde singen, aber nur mit halber Stimme. Ihre Stimme war zart. Eine Stimme, die geschult sein wollte. Sie würde ein Hauskleid anhaben, vielleicht das tiefblaue. Ihre wundervollen Haare würden noch offen auf die Schultern fallen. Es blieb noch genug Zeit für einen Drink, bevor sie sich für ihren Auftritt umziehen musste. Heute Nachmittag würden sie nicht streiten, nicht schon wieder. Er beschloss, sorgfältig jedes Thema, das unerquickliche Diskussionen nach sich ziehen konnte, zu vermeiden. Ein paar Stunden würde ihre sprühende Lebhaftigkeit, ihr geheimnisvoller Zauber, nur ihm gehören. Und dies wollte er nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen.
Der Pförtner nahm den Koffer, den der Taxichauffeur auf den Bürgersteig gestellt hatte, und sagte: »Guten Tag, Mr. McLaren. Der reinste Backofen mal wieder, wie?«
»Tag, Larry«, gab James McLaren zurück, »kann man wohl sagen.«
Im Entree des Appartementhauses empfing ihn angenehme Kühle. Larry trug den Koffer zum Fahrstuhl, der zu den C- und B-Appartements des sechzehnstöckigen Gebäudes führte.
»Guten Tag, Mr. McLaren«, begrüßte ihn der Liftboy und nahm den Koffer von Larry entgegen. »Eine Hitze, wie in einem Badeofen, wie?«
»Kann man wohl sagen, Fred«, erwiderte James McLaren und setzte seine Aktentasche neben dem Koffer ab.
Der Lift hielt im 12. Stock. Fred brachte den Koffer und die Aktentasche bis zu der Tür mit dem Schild 12 B.
»Besten Dank, Fred«, sagte McLaren und kramte seinen Schlüsselbund aus der Hosentasche.
Einen Moment stand er lauschend da. Manchmal konnte er das Klavierspiel durch die Tür hören. Allerdings selten. Die Tür war aus massivem Holz. Einer der Gründe, weshalb sie dieses Appartement in einem älteren Haus ohne Zentral-Klimaanlage gewählt hatte. So konnte sie in dem weiträumigen Salon spielen, ohne durch Radios, Fernsehgeräte oder laute Stimmen aus den angrenzenden Wohnungen gestört zu werden.
Heute war nichts zu hören. Er schloss auf, auch drinnen alles ruhig. Er setzte den Koffer und die Aktentasche in der Diele ab.
»Hallo, ich bin wieder da!«
Keine Antwort. Durch den großen Rundbogen betrat er den Salon. Die Sonne fiel durch das den East-River überblickende Fenster und warf spiegelnde Lichter auf die schwarzlackierte Fläche des Flügels. Der Hocker davor war leer.
»Lucy?«, rief er laut.
Abermals keine Antwort.
Zu dumm, wie man sich bestimmte Bilder ausmalen konnte und dann fest darauf verließ, dass man sie auch vorfand. Er war so sicher gewesen, dass sie am Flügel sitzen und üben würde - ihr kastanienbraunes Haar offen, bis auf die Schultern fallend, und in ihrem dunkelblauen Hauskleid. Wirklich kindisch, wie sollte sie wohl ahnen, wann er eintreffen würde? Hatte es sich doch selbst für ihn erst heute früh entschieden, welche Maschine er erreichen konnte. Vermutlich war sie gerade auf einen Sprung in den Drugstore gegangen, um irgendetwas zu holen. Oder sie saß beim Friseur...
Das Klingeln des Telefons schrillte laut in der großen, verlassenen Wohnung. Es klingelte gleichzeitig in der Diele, in seinem Schlafzimmer und in ihrem. Das ganze Appartement schien davon erfüllt. Er ging zum nächststehenden Apparat in der Diele.
»Ein Telegramm für Mrs. McLaren, Mr. McLaren«, meldete Larry aus der Pförtnerloge. »Soll ich es heraufbringen?«
Er konnte sich unschwer denken, wie das Telegramm lauten würde: Ankomme Flughafen fünfzehn Uhr. In Liebe. Jamie.
»Ja, bringen Sie’s rauf, Larry«, bat McLaren.
Dann ging er mit dem Gepäck in sein Schlafzimmer und durch die dazwischenliegenden Ankleide- und Badezimmer in ihres hinüber. Vielleicht hatte sie sich auch für einen Augenblick hingelegt. Sie liebte ein kurzes Nickerchen am Nachmittag.
Auch das Schlafzimmer war leer. Erst jetzt bemerkte er, dass die Klimaanlage gar nicht eingeschaltet war - in keinem der Räume. Erstaunlich! Die seit Tagen an der Ostküste anhaltende Hitzewelle hatte sogar die Zeitungen von Los Angeles beschäftigt. Da musste schon etwas dran sein. Und Lucy war so empfindlich gegen Temperaturschwankungen und ganz besonders gegen die brütende New Yorker Sommerhitze.
Komisch, dass sie da nicht...
Es läutete an der Wohnungstür. McLaren ging hinüber, öffnete und nahm das Telegramm entgegen.
»Danke, Larry«, sagte er und schloss die Tür.
Er riss das gelbe Kuvert auf - ankomme flughafen fünfzehn uhr stop in liebe jamie, las er.
So, das war sein in letzter Sekunde am Flughafen in Los Angeles aufgegebenes Telegramm, als die Maschine bereits aufgerufen worden war.
»Verdammt noch mal!«, fluchte er vor sich hin und ging in sein Schlafzimmer hinüber.
Sofort entdeckte er den auf der Kommode liegenden Briefumschlag. Jamie stand in Lucys charakteristischer runder, nach links geneigter Handschrift, die sie sich im Internat in England angewöhnt hatte, darauf. Er faltete den Bogen auseinander, oben links die Initialen J. S.
Lieber Jamie, mir wächst einfach alles über den Kopf - ich kann nicht mehr! Deswegen verlasse ich dich für einige Zeit, um mir in Ruhe über meine nächsten Schritte klarzuwerden. Wenn ich mich zu einem Entschluss durchgerungen habe, werde ich dich verständigen.
Unterschrieben hatte sie: Umarmung - Lucile.
Seine schmale langfingrige Hand, die den Brief hielt, blieb ruhig. Er las ihn wieder und wieder. Es dauerte eine Weile, bis er den Inhalt zu begreifen vermochte. Dann legte er den Brief auf die Kommode zurück und ging noch einmal in das Zimmer seiner Frau hinüber.
Es herrschte stickige Hitze. Der Duft ihres Parfüms hing noch in der Luft. James McLaren schaltete die Klimaanlage ein. Das leise, eintönige Summen begann, und bald darauf wurde es kühler.
Er machte die Tür ihres Ankleidezimmers auf. Dies kam ihm eigenartig leer vor, und so ging er hinein und schaltete das Licht an. Die meisten Sommerkleider und -mäntel waren verschwunden. Nur dickere Kostüme, Wollkleider und Wintermäntel hingen noch an Ort und Stelle. Fein säuberlich in ihren Plastiktüten, wie sie die Reinigung zurückgegeben hatte.
Aber ihre Abendkleider aus leichten, glitzernden Stoffen, die sie während ihrer Auftritte trug - sicher fast ein Dutzend -, hingen ordentlich aufgereiht in ihrer gesonderten Ecke.
»Diese verdammten Fetzen!«, hatte er an jenem Abend geschimpft, bevor er an die Westküste abflog, um den wohl ermüdendsten Plagiats-Prozess seiner Praxis zu führen. Es war nicht das erste Mal in ihren zwei Ehejahren, dass er so explodiert war - so oder noch ausfälliger.
Sie hatte nur geantwortet: »Schon wieder, Jamie. Musst du denn immer wieder davon anfangen? Schließlich hast du mich geheiratet, weil ich so bin, wie ich bin. Du hast mir reizende Komplimente gemacht, bezaubernde Dinge gesagt - darüber, wie ich bin. Und jetzt...«
Er ging quer durch das Zimmer zum Abstellschrank. Zwei Koffer eines zusammengehörigen Satzes waren verschwunden. Er konnte die Abdrücke noch deutlich auf dem staubigen Boden erkennen - hoffnungslos, in New York gegen den Staub ankommen zu wollen.
Benommen ging er in sein Zimmer zurück, sein Verstand schien wie gelähmt. Abermals las er den Brief, der ihm nichts Neues mehr sagen konnte; unfähig, etwas in sich aufzunehmen. In Gedanken verloren schaltete er die Klimaanlage ein, dann ging er in die Küche, löste dort Eis aus, trug es in den Salon hinüber, wo er im Vorbeigehen ebenfalls die Klimaanlage einschaltete, und mixte sich an der Hausbar einen Drink. All diese Handlungen vollführte er rein mechanisch. Dann setzte er sich in einen Sessel, den Drink neben sich auf einem Tischchen, wo er ihn zunächst vollkommen vergaß.
Er machte sich Selbstvorwürfe, Lucy nicht ernst genommen zu haben. Aber er hatte eigentlich nicht geglaubt, sie mit seinen ewigen Nörgeleien und ständig gleichen Vorhaltungen derart tief verletzt zu haben. Er hatte sich allzu sehr auf ihre wesensmäßige Fröhlichkeit und ihren gesunden Menschenverstand verlassen, mit dem sie - so hatte er gedacht - die Äußerungen seiner krankhaften Eifersucht tolerieren würde. Das letzte Mal hatte sie ihm vorgeworfen: »Du bist ein eingefleischter Egoist, findest du nicht auch?«
Dabei hatte sie leichthin gelacht. Aber diesmal, zu guter Letzt, hatte er es wohl zu weit getrieben und sie ernsthaft verletzt. So dass es ihr - wie sie schrieb - über den Kopf gewachsen war und sie nun nicht mehr konnte. Ich hätte die Dinge ruhen lassen sollen, dachte er.
Seine schmale Hand umklammerte das Glas und nahm es auf. Er war ein schlanker, hochgewachsener Mann. In dem energischen Gesicht fielen die vorstehenden Backenknochen auf. Seine tiefliegenden Augen bildeten intelligent. Er war fast fünfzehn Jahre älter als seine Frau mit ihrem wundervollen kastanienbraunen Haar und den hellbraunen Augen, die manchmal geradezu grün schimmern konnten. Die Frau, die ihn verlassen hatte, weil ihr die Dinge über den Kopf gewachsen waren.
Ihm selbst war es auch über den Kopf gewachsen, dachte er benommen. Ein Mann bringt es fertig, dass etwas in seinem Verstand allmählich übermächtig Gestalt annimmt, nur weil er einmal angefangen hat, sich etwas einzubilden. Mit jedem Mal, dass er es aussprach, hatte es an Bedeutung gewonnen, war es mehr und mehr außerhalb jeder Proportion gerückt. Es war doch alles einzig und allein auf eins hinausgelaufen. Das wurde ihm jetzt, da es für jede Einsicht zu spät war, klar. Er hatte sie zwingen wollen, ihren Job aufzugeben - einen Beruf, den sie liebte, der ihr lag, und auf den sie stolz war. Es war unvernünftig gewesen, das von ihr zu fordern, auch wenn er seinen Wunsch mit so vielen logischen Vernunftsmomenten untermauert hatte, sie mit Vernunftsgründen geradezu eingedeckt hatte. Sie war ihrem ganzen Wesen nach zu leicht für seine fest zupackenden Hände gewesen, dachte er reuevoll. Jetzt war sie trotz allem diesen Händen entglitten.
Er konnte sich nicht entsinnen, am letzten Abend vor seinem Abflug massiver als sonst gewesen zu sein. Aber vielleicht vermochte man das selbst nicht so genau zu beurteilen. Zudem war er an jenem Abend besonders müde gewesen. Hundert Dinge hatten geklärt oder umdisponiert werden müssen.
Er war wie immer ungern ohne sie gereist.
»Lass doch alles stehen und liegen und komm’ mit!«, hatte er gebeten. Sie hatte nur gelächelt und den Kopf geschüttelt, so dass ihr seidiges Haar flog.
»Du weißt doch, dass ich nicht kann, Liebling. Hab’ doch endlich einmal Verständnis dafür.«
Zu einem großen Teil hatte es daran gelegen, dass sie ihre Arbeitszeiten, beziehungsweise die freien Stunden, so selten in Einklang miteinander bringen konnten. Fünf Tage in der Woche schlief sie noch, wenn er morgens das Haus verlassen musste. Er dagegen lag oft - um nicht zu sagen, meist - in tiefem Schlaf, wenn sie in der Früh nach Hause kam.
»Also schön«, hatte sie einmal anlässlich einer ihrer unzähligen Streitereien vorgeschlagen, »dann gib’ doch du deinen Anwaltsberuf auf!«
Worauf er, soweit er sich erinnern konnte, nur geschnaubt hatte.
»Wieso, du verlangst es doch auch von mir!« war ihre logische Begründung gewesen.
Ihre Äußerung hatte eindeutig bewiesen, dass er bei ihr den Eindruck erweckte, als erachtete er ihren Beruf gering. Es musste sie verletzen, wenn er solche Dinge dachte, denn er setzte sie in ihren eigenen Augen herab oder ließ sie meinen, sie hätte sich eben durch diesen Beruf in seinen Augen herabgesetzt. Sie war stolz -- ein Teil ihrer sprühenden Lebhaftigkeit, des geheimnisvollen Zaubers, basierte auf ihrem Stolz. Er hatte sie dort verletzt, wo jeder von uns am verletzbarsten ist. Aber er hatte nicht geglaubt, sie so tief getroffen zu haben, um eine derartige Reaktion hervorzurufen. Zum Teufel, dachte er, sie liebt mich doch. Verdammt noch mal, ich weiß, dass sie mich liebt! Ihre Liebe zu mir wird sie nach Hause treiben, meine Liebe zu ihr wird sie nach Hause ziehen.
Ihm blieb nichts zu tun, als zu warten, überlegte er deprimiert und nippte an seinem Glas. Wenn sie wieder da wäre, würde er sie nicht wieder mit seinen Nörgeleien belästigen. Gewiss, es gab Gründe genug, die er hätte anführen können. Aber in Zukunft würde er sie mit seinen Gründen verschonen.
»Du setzt mir zu, als ob ich ein Zeuge eines Prozessgegners wäre«, hatte sie einmal gesagt. Er würde ihr nicht mehr zusetzen, wenn sie zurückkäme. Er würde hinnehmen, mit Dankbarkeit hinnehmen, was ihre unvereinbare Lebensweise gestattete.
Denn das, dachte er - und die Benommenheit ließ langsam nach -, ist der springende Punkt. All diese Abende, die wir getrennt verbringen müssen, die Geschäftsreisen, auf denen sie mich nicht begleiten kann - diese Dinge sind real genug und schwer zu ertragen, aber sie sind doch nicht das Wesentliche. Dass in diesen Punkten Zugeständnisse gemacht werden müssten, hatten sie beide bereits vor zwei Jahren erkannt. Damals, als er Lucile um ihre Hand gebeten und sie eingewilligt hatte, seine Frau zu werden. Ja, Jamie, ich möchte dich heiraten. Niemand hatte ihn, soweit er zurückdenken konnte, vorher Jamie genannt. Auch bis heute war Lucy die einzige, die es tat. Ich werde aber weiter auftreten, hatte sie hinzugefügt. Ich könnte ohne meinen Beruf nicht leben, Jamie. Er hatte ihren Wunsch akzeptiert, mit allen darin eingeschlossenen Zugeständnissen. Zumindest war er davon überzeugt gewesen.
Was sich mit der Zeit entwickelt hatte, war eine Art Eifersucht, keine klar zu umreißende Eifersucht. Er war fest davon überzeugt, dass Lucy ihm gegenüber genauso aufrichtig eingestellt war, wie er ihr gegenüber. Soweit sich derartige Gefühle überhaupt messen ließen. Nein, er war eifersüchtig, weil ihre sprühende Lebhaftigkeit und ihr geheimnisvoller Zauber nicht nur ihm gehörten. Du willst mich einsperren, wie unter einer Glasglocke. Mich für dich haben mit Haut und Haaren. Dies hatte sie ihm häufig genug vorgeworfen. Du versuchst - Jamie, du versuchst alles in mir abzutöten. Du hast mich doch gerade wegen dieser Eigenschaften geheiratet; wegen meiner Lebendigkeit und meines Temperaments, wie du es immer nennst... Sie hatte einen Augenblick gezögert. Ja, das ist es, du willst im Grunde diese Lebhaftigkeit abtöten, meinen Zauber zum Erlöschen bringen. Nur, damit andere nicht etwas von dem spüren, was du hast - was, wie du meinst, jetzt ausschließlich dir gehört.
Du verstehst mich vollkommen falsch, hatte er damals eingewandt. Ich will dich ja gar nicht ändern. Möchte dich kein bisschen anders, als du bist. Nur...
Sie hatte ihn schweigend angesehen und gewartet. Sprich weiter, Jamie, drängte sie dann schließlich.
Ja, ich glaube, es ist einfach so, dass ich dich mit niemand teilen möchte.
Sie hatte gar nicht vorgegeben, seine Worte missverstanden zu haben; keinen Sinn hineininterpretiert, den er nicht hatte hineinlegen wollen. Trotzdem vermied sie eine direkte Antwort. Es ist alles ein Teil von mir, Jamie, hatte sie gesagt. Nimm mich so, wie ich bin. Es wird - nun, es wird nicht ewig dauern. Wenn mein Zauber und meine Lebhaftigkeit verblassen - sie werden es eines Tages tun -, dann wird aus mir vielleicht die Frau eines Richters mit allem Drum und Dran, wie es sich gehört. Und wenn du dann Perücke und Talar ablegst und nach Hause kommst, werde ich dich empfangen: Wie schön, dass Sie da sind, Mylord. Haben Sie heute weise Entscheidungen getroffen?
Wenn sie sich mit ihm unterhielt, mischten sich häufig typische englische Redewendungen in ihren Sprachschatz. Am deutlichsten traten sie hervor, wenn sie sang. Dort war es sozusagen ihre persönliche Note.
Wie hatten sie beide damals gelacht über den Mylord und die Perücke. Sie war immer bereit zu lachen, und manchesmal hatte sie ihn mit diesem Lachen angesteckt.
James McLaren stand auf. So unvermittelt, dass er dabei fast das Glas vom Tischchen neben sich gestoßen hätte. Mit großen Schritten eilte er ins Schlafzimmer und baute sich vor der Kommode auf. Mit gerunzelter Stirn starrte er auf den ausgebreitet daliegenden Brief. Schließlich ergriff er ihn und las ihn nochmals, sorgfältig, Wort für Wort.
Es ging ihm plötzlich um eine einzige Phrase - eine Redewendung, die falsch klang, die Lucile McLaren niemals verwenden würde.
Zweites Kapitel
Staatsanwalt Bernard Simmons berichtete Lieutenant John Stein und Sergeant Paul Lane vom Morddezernat Manhattan-West noch einmal zusammenfassend, was sie hatten. Unnötig, aufzuzählen, was sie nicht hatten.
Sie hatten einen Toten im Leichenschauhaus. Sie hatten, allerdings noch auf freiem Fuß, einen Mann, der durchaus am vergangenen Samstagabend den siebenundsechzigjährigen Jefferson Page ermordet haben konnte. Sie hatten die Anschuldigung einer Frau von Anfang Dreißig - einer Frau, die zutiefst getroffen, die vollkommen durcheinander war. Ihre Anschuldigung lautete, dass Jefferson Page von einem Mann namens Charles Halstead aus Eifersucht ermordet worden sei.
Sie hatten des Weiteren drei Männer, die bereit waren zu beschwören, dass am vergangenen Samstag um zweiundzwanzig Uhr Charles Halstead an dem ständig für ihn reservierten Tisch im Restaurant Café Bleu gesessen hätte. Und zwar war Halstead, wenn man ihren Aussagen Glauben schenken durfte, kurz nach acht gekommen, hatte sich an seinen Tisch gesetzt und war bis kurz vor Mitternacht nicht weggegangen. So, wie es nahezu jeden Donnerstag, Freitag und Samstagabend seine Gewohnheit war - bis auf den Juli, in dem das Café Bleu samstags geschlossen hatte; und bis auf den August, in dem es überhaupt geschlossen war. Das Café Bleu lag in der 50. Straße. Page war in seinem Haus in der 12. Straße erschossen worden.
Weiter hatten sie ein Ehepaar, das in der 13. Straße ein auf den Garten von Pages Haus hinausgehendes Appartement bewohnte.
Beide hatten den Schuss gehört und konnten beeiden, dass er fast auf den Glockenschlag zehn gefallen war.
»Zuverlässige Zeugen?«, richtete Bernard Simmons die Frage an seine beiden Gegenüber.
Sie saßen in Bernard Simmons’ Büro, einem der unzähligen Räume der Staatsanwaltschaft von New York. Es war so klein, dass sie zu dritt gerade Platz darin fanden. Und das, obgleich Bernard Simmons für seine Person bestimmt nicht viel Platz in Anspruch nahm.
Staatsanwalt Simmons war groß und unwahrscheinlich hager; sein Haar war flammend rot, geradezu irritierend, und seine braunen Augen spiegelten ins Rote.
John Stein war bedeutend größer und schwer gebaut; ein dunkelhaariger, gutaussehender Mann. Der Mord an Jefferson Page war sein Fall - seiner und Paul Lanes. Seit Samstagabend. Heute war Mittwochnachmittag.
»Ja«, antwortete Stein, »zuverlässige Zeugen, jungverheiratetes Ehepaar. Er ist Architekt, ziemlich bekannt sogar. Soll große Klasse sein.«
»Sie sagen, sie hätten jemanden gesehen, der aus Pages Haus gelaufen kam, genauer aus einer der auf den Garten hinausführenden Terrassentüren, und zwar nachdem der Schuss gefallen war? Sie sagen, er sei durch den Garten gegangen, sich immer auf dem zementierten Pfad haltend, habe das Tor im Zaun durchschritten, sei direkt auf sie zugekommen und habe sich dann - so vermuten sie - auf dem schmalen, zwischen dem Appartementhaus, in dem sie lebten, und dem nebenstehenden Haus hindurchführenden Weg entfernt? Und dass sie im Grunde genommen nur einen schattenhaften Umriss wahrgenommen hätten, der sich eilig bewegte, aber nicht rannte?«
»Ja«, stimmte Stein zu. »Unmöglich, jemanden zu erkennen - zu dunkel.«
»Und drei«, Simmons blickte auf die Notizen, die er sich gemacht hatte, »der Geschäftsführer, der Oberkellner und der Kellner, sind bereit, unter Eid auszusagen, dass Halstead dort aß, dass er Wein trank und einer Sängerin am Flügel zugehört hätte, und zwar von kurz nach acht bis nahezu Mitternacht? Und weiterhin, dass sie Halstead genau kennen würden, weil er Stammgast wäre.«
»Und nicht nur ein Stammgast«, warf Lane ein, »erheblich mehr! Er ist Mitbesitzer des feudalen Ladens. Waren Sie schon mal da, Mr. Simmons?«
»Ja«, antwortete Simmons. »Vor ein paar Wochen, mit einem Freund. Es ist heutzutage das Lokal, in das man geht, habe ich mir sagen lassen: Betonung auf dem das. Sehr elegant, dabei zurückhaltend, irgendwie gediegen. Ein Mädchen spielt Klavier und singt dazu, ein äußerst attraktives Mädchen! Passt ausgezeichnet in den Rahmen. Nicht groß, intim, Gesamteindruck: Smoking ist zwar nicht obligatorisch, wird aber gern gesehen. Ein paar Leute trugen sogar einen, als ich da war. Die Speisekarte ist Französisch. Wenn Halstead Teilhaber ist, dürfte er ganz schön daran verdienen - so lange, bis ein anderes Lokal in Mode kommt und ihm den Rahm abschöpft.«
»Kann schon sein«, meinte Lane. »Nicht, dass er darauf angewiesen wäre. Sohn des verstorbenen Winthrop Halstead.«
»Oh«, murmelte Simmons nur, »Finanzier. Der Sohn?«
»Komponist«, berichtigte Stein. »Oder besser ausgedrückt, eher Arrangeur als Komponist - professionell. Allgemein anerkannt. Darüber hinaus allgemein beliebt. Was man von Page, weiß Gott, nicht behaupten kann. Die unausgesprochene Ansicht scheint mir dahin zu gehen, dass der Schütze, wer es auch immer war, sich keine bessere Zielscheibe hätte aussuchen können. Was natürlich nicht ganz hinhaut. Noch sind Ganoven nicht zum Abschuss freigegeben, und ein Ganove scheint Jefferson Page - nach allem zu urteilen - durchaus gewesen zu sein.«
»Inwiefern?«, wollte Staatsanwalt Simmons wissen.
Stein überließ es Sergeant Lane zu antworten. Dieser zuckte die Achseln.
»Nichts, was sich klar umreißen ließe«, erklärte er. Er hatte mit den verschiedensten Leuten über Jefferson Page gesprochen - unter anderem mit der nicht mehr ganz jungen, aber noch blendend aussehenden Ehefrau Jeffersons, die dieser vor drei Jahren sitzengelassen hatte - seine dritte bereits, nebenbei bemerkt. Nun ja, jetzt war sie seine Witwe. Die Scheidung war allerdings bereits eingereicht gewesen. Er war einfach unerträglich, wie Isabel Page zu Lane geäußert hatte. Er hatte immer Druck auf sie ausgeübt. Es gibt viele Arten, wie ein Mensch anderen gegenüber unerträglich sein kann.
Haltlos, hatte sie gesagt. Nein - schlimmer, viel schlimmer! Er - nun, er behandelte alle Leute wie den letzten Dreck. Für ihn zählte nur ein Mensch auf der Welt: Jefferson Page. Alle anderen waren für ihn Luft. Sie wusste, er war tot. Man soll nicht schlecht von Toten reden - schon gar nicht sie verleumden. Ihr Ex - nein, er lebte ja nicht mehr -, ihr verstorbener Mann war einfach unerträglich. Grace sagte das auch; sie hätte es am eigenen Leibe erfahren und Joan ebenfalls. Und seine Zukünftige - diese Terry würde auch noch dahinter kommen. Sie hatte es ihr gesagt. Grace könnte es ihr bestätigen, nur dass Grace irgendwo in Kalifornien lebte und die Kleine gar nicht kannte.
»Und seine erste Frau? Joan?«, fragte Simmons.
»Sie ist tot - schon seit etlichen Jahren - in einer Heilanstalt gestorben. Sie konnte einfach nicht damit fertig werden, sitzengelassen worden zu sein. Sie war zu zart und labil. Eine Frau müsste Nerven aus Stahl haben, um mit Jeff Page leben zu können, und hart sein. Wenn sie es nicht von Natur aus war, musste sie es werden. Isabel Page erzählte mir, dass sie fast fünf Jahre verheiratet waren, bis ihm eine Jüngere über den Weg lief, eine Hübschere... Sie wäre ganz anders gewesen, bevor sie ihn heiratete. Eines Tages merkte sie, dass sie auch unmöglich zum Beispiel zu Kellnern wurde, nämlich so, wie er mit ihnen umsprang - gegenüber Verkäuferinnen genauso, einfach allen Leuten gegenüber, die sich nicht wehren konnten. Er machte sie gemein und kratzbürstig. Mit ihm zu leben, wäre nach Isabels Worten einfach...«
»Sehr kritisch gegen sich selbst«, meinte Simmons, als Lane seine Wiedergabe des Gesprächs beendet hatte. »Müsste eine gute Analytikerin abgeben, würde ich sagen. Klingt allerdings recht verbittert.«
»Das zweifelsohne«, bemerkte Lane. »Sie schien direkt froh zu sein, sich einmal gründlich über ihn ausgesprochen haben zu können. Ganz gleich, wie sie früher war, jetzt jedenfalls ist sie knochenhart. Hat sie assimiliert, wie man so schön sagt.«
»Nun ja, jedenfalls nicht gerade das Musterbeispiel einer unvoreingenommenen Zeugin.«
Das lag auf der Hand, fand auch Lane. Staatsanwalt Simmons klärte seinen beiden Vis-a-vis darüber auf, dass auf diesem Material keine Anklage gegen Charles Halstead aufzubauen war. Zumindest keine, die standhalten konnte - mit drei Personen, die bereit waren zu beschwören, dass Halstead sich zur Tatzeit in ihrer unmittelbaren Nähe befunden hatte, also nicht dort gewesen sein konnte, wo jemand durch die offenstehende Terrassentür in Jefferson Pages Haus eingedrungen war und dem an seinem Schreibtisch sitzenden Page eine Kugel in den Kopf geschossen hatte.
»Eine eigenartige Sache«, äußerte Lane, »niemand, der Page gekannt hat, scheint objektiv gegen ihn gehandelt zu haben. Seine zweite Frau - die Polizei in Los Angeles hat dieser die Nachricht überbracht und einwandfrei festgestellt, dass sie Samstagabend in Los Angeles war - behauptet, dass Page einen Mann dafür bezahlt habe, sie zu verleumden, damit er das für die Scheidung in New York notwendige Beweismaterial beibrachte und beeidete. Damit war Page frei für Nummer drei: Isabel. Grace bezeichnete ihren ehemaligen Gatten schlicht als vulgär.«
»Er hat bei seinen Frauen keinen allzu guten Eindruck hinterlassen«, stellte Simmons fest. »Seine derzeitige oder besser ausgedrückt die derzeitige Mrs. Page muss doch mindestens ein Drittel seines Vermögens erben, wenn nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass dies nicht unbeträchtlich ist.«
Auch da waren schon Fühler ausgestreckt worden. Aber es brauchte seine Zeit, genaue Zahlen festzustellen - besonders, wenn diese sich hoch genug beliefen. Vor allem dann, wenn das Geld in verschiedenen Objekten angelegt war, wie zum Beispiel in einem Haus im Stadtteil Greenwich-Village, das allein seine hunderttausend Dollar wert sein dürfte. Vorausgesetzt, dass sich ein Käufer fand, der darauf erpicht war, einen vierstöckigen Kasten in der neunzehnten Straße zu kaufen.
»Na ja, ein paar Millionen auf jeden Fall«, meinte Stein. »Er war durch seinen Vater gut gebettet und kannte durch ihn einen Haufen Leute. Hat ganz den Anschein, als ob er auf mehreren Gebieten tätig gewesen ist. Dürfte dabei allerhand Leuten auf die Füße getreten sein. Sollte mich nicht wundern, wenn nicht auch auf manchen Nacken. Ein widerwärtiger, verschlagener Hund, schimpfte einer der Leute, die die Jungs auf dem Revier vernommen haben. Dieser Zeuge war beispielsweise in der Textilbranche tätig. War - ist es aber nicht mehr. Lebt jetzt von einer Pension, die ihm Pages Textilfabrik zahlt, was gleichbedeutend mit Jefferson Page ist - oder besser: war!«
»Schön klingt das nicht«, fand Simmons. »Er muss sich rücksichtslos, um nicht zu sagen unrechtmäßig, angeeignet haben, was ihm unter die Finger kam. Aber das will ja heutzutage nicht viel heißen. Es gibt eine Menge rücksichtsloser Leute, die trotzdem leben. Aber Page ist tot. Weiß man etwas, ob er in letzter Zeit jemandem besondere Daumenschrauben angelegt hat?«
»Bisher nicht.«
»Lim einmal irgendwo anzusetzen - wo war zum Beispiel Mrs. Isabel Page am fraglichen Abend um die fragliche Zeit? Isabel Page, die ein Drittel des bestimmt nicht unbeträchtlichen Vermögens ihres verstorbenen Gatten erbt? Isabel Page, die womöglich gar nicht so reich ist, wie es für Sergeant Lane den Anschein hat? Isabel Page, die vielleicht ein Faible für Geld und Geldausgeben besitzt? Isabel Page, die durch ihre fünfjährige Ehe verbittert geworden ist.«
»Nein, der falsche Dampfer!«, erklärte Lane. »Da sind Sie auf dem falschen Dampfer, Mr. Simmons. Sie liegt im Sankt-Vincents-Hospital, frisch operiert. Befindet sich zwar auf dem Wege der Besserung, hat aber noch Tag und Nacht eine Schwester um sich. Sie durfte gerade das erste Mal kurz aufstehen. Ich habe sie dort aufgesucht im Krankenhaus. Außerdem glaube ich nicht, dass sie Geld nötig hat. Sie bestätigte das aus freien Stücken etwa folgendermaßen: Was immer man über ihn sagen mag, eines muss man Jefferson lassen - er zahlte anständig, wenn er einen loswerden wollte.«
»Und die Scheidung?«
»Wie sie mir berichtete, drängte sie seit zwei Jahren darauf. Aber Page wollte nicht. Dann, eines Tages, hatte Pages Anwalt ihr geschrieben, dass sich sein Mandant scheiden lassen möchte. Das war vor ungefähr einem halben Jahr. Nach monatelangem Hin und Her hatten sich ihr Anwalt und Pages Vertreter geeinigt. Eigentlich hatte sie vor zwei Monaten nach Nevada gehen wollen, dann war aber ihre Operation dazwischengekommen.
»Naja, jetzt braucht sie nicht mehr nach Nevada zu gehen«, meinte Simmons. »Kam Pages Einwilligung, sich scheiden zu lassen, beziehungsweise sein Wunsch nach Scheidung, für sie überraschend?«