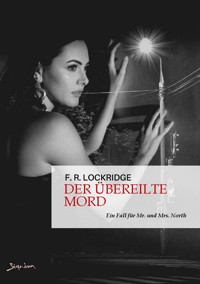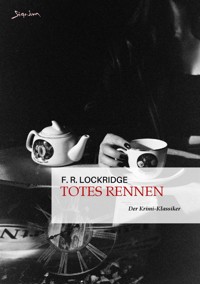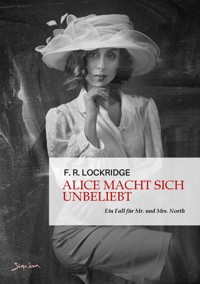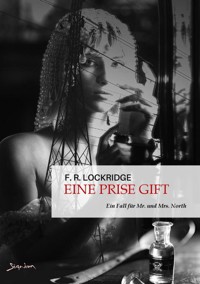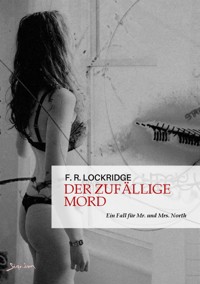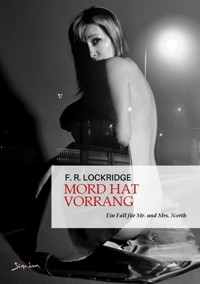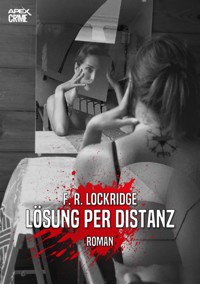5,99 €
Mehr erfahren.
Es begann mit Kleinigkeiten, mit Dingen ohne wirkliche Bedeutung. Damit, dass Linda Parks ihr gelbes Seidenkleid vermisste, dass Joyce Holbrook sie auf einer flüchtig hingeschriebenen Notiz mit Lindy, anstatt wie gewohnt mit Linda ansprach, und mit einem abrupt abgebrochenen Telefonanruf eines Unbekannten...
Der Roman Jagd über die Dächer von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1958; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1959.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
Jagd über die Dächer
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
JAGD ÜBER DIE DÄCHER
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Das Buch
Es begann mit Kleinigkeiten, mit Dingen ohne wirkliche Bedeutung. Damit, dass Linda Parks ihr gelbes Seidenkleid vermisste, dass Joyce Holbrook sie auf einer flüchtig hingeschriebenen Notiz mit Lindy, anstatt wie gewohnt mit Linda ansprach, und mit einem abrupt abgebrochenen Telefonanruf eines Unbekannten...
Der Roman Jagd über die Dächer von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1958; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1959.
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
JAGD ÜBER DIE DÄCHER
Erstes Kapitel
Es begann mit Kleinigkeiten, mit Dingen ohne wirkliche Bedeutung. Damit, dass Linda Parks ihr gelbes Seidenkleid vermisste, dass Joyce Holbrook sie auf einer flüchtig hingeschriebenen Notiz mit Lindy, anstatt wie gewohnt mit Linda, anredete, und mit einem abrupt abgebrochenen Telefonanruf eines Unbekannten.
Jedenfalls waren diese unbedeutenden Zwischenfälle der Anfang einer Reihe von Ereignissen, die Linda nicht so schnell wieder vergessen sollte.
Am Donnerstag, dem 25. Juli, zehn Minuten vor sechs Uhr abends stand Linda Parks, ein junges Mädchen von zweiundzwanzig Jahren, mit schwarzem Haar, tiefblauen Augen und einem sanft modellierten Gesicht auf dem Treppenabsatz im vierten Stock eines Hauses in der Morton Street. Sie wechselte ihre Einkaufstasche von der rechten in die linke Hand und drehte den Türknauf. Merkwürdig, die Tür war nicht verschlossen! Sie stieß sie auf und trat in einen heißen, kleinen Raum. Mit ihrer klaren, kühlen Stimme rief sie: »Hallo!« Und als niemand Antwort gab, nochmals etwas lauter. Doch offensichtlich sprach sie nur zu sich selbst.
In einer mit einem Vorhang abgeschlossenen Nische stand ein Gaskocher auf einem Kühlschrank neben dem kleinen Spülbecken. Hier stellte sie die Tasche mit vier Hammelkoteletts, einem Paket tiefgekühltem Blumenkohl, einem Kopf Salat und einem Viertelliter Milch in einem Karton auf den Kocher. Dann ging sie durch das Wohnzimmer in das etwas kleinere Schlafzimmer hinüber. Nochmals zu rufen war sinnlos, da Joyce offenbar nicht hier war. Dies war eigentlich gegen ihre Verabredung.
Bevor Linda am Morgen weggegangen war, um wieder einen Tag in den Vorzimmern der Agenturen herumzusitzen, hatte Joyce den Vorschlag gemacht, am Abend daheim zu essen. Für einen Augenblick trat das Wort daheim in Lindas Gedanken in den Vordergrund. Daheim bedeutete für sie weit weg, daheim war für sie eigentlich ein großes Haus mit Bäumen rundherum, in der Umgebung von Centerview in Iowa. Doch sofort flackerte die Erkenntnis in ihr auf, dass es dies nicht mehr gab. Ihr Daheim war nun hier. Hier, in dieser kleinen, trübseligen Wohnung.
Bring etwas für die schlanke Linie, hatte Joyce empfohlen und noch hinzugefügt: Wie wär’s mit Hammelkoteletts? Gut, ich werd’ sie besorgen. Damit war Linda gegangen. Ein schlankes und hübsches Mädchen, das trotz der Hitze so frisch aussah wie nur irgendetwas. Den Tag hatte sie dann bei Agenturen verbracht, wo sie überall den gleichen Bescheid, dass man keine Rollen zu vergeben habe, bekommen hatte. Aber vielleicht in der nächsten Woche, hatte man sie vertröstet, dafür seien allerdings Gesangskenntnisse erforderlich. Oh, ja, man hatte sie stets sehr höflich behandelt, jedoch - in den meisten Fällen wenigstens - unpersönlich. Immer wieder wurde ihr auch versprochen, dass man sie anriefe.
In einer angenehm kühlen Imbissstube, die voll war von jungen Leuten, die genau wie sie nach einer, wenn auch noch so kleinen, Chance Ausschau hielten, hatte sie dann ein Sandwich mit Thunfischsalat - neun Zehntel davon waren Sellerie - gegessen und dazu eine Flasche Coca-Cola getrunken.
Linda hatte Joyce Holbrook vor zweieinhalb Wochen kennengelernt. Sie teilten die Wohnung lediglich miteinander, um Geld zu sparen. Sie hatten zusammen die nötigsten Möbel so billig wie möglich erstanden, und so waren sie eben hier. Keiner brauchte dem anderen Rechenschaft darüber abzulegen, was er tat. Wenn sich für eine von ihnen irgendetwas ergab, hatte das vor einer Verabredung, die sie miteinander getroffen hatten, jederzeit den Vorrang. Und so war Linda auch jetzt, da Joyce anscheinend ihre Absicht geändert hatte und ausgegangen war, nicht ungehalten.
Mit den Hammelkoteletts musst du dich halt abfinden, sagte sie sich ohne jegliche Verärgerung. Joyce würde ihren Anteil bezahlen, und darüber hinaus gab es keine Verpflichtung. Merkwürdig war nur, dass Joyce die Wohnungstür nicht abgeschlossen hatte. Das sah ihr eigentlich gar nicht ähnlich. Vielleicht war auch nur wieder das Schloss kaputt. Linda sah nach, doch es war in Ordnung.
Nach einer Weile beschloss sie, ins Bigelow zu gehen, um ein Sandwich zu essen. Vielleicht lief auch ein guter Film, und wenn nicht, dann konnte sie sich in der Bibliothek am Washington Square noch etwas zum Lesen holen. Sie legte die Lebensmittel in den Kühlschrank und betrachtete dabei ihren Alkoholvorrat - eine halbe Flasche Gin und eine viertel Flasche Korn -, nahm sich aber dann doch nur ein Coca-Cola heraus. Für Alkohol war es zu heiß, und insgeheim bevorzugte sie sowieso Coca-Cola. Das werd’ ich mir wohl abgewöhnen müssen, dachte sie amüsiert und ging mit ihrem Coca-Cola nach vorn in das Wohnzimmer. Es war aber auch hier nicht kühler, wie sie einen Augenblick gehofft hatte.
Linda schaltete den kleinen, nicht gerade leisen Ventilator ein und setzte sich davor. Der Luftzug wirbelte ihr ein Stück Papier in den Schoß. Sie erkannte sofort die Handschrift. Joyce hatte also doch eine Nachricht hinterlassen. Sie las die Notiz in der ihr vertrauten Schrift - eine Notiz, die, wie sie beiläufig feststellte, in großer Eile geschrieben worden sein musste.
Liebe Lindy!
Bin übers Wochenende mit den Nichols aufs Land. Erinnerst Du Dich an die Nichols? Bin Montag zurück.
Unterzeichnet war das Ganze mit einem J und mit einem Schnörkel.
Das war’s also, dachte sich Linda. Welches Glück Joyce hatte! Dabei stieg in ihrer Vorstellung wieder das Bild eines großen weißen Hauses auf, das zwischen Bäumen auf einer Wiese stand, aus der bei Nacht trotz der Tageshitze Kühle aufstieg.
Wer waren denn eigentlich diese Nichols, an die sie sich erinnern sollte?
Während der zwei Wochen Bekanntschaft waren Joyce und sie nur ein einziges Mal zusammen ausgegangen - zu jener formlosen Cocktailparty, von der ihr heute noch nicht klargeworden war, wer sie eigentlich gegeben hatte. Vermutlich hatte sie dort auch die Nichols kennengelernt wie so viele andere. Ihr fiel der drahtige, semmelblonde Mann namens Bowen - oder hieß er Bower? - ein, der irgendwie mit der Staatsanwaltschaft zu tun hatte. Und dann war da noch der Schwarzhaarige, der Jenks - oder vielleicht auch Banks? - hieß und in einer Agentur beschäftigt war. Aber an die Nichols konnte sie sich im Augenblick wirklich nicht erinnern. Na gut, vielleicht hatte Joyce da irgendetwas verwechselt.
Es war sehr heiß. Sie zog das Kleid, das buchstäblich an ihr klebte, aus und saß nun in Büstenhalter und Höschen da. Die gegenüberliegenden Häuser waren zwar niedriger, aber wenn jemand in größerer Entfernung auf den Gedanken kommen sollte, ein Fernglas zu benutzen - bitte sehr! Wenn sie erst einmal auf der Bühne tanzen würde - wenn dies die noch so kleine Chance sein sollte -, so würde sie weniger anhaben als jetzt, und das vor mehr Leuten.
Sie nahm einen Schluck Coca-Cola und dachte an Joyce, die nun irgendwo auf dem Land war. Und da sie nichts anderes zu tun hatte, beschäftigten sich ihre Gedanken wieder mit Joyces kurzer Mitteilung. Komisch, so grübelte sie schläfrig, warum schrieb sie Lindy? Kein Mensch nannte sie so. Und auch Joyce hatte es noch nie getan. Als kleines Mädchen war sie manchmal Lin gerufen worden, doch das war lange her.
Blödsinn, über die Geschichte überhaupt nachzudenken. Linda trank den Rest Coca-Cola aus. Sie würde jetzt eine Dusche nehmen, frische Wäsche anziehen und dann hinaus an die Luft gehen. Später, wenn es sich etwas abgekühlt hatte, konnte sie ihr Kleid, das sie tagsüber getragen hatte, durchs Wasser ziehen und zum Trocknen aufhängen. Es waren auch noch ein paar andere Kleinigkeiten zu waschen.
Das Wasser kam zuerst lauwarm, allmählich frischer und zuletzt richtig kalt aus der Dusche. Es planschte und spritzte nur so auf sie herunter. Es ist wundervoll! Mir wird auch wirklich kühler, dachte sie. Ich fröstele ja schon. Endlich frottierte sie sich ab und betrachtete sich im Spiegel in der Türfüllung - der übrigens einer der Gründe war, warum sie sich zu diesem Appartement entschlossen hatten -, und sie war mit ihrem Aussehen recht zufrieden. Wollen wir nur hoffen, sagte sie zu ihrem Spiegelbild, dass wir auch das nötige Talent besitzen, damit etwas anzufangen. Sie ging zu dem Kleiderschrank, den sie miteinander teilten, und suchte im Halbdunkel nach ihrem Kleid - dem gelbseidenen, das ihre schlanke Figur so vorteilhaft zur Geltung brachte.
Es dauerte eine Weile, bis sie begriff, dass das Kleid gar nicht da hing, wo es hängen sollte, und dann stellte sie fest, dass es überhaupt nicht da war. Sonderbar - nicht gerade wichtig, nicht aufregend, aber sonderbar.
Jetzt erst fiel ihr auf, wie erstaunlich wenige Kleider auf Joyces Seite hingen. Sie hatte beide Abendkleider mitgenommen - das lange und das kurze -, dazu alle Sommerkleider und auch ihr Tweedkostüm. Wenn die Nichols - ganz gleich, wer sie waren - nicht gerade in Maine lebten, war es verrückt, jetzt ein Herbstkostüm mitzuschleppen. In der Reinigung konnte es auch nicht sein, da es von dort ja erst kürzlich zurückgekommen war.
Linda zuckte ihre schmalen Schultern. Was ging es sie schließlich an, was Joyce für das Wochenende mitnahm! Anscheinend hatte sie eben fast alle ihre Sachen mitgenommen. Doch wo war das gelbe Seidenkleid geblieben? Sie wusste genau, dass es noch vorige Nacht an seinem alten Platz gehangen hatte. Die einleuchtendste Erklärung, die aber auch noch absurd genug blieb, war, dass Joyce sich das Kleid ausgeliehen hatte, obwohl sie selbst auch ein hübsches Seidenkleid besaß.
Soweit sie es nach einer Bekanntschaft von zweieinhalb Wochen beurteilen konnte, gehörte Joyce allerdings nicht zu den Leuten, die sich etwas ausborgten, ohne vorher zu fragen. Außerdem - und das war entscheidend - konnte Joyce das Kleid auf keinen Fall tragen. Sie war ein Meter fünfundsiebzig groß und wog hundertachtzehn Pfund, die allerdings bestens verteilt waren. Das konnte nicht geleugnet werden. Doch niemals würde ihr ein Kleid passen, das für Lindas zarte, kleine Gestalt gemacht war.
»Hm«, machte Linda nachdenklich und suchte weiter. Aber das Kleid fand sich nicht. Sie schaute noch unter das Bett - Joyce schlief hier im Schlafzimmer, während Lindas Couch im Wohnzimmer stand. Eine unklare Neugier war in ihr wach geworden und verwirrte sie.
Joyce hatte sowohl den Kosmetikkoffer als auch die große Tasche mitgenommen. Der mittelgroße Koffer lag noch unter dem Bett. Die große Tasche wäre für ein Wochenende wahrlich ausreichend gewesen. Linda stand wieder auf. Unsicherheit befiel sie. War es am Ende möglich, dass Joyce sich für immer auf und davon gemacht hatte und sie nicht nur mit den Hammelkoteletts und dem Blumenkohl, sondern auch mit der ganzen Wohnung hatte sitzenlassen? Linda vermochte dies einfach nicht zu glauben und trat in Gedanken vertieft an das einzige Fenster des Schlafzimmers, das auf die Morton Street hinausging - ein zierliches und ungemein anziehendes Mädchen, das, was sie ganz vergessen hatte, völlig unbekleidet war.
Als sie sich dessen plötzlich bewusst wurde, sprang sie mit einem erschreckten »Huch!« vom Fenster zurück. Was war denn nur los mit ihr? Es gab doch gar keinen Grund, sich so in diese Sache zu verbohren, wies sie sich selbst zurecht.
Joyce war offensichtlich in großer Eile gewesen, wahrscheinlich, um noch den Zug zu erreichen. Und in dieser Eile war dann eben beim Packen ganz zufällig auch ihr eigenes Seidenkleid unter die Sachen von Joyce geraten. Ganz bestimmt war es so gewesen!
Linda verbannte die Angelegenheit aus ihren Gedanken. Sie zog sich schnell an, machte ihr Gesicht etwas zurecht, und als sie die vier Treppen hinunterging, war es gerade Viertel nach sechs. Sie ging durch die Morton Street in Richtung Sixth Avenue und von da, immer auf der Schattenseite, zur Eighth Avenue. Schon von weitem sah sie das Reklameplakat für einen Film, den sie gerne sehen wollte. Im Bigelow setzte sie sich an die Theke, wo es angenehm kühl war, und bestellte ein Roastbeef-Sandwich und einen Eiskaffee.
Sie kam zu der 19.30-Uhr-Vorstellung noch bequem zurecht. Wenn der Film auch nicht ganz das hielt, was die Reklame versprochen hatte, so war er doch ganz nett und zeitweise sogar spannend.
Nach dem Kino ging Linda zur Washington-Square-Bibliothek und nahm sich von dort zwei Bücher mit. Dann ging sie nach Hause in ihre Wohnung, wo es inzwischen kühler geworden war. Linda war streng gegen sich selbst und wusch zuerst ihre kleine Wäsche, bevor sie zu lesen begann.
Es war 23.20 Uhr, als das Telefon läutete. Sie nahm den Hörer ab und meldete sich mit: »Hallo!«
»Miss Holbrook«, sprach eine männliche Stimme, »es handelt sich um das Engagement, dessentwegen Sie uns geschrieben haben. Wir haben Sie für morgen um...«
»Moment«, unterbrach ihn Linda. »Miss Holbrook ist nicht zu Hause. Ich wohne nämlich mit ihr zusammen.«
»Oh!« machte der Mann, und Linda glaubte einen seltsamen Ton aus seiner Stimme herauszuhören. »Wissen Sie vielleicht, wo ich sie erreichen könnte, Miss...?«
»Parks«, ergänzte Linda. »Ich fürchte, nein. Wenigstens nicht ganz genau. Sie ist zum Wochenende weggefahren.«
Der Mann sagte wieder: »Oh!«, und in seiner Stimme lag, wie Linda meinte, etwas wie Erstaunen oder vielleicht auch Unsicherheit.
»Sind Sie ganz sicher?«, fragte er dann. »Weil...«
Linda wartete, aber er sprach nicht weiter.
»Wieso?«, fragte sie. »Miss Holbrook hinterließ eine Notiz und hat auch einen Teil ihrer Sachen mitgenommen. Wieso glauben Sie...«
»Ist nicht so wichtig. Wissen Sie, wohin sie gefahren ist?«
»Sie schrieb nur, dass sie mit den Nichols aufs Land gefahren sei«, gab Linda Auskunft. »Aber ich kenne die Nichols nicht. Obwohl...«
»Also gut«, beendete der Mann das Gespräch, »wir werden uns später mit Miss Holbrook in Verbindung setzen.«
Damit hängte er, für Lindas Empfinden etwas plötzlich, ein. Sie legte nachdenklich den Hörer auf und betrachtete das Telefon mit Misstrauen.
Mein Gott, ein Engagement! Joyce würde sich selbst ohrfeigen, wenn sie davon erfuhr! Für diesen Mann natürlich war alles in Ordnung. Eigentlich hätte er auch sagen können, wer er war, oder er hätte wenigstens eine Nachricht hinterlassen können. Bloß zu sagen, sie würden sich mit Joyce in Verbindung setzen! Linda hatte in der kurzen Zeit, in der sie in New York war, schon eine ganze Menge gelernt. Eins davon war, dass der Satz: Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen meistens das letzte war, was man von einer Agentur hörte. Man war eben im richtigen Augenblick da - was sie selbst bisher noch nicht gewesen war -, oder man war es nicht. Es war eine Glückssache.
Übrigens eine ungewöhnliche Zeit, jemanden wegen eines Engagements anzurufen, ungewöhnlich selbst für einen Theateragenten. Oder war es jemand vom Fernsehen gewesen? Freilich, solche Leute waren den ganzen Tag beschäftigt und dachten sich nichts dabei. Ein Engagement, dessentwegen Sie uns geschrieben haben'? Wie sonderbar! Man schrieb doch nicht. Man telegrafierte nicht einmal! Man eilte höchstpersönlich hin, und das, so schnell es die hohen Absätze, die langen Beine und die U-Bahn schafften.
Doch es hatte ja nun wirklich keinen Sinn, hier zu sitzen, das Buch im Schoß, und über eine Sache nachzugrübeln, über die man nicht das Geringste wusste. Am Montag würde sich vermutlich alles...
Linda merkte, wie sie langsam in den Schlaf hinüberglitt. Sie zog sich aus, löschte das Licht und streckte sich lang aus. Im selben Augenblick war sie auch schon eingeschlafen.
Sie träumte von Joyce. Joyce - groß, schlank und sehr blond. Sie trafen sich wieder dort, wo sie sich damals beide um ein Engagement beworben hatten, nur war jetzt das Vorzimmer dunkel und voll Stimmen, die qualvoll in wirrem Gemurmel zu vernehmen waren. Sie gingen dann auch wieder in die gleiche Imbissstube, um ein Sandwich zu essen und Coca-Cola zu trinken. Aber dann - und das war bestimmt nicht in Wirklichkeit passiert - war Joyce vom Stuhl aufgesprungen, aus dem Lokal hinausgestürzt und hatte dauernd geschrien: Sie sind hinter mir her, hinter mir her, hinter mir her! Die Worte schienen ihr wie ein Schleier nachzuflattern. Linda rannte ihr nach, und dann war Joyce verschwunden. Nun war Linda diejenige, die weiterrannte und schrie: Sie sind hinter mir her! Dabei trug sie vier Hammelkoteletts in der linken Hand. Die Koteletts hatten Rüschen aus weißem Papier. Natürlich kennen Sie die Nichols! rief ein semmelblonder Mann ihr zu, in der schnellen, abgehackten Sprechweise des Ostens. Sie haben eine Verabredung mit den Nichols. Erinnern Sie sich nicht?
Linda wusste, dass sie träumte, und versuchte mit Gewalt, sich zum Erwachen zu bringen. Erinnere dich!, hatte der semmelblonde Mann, gerade als sie aufwachte, heftig gerufen.
Linda zündete sich eine Zigarette an und rauchte sie in langsamen Zügen. Dann drückte sie sie sorgfältig aus und schlief einigermaßen beruhigt wieder ein, diesmal, ohne zu träumen.
Als sie in dem sehr hellen und heißen Zimmer erwachte, war es schon acht Uhr vorbei. Vage erinnerte sie sich an den Traum als an ein quälendes Trugbild, in dem Joyce verfolgt wurde. Doch dann, als sie unter der Dusche stand - sie dankte Gott für das fließende Wasser in dieser Hitze -, überfiel sie unvermittelt die Frage: Fürchtete sich Joyce vor irgendetwas?
Darauf gab es eigentlich keine Antwort, denn die Frage in sich war schon verrückt. Während sie ihren Orangensaft trank, Kaffee machte und das Brot in den Toaster legte, versuchte Linda ihrer Unruhe auf den Grund zu gehen. War es nur die unklare Auswirkung ihres Traumes? Oder war der Traum, von dem sie nur noch Joyces ängstliche Flucht in Erinnerung behalten hatte, nicht die Ursache, sondern die Folge einer Vermutung in ihrem Unterbewusstsein?
Gedankenvoll knabberte sie ihren Toast, trank den Kaffee und zündete sich dann eine Zigarette an. Nein, es gab wirklich keine Antwort. Ausgenommen, setzte Linda ihre Überlegung fort, dass Joyce, wie ihr jetzt rückblickend auffiel, in den vergangenen Tagen - etwa ab Montag - den Eindruck erweckte, als ob sie sich über irgendetwas Sorgen machte. Sofern Sorgen machen der richtige Ausdruck dafür war.
Linda dachte angestrengt nach. Wie war das doch gleich gewesen? Ja, natürlich - jetzt erinnerte sie sich, dass Joyce in den letzten Tagen jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, bat: Geh doch du dran oder, wenn die Türklingel läutete: Sieh erst nach, wer es ist, bevor du ihn herauflässt, ja? Es war immer recht umständlich gewesen, erst eine lange Unterhaltung über die Sprechanlage, die sowieso nie richtig funktionierte, zu führen, anstatt wie üblich, einfach die Haustür zu öffnen und erst festzustellen, wer es war, wenn er heraufkam und man ihn sah. Und hatte Joyce nicht auch ungewöhnlich lange an den Fenstern im Wohnzimmer gestanden und hinunter auf die Morton Street geschaut, in der es bei Gott nichts Interessantes zu sehen gab?
Zum Teufel mit diesen Hirngespinsten!, dachte Linda. Sie brachten sie noch ganz durcheinander. Sie machte da aus einer Mücke einen Elefanten. Sie riss sich zusammen und wusch ihr Geschirr ab. Dann ging sie zur Tür, um die Herold Tribune von draußen reinzuholen und sah, dass sie vergessen hatte, die Tür abzuschließen. Und wieder kehrten ihre Gedanken zu Joyce zurück, die am Dienstagabend, nachdem sie beide zu Bett gegangen waren, noch vom Schlafzimmer aus gefragt hatte: Hast du auch abgeschlossen? Ihrem Natürlich! hatte sie nicht geglaubt, sondern war noch einmal aufgestanden, um nachzusehen.
Komisch, dass Joyce vergessen hatte, abzuschließen, bevor sie verreiste. Wo sie doch selbst so ängstlich war. Sie hatte die Tür nicht abgeschlossen, sie hatte an den heißesten Sommertagen ein Herbstkostüm eingepackt und ein Kleid, das ihr nicht gehörte, hatte sie mit Lindy angeredet, eine Anrede, die sie sonst nie gebrauchte, und hatte ihr beinahe mit Gewalt einzureden versucht, dass sie Leute kenne, von denen Linda jetzt genau wusste, dass sie nie von ihnen gehört hatte. Wollte sie ihr am Ende damit etwas sagen? Linda kam dieser Gedanke, als sie mit der Herald Tribune auf dem Schoß am Fenster saß.
Doch schon im gleichen Augenblick, da ihr die Bedeutung dieser Frage so recht zum Bewusstsein kam, wehrte sich ihr gesunder Menschenverstand heftig dagegen. Wie albern man doch sein konnte, wies sie sich zurecht. Sie machte aus einem Maulwurfshaufen ein Gebirge. Und dabei gab es nicht einmal einen Maulwurfshaufen. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit entschlossen der Herald Tribune zu.
Kurz nach neun Uhr war Linda Parks dann fertig angekleidet. Sie hatte sich reichlich Zeit gelassen, denn schließlich war es wichtig für sie, wie sie aussah. Das war eines der Dinge, die sie in die Waagschale zu werfen hatte. Mit etwas Glück würde sich daran so schnell nichts ändern. Was allein der Friseur in New York an Geld verschlang! - Linda hatte gelernt, sich ins beste Licht zu rücken. Ihr Gang, ihre Bewegungen, die Art, wie sie sprach und unter ihren langen Wimpern hervorblickte, dazu ihr frisches junges Gesicht und nicht zuletzt auch eine hübsche Sommergarderobe waren von unschätzbarem Wert für ihre Zukunft.
Ganz ohne Grund blieb Linda an einem der Fenster stehen und schaute auf die Morton Street hinunter. Über der Straße, auf den Sandsteinstufen zum Eingang eines Mietshauses, lag ein Mann der Länge nach ausgestreckt. Er war recht gut angezogen, noch ziemlich jung und allem Anschein nach betrunken. Die Leute, die vorübergingen, beachteten ihn nicht, und er hatte anscheinend auch für nichts Interesse. Wie sie so hinunterschaute, sah sie, wie der Kopf des Mannes nach hinten fiel, so dass es aussah, als ob er zu ihr hinaufblickte. Sein Gesicht war zur Seite gefallen, sein Mund stand offen, und man konnte sehen, dass er nichts von alledem begriff, was um ihn herum vorging. Er machte eine verlorene Geste, so, als ob er eine Fliege vom Gesicht wegscheuchen wollte.
Ja, man musste sich schon hässliche Dinge ansehen. Aber es hatte keinen Zweck, darüber nachzudenken. So war es eben.
Als Linda kurze Zeit später auf der Straße war, vermied sie es peinlich, in die Richtung des betrunkenen Mannes zu blicken. Wenn man diese Leute ansah, konnten sie unter Umständen lästig werden. Sie fuhr stadteinwärts zu einer Theateragentur, die angeblich ein junges Mädchen suchte, das tanzen und auch ein bisschen singen konnte. Die Vermittlung sei bereits am Tag zuvor erfolgt, gab man ihr dort Bescheid, aber man würde ganz bestimmt an sie denken.
»Sie brauchen mich nicht anzurufen. Das werde ich tun«, hatte Linda dem gutaussehenden jungen Mann in dem grauen Anzug erklärt. Er hatte gegrinst und gesagt: »Machen Sie sich nichts daraus. Sie werden es sicher noch schaffen.«
Da es Linda bisher noch nie in den Sinn gekommen war, dass sie es nicht schaffen könnte, sagte sie ohne Ärger: »Natürlich»! und ging, um es bei einem Fernsehstudio zu versuchen. Als es dort auch nicht klappte, ging sie zu einer Theateragentur, wo ihr ein müder junger Mann mit einer Stimme, als ob er den ganzen Tag nichts anderes gesagt hätte, erklärte: »Heute keine Vermittlung!« Bei einer anderen Agentur, wo man sie aufgefordert hatte, einige Fotos vorbeizubringen, dauerte es etwas länger.
Danach beschloss sie, für heute aufzugeben und nach Hause zu fahren. An Joyce Holbrook hatte sie den ganzen Vormittag noch nicht gedacht. Da sie keinesfalls Sehnsucht nach ihrer heißen, ungemütlichen Wohnung in der Morton Street verspürte, zog sie den Heimweg noch etwas hinaus. Sie betrachtete die Auslagen mit den hübschen Dingen, die sie sich nicht leisten konnte, und kaufte sich zum Trost, und weil sie sie brauchte, ein Paar Strümpfe.
Langsam bummelte sie über den Washington Square. Für eine kleine Weile setzte sie sich auf eine Bank im Schatten eines Baumes und sah den spielenden Kindern zu. Drüben auf der anderen Seite des Weges saßen zwei alte Männer beim Schachspiel. Ein Mann - ein in keiner Weise attraktiver Mann - setzte sich neben sie, näher als es nötig war und obwohl noch andere Bänke frei waren. Wahrscheinlich dachte er sich nichts Böses dabei, aber - aber man hatte eben die Vorsicht einer jungen Katze angenommen, und wie so ein junges Kätzchen stand sie auf und stolzierte davon.
Es war schon nach drei Uhr, als sie die wenigen Steinstufen zum Eingang in das Haus in der Morton Street hinaufstieg. Der Mann, der am Morgen auf der anderen Seite der Straße ausgestreckt dagelegen hatte, war weg. Vermutlich war er wieder nüchtern geworden. Als sie die Wohnungstür aufschloss, schlug ihr dumpfe, heiße Luft entgegen. Gott, war das eine Hitze!
Ich wollte, irgendjemand würde mich aufs Land einladen, dachte Linda. Man könnte an einem schattigen Platz sitzen, vielleicht unter einem Ahornbaum, dort, wo der Schatten am tiefsten war und wo es, sogar während des Tages, kühl schien. Es war selbstverständlich anders, doch es schien so. In New York aber hatte man dieses Gefühl niemals, obwohl die Temperatur nicht so hoch stieg. Außer im Herbst, vermutete Linda. Oder im Frühjahr. Vom Winter hatte ihr Joyce berichtet: Warte nur, bis du einmal einen New Yorker Winter mitgemacht hast. Dieser Wind um das Empire State Building - brrr! Warte nur!