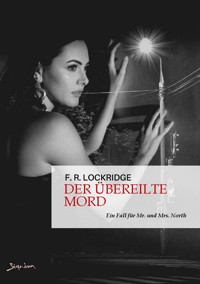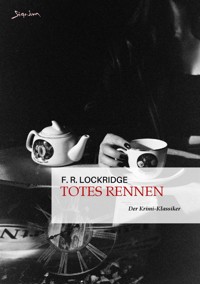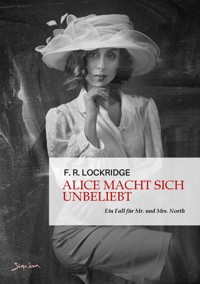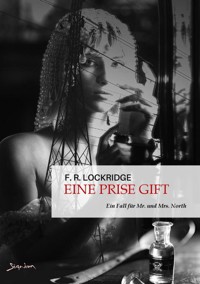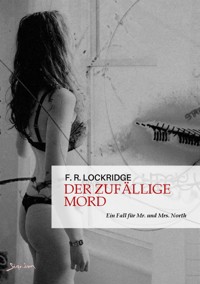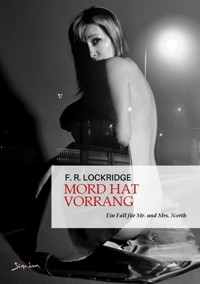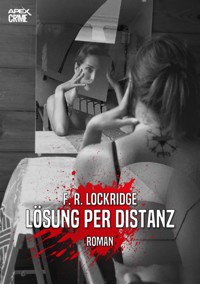
5,99 €
Mehr erfahren.
Einer der Männer lag tot auf dem Boden, die Pistole neben seiner Hand. Der andere saß zurückgesunken an der Wand, eine Schusswunde zwischen den Augen. Wer hat zuerst geschossen? Captain Heimrichs Theorie: keiner von beiden! Und ein dritter Toter liefert den Beweis...
Der Roman Lösung per Distanz von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1963; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
Lösung per Distanz
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
LÖSUNG PER DISTANZ
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Das Buch
Einer der Männer lag tot auf dem Boden, die Pistole neben seiner Hand. Der andere saß zurückgesunken an der Wand, eine Schusswunde zwischen den Augen. Wer hat zuerst geschossen? Captain Heimrichs Theorie: keiner von beiden! Und ein dritter Toter liefert den Beweis...
Der Roman Lösung per Distanz von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1963; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
LÖSUNG PER DISTANZ
Erstes Kapitel
Als sie durch die Tür auf den Gehsteig der Van Brunt Avenue trat, prallte ihr die Hitze entgegen. Es war erst Mitte Mai, aber man kam sich vor wie Ende Juni. Drei Tage zuvor hatte man sich an Anfang März erinnert gefühlt. Das Seltsame am Mai ist, dass man sich nie wie im Mai vorkommt, dachte Enid Vance. Allerdings musste man zugeben, dass das für den Mai hier im Hudson-Tal, Bezirk Putnam, Bundesstaat New York, typisch war.
Man musste aber froh sein, dass es endlich warm geworden war; wenigstens bestand keine Gefahr von Glatteisstellen mehr auf der schmalen Straße hinauf zum Far Top. Enid klemmte sich die Aktenmappe unter den linken Arm und machte sich auf den Weg zu ihrem kleinen Wagen, der vor der Bank stand. Sie ging aufrecht und mit schnellen Schritten, wie es sich für eine freiberufliche Sekretärin gehörte, die dienstlich unterwegs war.
Sie war ziemlich groß und ging hochaufgerichtet, um das noch zu betonen. Sie war schlank und brachte auch dies durch ihre Haltung besser zur Geltung. Sie hatte braunes Haar, das bei bestimmter Beleuchtung - wie jetzt in der Sonne - einen roten Schimmer zeigte, und dunkelbraune Augen. Sie war sechsundzwanzig Jahre alt. Weil am Vortag ein Mann namens Scott Lenox Vorschuss bekommen hatte, rechnete sie damit, an diesem Abend in Garrison im Bird and Bottle Hummer vorgesetzt zu bekommen. An diesem warmen Nachmittag Mitte Mai ließ sich also nicht das Geringste aussetzen.
Ein schlanker Junge mit großen grauen, ernsten Augen kam auf sie zu, gezogen von einer riesigen dänischen Dogge. Der Hund ließ die Zunge heraushängen und erweckte den Eindruck, als halte er den Maitag für viel zu warm.
»Guten Tag, Miss Vance«, sagte der Junge. Er blieb stehen und sah zu ihr auf. Der Hund setzte sich.
»Guten Tag, Michael«, sagte Enid. »Guten Tag, Colonel. Ist das nicht ein herrlicher Tag?«
Der große Hund drehte den Kopf zur Seite. Er wollte nicht unhöflich sein, hatte aber Wichtigeres zu bedenken.
»Sehr schön«, sagte der Junge. »Die Bücherei ist geschlossen.« Er machte eine Pause. »Obwohl es schon fast drei Uhr ist.«
Enid meinte, das sei merkwürdig. Die Van-Brunt-Bibliothek war Montag bis Freitag von 14 Uhr bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.
»Professor Wingate ist nicht da«, sagte Michael. »Das Licht brennt, aber die Tür ist abgesperrt. Glauben Sie, dass Professor Wingate krank ist? Er ist schon ziemlich alt, nicht?«
»Wahrscheinlich ist er nur kurz weggegangen«, sagte Enid.
Michael dachte einen Augenblick nach und nickte schließlich.
»Komm, Colonel«, sagte er, und der große Hund stand auf. »Auf Wiedersehen, Miss Vance.« Der Hund sah Enid Vance traurig an.
Enid, die zu ihrem Wagen ging, brauchte nicht hinzusehen, um zu wissen, wohin die beiden wollten. Sie würden ein Geschäft betreten, an dessen Schaufenster Susan Faye, Stoffe zu lesen war. Colonel, den Enid ziemlich gut kannte, würde wohl hoffen, dass die Mutter seines jungen Idols die Klimaanlage eingeschaltet hatte.
Der kleine schwarze Wagen stand mit geschlossenen Fenstern vor dem Gebäude der First National Bank. Sie öffnete die Fahrertür und kurbelte das Fenster herunter. In dieser Hitze hätte man ein Hühnchen grillen können, dachte Enid. Sie stieg ein und kurbelte japsend das andere Fenster herunter. Wenn ich erst mal fahre, wird es kühler, dachte sie und fuhr los, auf der Van Brunt Avenue Richtung Norden. Die Avenue war zugleich die Staatsstraße 11 F. Sie kam an der Bibliothek vorbei, fuhr langsamer und betrachtete das Gebäude - ein weißes Holzhaus, etwas von der Straße zurückgesetzt. Die Tür war geschlossen. Wirklich ein bisschen merkwürdig, aber...
Es mochte ein Dutzend Gründe dafür geben, warum Loudon Wingate, emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Dyckman, jetzt Bibliothekar in Van Brunt, seine Bücherei geschlossen hatte. Vielleicht aus einer Laune heraus. Wahrscheinlicher war, dass er mit seinem uralten Packard unterwegs war, um eine Spende abzuholen. Die Bibliothek in Van Brunt lebte vorwiegend von Spenden. Die Leute stöberten auf ihren Speiehern herum und fanden alte Scharteken, worauf sie einander erklärten, dass die Bücherei froh darum sei. Andere brachten sie einfach mit und stapelten die verstaubten Bände im Leseraum. Rücksichtsvollere baten den Bibliothekar, sie aufzusuchen und sich die Bücher anzusehen, bevor man sie den Flammen übergebe. Das konnte es sein. Professor Wingate schaute sich irgendwo Bücher an.
Die Verkehrsampel an der Kreuzung mit der Staatsstraße 109 schaltete gerade auf Rot. Mrs. Sanderson überquerte die Straße, ihren Bobby an der Hand. Sie schaute in den Wagen, grüßte und meinte, man fühle sich schon wie im Sommer, nicht?
Die Ampel wartete geduldig auf andere Verkehrsteilnehmer, die das grüne Licht für die Staatsstraße 109, die Elm Street, nutzen wollten. Niemand tat es. Endlich warnte ihr Gelb die Elm Street, und ihr Grün lud Enids Auto und in der Gegenrichtung den neuen roten Lastwagen von Elmer Hobbs, sanitäre Anlagen und Heizungen, zum Weiterfahren ein. Eimer junior winkte Enid Vance grüßend zu, wie es sich unter ehemaligen Schulkameraden gebührte.
Im Winter konnte Enid nicht verstehen, warum sie hier lebte, wo sie geboren und aufgewachsen war. Im Winter dachte sie an die Großstadt, an ein gemütliches, warmes Apartment, an die Untergrundbahn für verschneite Tage, an die relative Gewissheit pausenloser Stromversorgung. In der Großstadt könnte sie als Sekretärin eine feste Stellung annehmen und mehr Geld verdienen, um die kärglichen vierteljährlichen Einkünfte aus dem Rest des Vance-Vermögens aufzubessern. Sie würde nicht mehr über vereiste Stellen die Straße zum Far Top hinauffahren müssen, wie sie es den ganzen endlosen Winter über getan hatte.
Aber jetzt war Sommer, oder doch beinahe Sommer. Und der Sommer war wieder etwas ganz anderes. Sommer hieß, dass die Leute aus ihren Löchern hervorkamen, Sommer hieß, dass Belle Sanderson mit Bobby über die Straße ging und grüßte. Sommer hieß, dass Elmer Hobbs aus einem grellroten Lastwagen winkte und nicht verzweifelt eingefrorene Leitungen auftauen musste. Im Sommer war es ein Vergnügen, mit dem Wagen auf der Staatsstraße 11 F zu fahren, die keine wichtige Verkehrsader war. Der Wind blies jetzt durch die Fenster und verwirrte kurzes braunes Haar, das rötlich schimmerte.
Sie fuhr an dem Schild mit der Aufschrift: Sie verlassen Van Brunt, Bezirk Putnam und an einem zweiten mit dem Text: Cold Harbor, Bezirk Putnam vorbei. Inzwischen hatte sie Van Brunt Center zwei Meilen hinter sich gelassen. Nach einer weiteren Meile bog sie links auf eine schmale Teerstraße ein, und ein Schild warnte knapp kurvenreich. Es war auch eine Bergstraße - sie kletterte vom Tal, in dem sich die Staatsstraße 11 F entlangschlängelte, zum letzten Hügelkamm über dem Hudson-Fluss empor, kletterte, unter nicht zu vielem anderen, zu Far Top hinauf. In Far Top wohnte Homer Lenox ganz allein, der letzte Lenox im Hudson-Tal.
Darauf lief es hinaus, dachte Enid, während sie den kleinen Wagen um die scharfen Kurven lenkte. Dem alten Herrn passte das gar nicht, aber darauf lief es hinaus. Der alte Herr hatte versucht, das zu ändern, aber es blieb trotzdem dabei. Scott war ein Lenox nur dem Namen nach. Man konnte einen Stiefsohn adoptieren, ihm einen Namen geben und meinen - was meinen? Dass die Menschen später vergessen, was sie jetzt wissen? Dass es in ein paar Generationen so aussieht, als sei die Familie Lenox nicht ausgestorben?
Vor allem aber, wie konnte man glauben, dass sich die Menschen dafür überhaupt interessierten? Genau das - die felsenfeste Überzeugung des Mannes, dass es sie interessierte - war unerklärlich, aber man musste es akzeptieren. Der alte Herr hatte eine Manie, wenn es um eine Familie ging, nicht nur um seine eigene.
Und das war der Grund, der Enid Vance, freiberufliche Sekretärin, nach dem Abschreiben von Manuskripten eine schmale, steile Nebenstraße zu einem weiträumigen, uralten weißen Haus namens Far Top hinaufführte. Wie hatte man 1799 Baumaterial so hoch hinaufschaffen können? Und wie waren die Leute hinaufgekommen, um dort zu wohnen? Vor allem im Winter?
Das Manuskript in der Aktenmappe neben ihr erzählte davon nichts. Es berichtete vieles über die Lenox’, die Mitchies und, natürlich, die Van Brunts, aber nichts davon. Über Far Top hatte Homer Lenox nur geschrieben: Von Virgil Lenox 1799 errichtet, ist Far Top, im Laufe der Jahre kaum verändert, ein Denkmal für eine vergangene Zeit.
Es waren nicht eigentlich Häuser, für die sich Homer Lenox interessierte, sondern die Familien, die darin gewohnt hatten. Die Familien im Bezirk Putnam, so hieß der Titel des Buches, das Homer Lenox im vorgerückten Alter schrieb, und das Enid Vance - deren Familie auch kurz erwähnt wurde - mit zwei Durchschlägen für fünfzig Cent pro Seite tippte. Fünfzig Cent pro Seite plus Benzinkosten, die bei dem kleinen Wagen nicht hoch waren, dazu Abschreibungskosten für den Wagen. Enid lächelte. So war er, der alte Homer, sehr gewissenhaft. Er hatte über drei Stunden gebraucht - drei Stunden in einem zu warmen Zimmer, vor einem sengenden Feuer -, um eine Abschreibungsentschädigung zu errechnen, die allen Beteiligten gerecht wurde.
Die Familien im Bezirk Putnam. Das war der Titel. Kein Titel für einen Bestseller, wie Scott ab und zu meinte. Nur wenige Leute würden zu ihrem Buchhändler rasen, um sich ein Exemplar des Buches zu sichern, solange der Vorrat reichte.
»Nicht modern«, pflegte Scott Lenox zu sagen. »Nicht anreißerisch. Das muss man einsehen, meine Liebe.«
Ob Scott Lenox darüber auch mit seinem Stiefvater, der ihn gesetzlich adoptiert hatte, sprach, wusste Enid nicht. Sie bezweifelte es eher. Scott würde meinen, dass ihn das nichts anginge; außerdem wollte er einen älteren Mann, den er gern hatte, wenn auch nicht überschwenglich, nicht aufregen. Nachsicht - die pflegte man Homer Lenox gegenüber zu üben.
Im Übrigen gab sich der alte Herr keinen Illusionen hin.
»Kein Mensch wird das Ding kaufen«, hatte er zu Enid gesagt. »Das ist mir völlig klar, Miss Vance. Es ist eben das Steckenpferd eines alten Mannes.«
Homer Lenox neigte überhaupt dazu, sein Alter häufig ins Treffen zu führen. Man hätte glauben mögen, er gehe auf die Neunzig zu. Tatsächlich war er ein schlanker, braungebrannter Mann Ende Sechzig. Nicht mehr jung, gewiss, aber immerhin...
Das Buch würde auf Kosten von Homer Lenox erscheinen. Da es mit Fotografien illustriert werden sollte, musste man mit erheblichen Beträgen rechnen. Aber das geht mich nichts an, dachte Enid, während sie die letzte Kurve bewältigte. Scott könnte das Geld besser verwenden, aber ihn und mich geht es nichts an. Es war allgemein bekannt, dass auch das Vermögen der Lenox’ im Lauf der Jahre geschrumpft war. Der alte Homer war aber ein ziemlich erfolgreicher Rechtsanwalt gewesen und konnte es sich leisten, diesen Tribut an die Größe der Familien zu finanzieren, die früher um so viel größer, soviel bedeutungsvoller gewesen waren als jetzt.
Er hat Familien gesammelt, dachte Enid, wie manche Männer Briefmarken sammeln. Sie bog in eine Kieseinfahrt ein, zwischen zwei imposanten Torsäulen. In eine davon hatte man Far Top gemeißelt.
Die Einfahrt führte um einen riesigen Felsblock herum, den zu umgehen man 1799 für zweckmäßig gehalten hatte. Am Scheitelpunkt der Kurve, bevor die Auffahrt vor dem Haus einen Halbkreis beschrieb, hielt Enid, wie gewohnt, den Wagen an. Von hier aus konnte man alles sehen - den majestätischen Fluss tief unten, West Point jenseits davon; man konnte nach Norden blicken, über ein Tal hinweg, und das graue Steingebäude der Mitchies sehen, konnte über die Steinmauern rings um das Mitchie-Haus sehen. Von dort konnte man sogar das ganz andere, niedrige, elegante und moderne kleine Haus sehen, das John Mitchie für seinen Sohn John, gebaut hatte. In dem riesigen alten Bau wohnte ein Mann ganz allein, in dem kleinen Haus John Mitchie junior mit Frau und drei Kindern.
Drei Kinder zu haben, entsprach gar nicht der Art der Mitchies, dachte Enid. Der Großvater fand die Kopfzahl seiner Enkel sicherlich zu hoch. Sie fuhr weiter und hielt vor Far Top, das sie mit seinen vielen kleinen Fenstern anblinzelte.
Sie hielt hinter einem uralten, aber säuberlich polierten schwarzen Packard: Professor Wingates schwarzen Packard. Seit Lenox an seinem Buch schrieb, lieh sich die Van-Brunt-Bibliothek auf seine Bitte hin bei größeren Büchereien allerlei Bände aus, und Professor Wingate hatte sie nach Far Top gebracht.
Der Raum, in dem Homer Lenox arbeitete, war vollgestopft mit alten Büchern und vergilbten Zeitungen, meist Exemplaren des Putnam Recorder.
Sie ging zur Eingangstür, an der eine kleine Holzplakette mit der Jahreszahl 1799 angebracht war.
Die Tür war nicht ganz geschlossen. Enid klopfte mit dem großen Messingklopfer, der ein hallendes Geräusch von sich gab. Niemand rührte sich.
Die alten Herren würden im Arbeitszimmer, tief in dem großen Haus mit seinen vielen kleinen Zimmern, sitzen - in dem Haus, wo sich Geräusche nicht fortpflanzten. Und ältere Herren hören manchmal nicht mehr so gut. Sie wunderte sich eigentlich nicht darüber, dass sie keine Antwort bekam.
Enid stieß die Tür weiter auf und rief: »Mr. Lenox?« Sie wartete und versuchte es noch einmal, lauter diesmal. Sie glaubte, ein leises, schlurfendes Geräusch zu hören, aber danach blieb alles still, und sie rief noch einmal, mit großer Lautstärke, so dass es klang, als schreie sie den Namen des alten Herrn hinaus.
Aber selbst jetzt blieb die Antwort aus. Enid klemmte die Mappe unter den linken Arm und betrat das Haus. Sie ging den Korridor entlang, der zu dem kleinen Arbeitszimmer führte.
Die Tür war geschlossen. Sie klopfte und rief noch einmal: »Mr. Lenox?«
Sie rief es nicht laut und öffnete die Tür.
Homer Lenox lag mit dem Gesicht nach unten auf dem gebohnerten Dielenboden. Sein rechter Arm war ausgestreckt, und vor den scheinbar danach greifenden Fingern der rechten Hand lag ein Revolver. Im Fallen hatte er einen Tisch mit Bücherstapeln gestreift, und die Bücher waren auf ihn herabgestürzt.
Professor Loudon Wingate, Bibliothekar in Van Brunt, saß auf der anderen Seite des Raumes mit dem Rücken an der Wand. Er schien sie mit offenen Augen anzustarren, aber zwischen seinen Augen war ein Loch.
Er hat drei Augen, dachte sie hysterisch. Er hat drei Augen!
Langsam, als habe er unendlich viel Zeit, sank Loudon Wingate auf die Seite. Die vergilbten Zeitungen auf seinem Schoß rutschten auf den Boden.
Zweites Kapitel
Als man sie fragte, ob sie sicher sei, dass beide Männer tot seien, hatte sie gesagt: »Ja, ich bin sicher, dass sie tot sind.« Als man sie fragte, ob sie warten könne, bis jemand käme, hatte sie gesagt: »Ja, ich warte.« Beide Male wiederholte sie die Worte der Fragen, wiederholte sie ohne Grund. Sie war wie betäubt. Es kam ihr vor, als würde ihr schlecht werden. Für Fliegen war es noch etwas früh, aber in dem kleinen Zimmer waren Fliegen gewesen. Vor allem eine, größer als die anderen, die durch das kleine Zimmer summte.
Das Telefon stand auf einem Tisch in der Eingangshalle von Far Top. Nachdem sie den Hörer auf die Gabel zurückgelegt hatte, blieb sie einen Augenblick sitzen, die Hand noch auf dem kühlen Apparat. Dann hatte sie gedacht: Ich brauche nicht hierzubleiben, hier im Haus. Ich brauche nicht hier bei den Toten zu sitzen.
Sie stand auf, verließ das Haus und ging zu ihrem Wagen. Sie legte die Mappe auf den Sitz, öffnete die Tür, um einzusteigen, schloss sie aber wieder. Das Innere des Autos würde einem engen Zimmer gleichen. Sie ging davon, die Auffahrt entlang, bis sie die Stelle mit der Aussicht erreichte und starrte auf den Hudson hinunter. Ein Schlepper zog Lastkähne stromaufwärts. Der Schlepper glich einer besorgten Glucke mit großen, ungeschickten Küken. Am Heck eines Lastkahns hatte jemand Wäsche zum Trocknen aufgehängt.
Sie hatten miteinander gekämpft und sich gegenseitig getötet. Einer hatte den anderen erschossen. Sie waren in Streit geraten und hatten zur Gewalt gegriffen. Aber sie waren alte Männer. Die Alten sind nicht gewalttätig. Für die Alten hat nichts mehr diese Bedeutung. So musste es doch sicher sein, wenn man alt wurde; alles verlor den Glanz. Wenn ich alt bin, wird der Strom nicht mehr so funkeln, dachte sie. Der Strom wird grau sein, wie alles, was ich sehe.
Sie wandte den Blick von dem glitzernden Strom ab, schaute hinüber zum Haus der Mitchies, über die Mauer. Der Swimming-Pool zwischen dem kleinen, niedrigen Haus und dem massiven, grauen Gebäude war gefüllt. Die Kinder tobten im Bedien herum, im seichten Wasser. Grace Mitchie, im weißen Badeanzug mit Sonnenbrille, lag auf einem Faltbett. Die Kinder machten sicher Lärm, aber Enid konnte sie nicht hören. Sie waren zu weit entfernt.
Sie hatte angenommen, dass sie zuerst eine Sirene hören würde, aber man gebrauchte die Sirene nicht. Sie hörte das Knirschen der Reifen auf dem Kies, erhob sich von dem Felsvorsprung, auf dem sie gesessen hatte, und ging zum Haus zurück. Das Polizeiauto hielt hinter ihrem Wagen. Zwei uniformierte Beamte stiegen aus. Einer davon war Raymond Crowley. Ray war in dieselbe Schule gegangen wie Enid, aber in eine höhere Klasse. Manchmal hatte Crowley sie ins Kino begleitet.
Jetzt war er sehr ernst, ganz im Dienst. Er sagte: »Hallo, Enid.« Nach einer kurzen Pause fragte er: »Mr. Lenox und Professor Wingate?«
Sie hatte das seltsame Gefühl, dass er ihr Gelegenheit geben wollte, einen Irrtum zu berichtigen.
»Ja, Ray«, sagte sie. »Beide. Sie sind - im Haus. Im Arbeitszimmer.«
Der andere Beamte der Staatspolizei schritt bereits auf das Haus zu. Seine Stiefel glänzten.
»Ziemlich warm für die Jahreszeit«, sagte Ray Crowley. »Wird wohl ein heißer Sommer werden.«
Es hatte nichts zu bedeuten, es waren nichts als Worte, die eine Pause füllen sollten.
»Ja«, sagte sie. »Sie sind beide tot, Ray. Die beiden alten Männer sind tot.« Sie sah auf ihre Hände hinunter und bemerkte, dass sie zitterten.
»Immer mit der Ruhe«, sagte er. »Tief atmen.«
Der zweite Polizeibeamte kam aus dem Haus und sagte: »Ja. Schon seit ein paar Stunden, glaube ich. Schusswunden. Nur eine Waffe, soviel ich sehen konnte.«
»Das ist Fergus«, sagte Ray. »Paul Fergus. Miss Vance, Paul.«
»Scheußliche Überraschung für Sie«, meinte Fergus.
Raymond Crowley ging zum Fahrzeug und griff nach dem Funkgerät.
»Hier Crowley, Far Top. Beide sind tot. Paul meint, es sei schon ein paar Stunden her. Könnte Mord und Selbstmord sein.« Er lauschte. »Gut, wir warten.« Er kam zu den anderen zurück. »Sie sind unterwegs«, erklärte er. »Bitte, warten Sie, Miss Vance.«
Es hatte nichts zu bedeuten, dass er sie Miss Vance nannte. Natürlich nicht, außer, dass er, als Polizeibeamter, eine Bitte der Polizei übermittelte. Nein - einen Befehl.
»Selbstverständlich«, sagte sie, ging zu ihrem Wagen und stieg ein.
Ein zweites Polizeiauto mit zwei uniformierten Beamten erschien, dann ein Wagen mit rotem Dachblinker und der Aufschrift Staatspolizei New York, und schließlich eine graue Limousine ohne Beschriftung, aber mit langer, wippender Funkantenne. Zwei große Männer in Zivil stiegen aus und gingen ins Haus. Einer von ihnen blieb kurz stehen und sprach mit Crowley, der sich auf der Veranda postiert hatte. Dann verschwanden sie beide im Haus, und Männer mit Kameras und Koffern stiegen aus, um ihnen zu folgen. Nach etwa zehn Minuten trat einer der Männer in Zivil aus dem Haus, ging zu Enids Wagen und sagte: »Tut mir leid, dass ich Sie warten lassen muss, Miss Vance. Bin gleich bei Ihnen.«
»Schon gut, Captain«, sagte sie und sah Captain M. Heimrich von der New Yorker Staatspolizei nach, als er zu seinem Fahrzeug ging und einstieg. Sie sah ihn ins Mikrofon sprechen, konnte aber nicht verstehen, was er sagte. Eine schwarze Limousine traf ein, der ein Mann mit Arzttasche entstieg. Er ging zum Haus, sprach mit Crowley und trat ein.
Sie war froh, dass Ray Crowley zu ihnen gehörte. Es machte zwar keinen Unterschied, aber es war trotzdem einfacher, weil sie Ray kannte und auch Captain Heimrich, wenn auch nur flüchtig. Auf irgendeine Weise überbrückte das den - den Abgrund zwischen dem Vertrauten, Gewohnten und Alltäglichen und diesem seltsamen, schrecklichen, beinahe nicht fassbaren Vorfall.
Enid kannte Susan Heimrich, seit sie denken konnte - hatte sie als Mädchen gekannt, das eine höhere Klasse besuchte, als sie noch Susan Upton hieß und in einem weißen Haus auf einem Hügel lebte, während Enid in einem anderen weißen Haus auf einem anderen Hügel wohnte.
Ein kleines Mädchen namens Enid Vance. Ein größeres Mädchen namens Susan Upton. Die Jahre zwischen ihnen waren eine Kluft, wie stets in der Kindheit. Keine Freundschaft, aber das Wissen, dass es den anderen gab, dass man ihn akzeptierte.
Enid konnte sich erinnern, wie man die Brauen hochgezogen und getuschelt hatte, als Susan einen Mann namens Michael Faye heiratete, der ein feiner Mann war, aber von auswärts kam; aus The Flats, wo die Häuser nicht gerade weiß waren und schon gar nicht auf einem Hügel standen. Die Entfernung zwischen The Flats und den weißen Häusern war nicht sehr groß, in Meilen gemessen.
Es war beruhigend, ja, tröstlich, über diese Dinge nachzudenken, während sie auf Captain Heimrich wartete, der jetzt Susans Mann war und sie bald fragen würde, wie es komme, dass sie an einem sonnigen Nachmittag im Mai zwei alte Männer tot in einem kleinen, düsteren Zimmer gefunden hatte. Es war tröstlich, sich daran zu erinnern, dass sie an einem Samstagnachmittag im vergangenen Herbst auf der Terrasse des Heimrich-Hauses Cocktails getrunken hatte.
Heimrich stieg aus seinem Wagen, erstaunlich wendig für einen so großen und schweren Mann, und trat auf Enids Auto zu. Er hatte strahlend blaue Augen in einem kantigen, sonnenverbrannten Gesicht. Er musste sich tief bücken, um mit ihr durchs offene Fenster sprechen zu können.
»Ein schlimmes Erlebnis für Sie«, sagte Heimrich. »Wie kam es dazu, Miss Vance?«
»Sind sie beide tot?«, fragte sie. »Haben sie sich gegenseitig umgebracht?«
»Sie sind beide seit mehreren Stunden tot«, erwiderte Heimrich. »Seit einiger Zeit vor Mittag, grob geschätzt. Der Pathologe wird es natürlich genauer bestimmen können. Miss Vance...« Aber er verstummte und lächelte sie plötzlich an. »So bekommen Sie nur einen steifen Hals und ich Rückenschmerzen«, meinte er. »Vielleicht setzen wir uns auf die Veranda.«
Sie setzten sich auf die Veranda, in Korbsessel nebeneinander, einige Meter von der Haustür entfernt, durch die Männer hineingingen und herauskamen. Heimrich achtete nicht auf sie.
»Ob sie einander umgebracht haben, wissen wir nicht, Miss Vance«, sagte er. »Es könnte so gewesen sein. Offenbar gibt es nur eine Waffe - die Mr. Lenox gehörte. Er hatte einen Waffenschein dafür. Aber sie könnten um den Besitz der Waffe gerungen haben. Wir...« Er verstummte wieder. Der Mann mit der Arzttasche trat aus dem Haus und schaute sich um, und Heimrich sagte: »Hierher, Doktor.« Der Arzt kam auf sie zu.
»Zwischen zehn Uhr vormittags und mittags«, erklärte der Arzt. »Der Professor einmal, was völlig genügte. Es ging schnell. Lenox zweimal, was nicht so schnell ging. Keine Kontaktwunden.«
»Wingate könnte Lenox erschossen haben«, sagte Heimrich. »Lenox war vielleicht trotzdem noch in der Lage, Wingate zu erschießen, wenn er die Waffe an sich zu bringen vermochte. Nicht umgekehrt?«
»Vom medizinischen Standpunkt aus«, sagte der Arzt. »So sieht es aus, medizinisch betrachtet. Oder Wingate könnte zuerst Lenox und dann sich selbst erschossen haben, wenn er die Waffe auf Armlänge von sich entfernt gehalten hat. Falls sein Arm lang genug war. Was nicht der Fall ist, meiner Schätzung nach.«
»Danke, Doktor.«
»Schicken Sie sie mir«, sagte der Arzt und entfernte sich.
»Es sah so aus, als - als hätten sie -miteinander gekämpft«, sagte Enid. »Wobei manches umfiel.«
»Ja. Wie kam es, dass Sie sie gefunden haben, Miss Vance?«
Sie erklärte es ihm. Ab und zu nickte er, ab und zu schloss er die Augen.
»Er hat Sie heute Nachmittag erwartet?«
»Gewöhnlich kam ich am Freitag. Ich brachte mit, was ich getippt hatte und holte ab, was er während der Woche geschrieben hatte. Eine feste Zeit war nicht vereinbart. Wenn er wegging, legte er das Manuskript auf den Tisch in der Halle. Neben das Telefon. Ich hinterließ, was ich geschrieben hatte und nahm sein Manuskript mit. Ach ja, manchmal war ich nicht fertig, wenn ich andere, dringendere Aufträge erledigen musste. Dann rief ich ihn an. Er - er hatte es nicht eilig.«
»Hatte er schon längere Zeit an seinem Buch gearbeitet?«
»Schon seit über einem Jahr. Er schrieb ungefähr zwanzig Seiten in der Woche.«
»Hört sich nach einem langen Buch an«, meinte Heimrich. »Glauben Sie, dass er schon fast fertig war?«
Sie nahm es an. Mit der Van-Brunt-Familie war er beinahe fertig. Bis zu...
»Mrs. Van Brunt ist vor ein paar Monaten gestorben, nicht wahr?«, fragte Enid. »Im Gefängnis?«
»Ja«, sagte Heimrich, der sie hineingebracht hatte.
»Sprach Mr. Lenox viel von Professor Wingate? Ich meine, so viel, dass Sie etwas über ihre Beziehungen erfuhren? Ob sie Freunde waren?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Professor Wingate hat ihm Bücher besorgt«, sagte sie. »Bücher und alte Urkunden, alte Zeitungen. Er lieh sich für ihn bei anderen Bibliotheken Bände aus.«
»Half er ihm bei der Abfassung des Buches? Der Professor hat doch Geschichte gelehrt. Das wäre sein Gebiet gewesen.«
Sie wusste es nicht.
»Mr. Lenox sprach ihn mit dem Vornamen an«, meinte sie. »Auf eine Art, als wären sie Freunde. Wenn er von ihm sprach, meine ich.«
»Sie haben ihn vorher nie hier gesehen?.«
Sie überlegte einen Augenblick und schüttelte den Kopf. Aber dann fiel es ihr ein, und sie erzählte Heimrich, der beim Zuhören die Augen schloss, wie sie im März in die Bücherei gekommen sei und dort Lenox mit Wingate habe sprechen sehen.
»Sie wirkten wie Freunde«, sagte sie. »Und - warten Sie. Als er ging - er hatte mehrere Bücher unter dem Arm sagte Mr. Lenox ungefähr: Also bis morgen Abend, Loudon. In diesem Sinn etwa.«
Heimrich öffnete die Augen, sah sie an und nickte.
»War mit Mr. Lenox leicht auszukommen, Miss Vance? Ich meine, soweit Sie mit ihm in Berührung kamen, versteht sich.«
»Es war nicht direkt - nun, was Sie Kontakt nennen würden«, antwortete Enid. »Ich holte das Manuskript, schrieb es ab und brachte es zurück. Manchmal, nicht oft, fragte ich ihn nach einem Wort, das ich nicht lesen konnte. Er war sehr geduldig, nicht wie manche Leute...«
»In der vergangenen Woche waren Sie auch hier?«