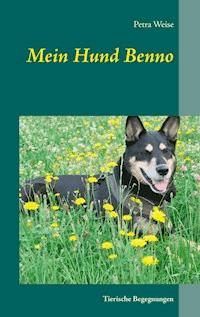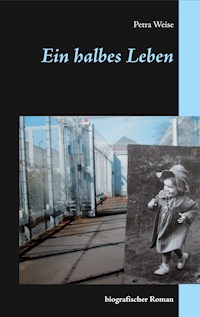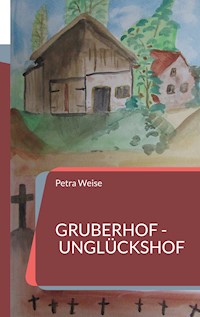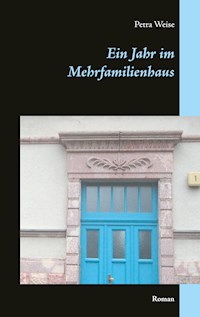Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der mürrische Karl-Günther hält nicht viel von seiner Frau und seinen vier erwachsenen Töchtern, weil ihm jede Verdruss bereitet und durch ihren Lebenswandel Schuld auf sich geladen hat. Doch dann geschieht etwas, das seine gesamte Sicht der Dinge und sogar sein Leben verändert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
An allem Unfug,
der passiert,
sind nicht etwa nur die schuld,
die ihn tun,
sondern auch die,
die ihn nicht tun.
Erich Kästner
Jede Schuld ist verständlich, wenn man ihr Werden gesehen hat.
Otto Ernst
Inhalt
Monika
Unfall
Nadine
Julie
Damals
Anklage
Emelie
Armin
Mutter
Sandra
Trauerfeier
Sonja
Familientreffen
Simon
Emelie
Schluss
Monika
Sie schläft. Ich mag nicht sehen, wie sie da so liegt mit halboffenem Mund. Sie ist alt. 65 Jahre, Rentner eben. Ich sehe trotz meiner schütteren Haare viel jünger aus als sie, obwohl ich fast fünf Jahre älter bin.
Ich weiß nicht mehr, warum ich sie damals geheiratet habe. Ich glaube, sie war recht hübsch. In der Jugend sind wohl alle schön, auch die, die es nicht sind.
Jetzt hat sie dicke Beine, Falten im Gesicht und an den Händen. Das sind nicht nur Äußerlichkeiten, innen wird sie nicht anders aussehen. Davon bin ich überzeugt.
Das einzig Sehenswerte an ihr sind ihre dichten schwarzen Haare. Ich weiß nicht, ob sie sie färbt oder nicht. Meine sind jedenfalls seit mehr als zehn Jahren vollständig grau.
Ich hätte statt einer Hübschen eine Reiche heiraten sollen, denn Reichtum vermehrt sich, das Hübschsein ist irgendwann vorbei.
Eigentlich war es recht schnell vorbei.
Den ganzen Vormittag über schlurft sie in ihren Pantoffeln durchs Haus und wischt mit einem Lappen überall entlang: im Bad, auf dem Küchentisch, über das Treppengeländer und übers Fensterbrett. Doch sie wischt nur drüber, sie putzt nicht. Ich sehe das, obwohl ich ein Mann bin und mit dem Haushalt nichts zu schaffen habe. Sie behauptet, sie hält alles sauber, doch sie wischt nur allen Dreck breit. Überall sind Schlieren. Sie sieht es nicht oder will es nicht sehen. Es ist eklig.
Monika. Sie heißt Monika. Alle ihre Freunde rufen sie Moni – ich nicht.
In meinem Arbeitszimmer darf sie nicht herumwischen, nur den Boden saugen und den Ascher leeren. Als wir vor etwa fünfundzwanzig Jahren hier einzogen, sprach sie sich gegen ein Arbeitszimmer aus, weil ich ohnehin nie daheim wäre. Als ob das eine Rolle spielt! Ein Mann braucht seinen Raum, in dem er ungestört lesen und rauchen kann. Sie wollte lieber ein Esszimmer mit Platz für die ganze Familie und Gäste. Doch ich mag keine Gäste, außerdem ist in der Küche genug Platz für einen großen Tisch.
Selbstverständlich habe ich mich durchgesetzt und mein Arbeitszimmer eingerichtet mit einem Schreibtisch aus Eichenholz, einem großen Intarsien-Schrank und einem bequemen Sessel, in dem ich vier Mal täglich meine Zigaretten rauche; und zwar immer nach den Mahlzeiten wie es sich gehört.
Der Sessel gefällt ihr nicht, doch das tut nichts zur Sache, denn es ist mein Sessel, allein für mich in meinem Reich. Unsere Kinder durften es nicht betreten. Kinder haben immer klebrige Finger und müssen damit alles anfassen. Das dulde ich nicht.
Auch heute, wo unsere vier Töchter erwachsen sind, betreten sie meinen Raum nicht. Eigentlich betreten sie das ganze Haus nicht mehr. Sie haben ihr eigenes Leben, zwei von ihnen sind sogar ins Ausland gegangen. Mir ist es nur recht, endlich meine Ruhe zu haben.
Doch Monika lässt sie nicht in Ruhe ihr Leben leben, sie ruft sie fast jeden Tag an, rennt ihnen nach, will ihnen ständig helfen und begreift nicht, dass sie erwachsen sind. Wenn Kinder erwachsen sind, muss man sie laufen lassen – wohin ihr Weg sie auch führen mag.
*****
Mich wundert, dass sie schläft - noch dazu auf dem Sofa am hellen Tag. Das hat sie noch nie gemacht.
Normalerweise verbreitet sie Hektik. Immer eilt sie, immer muss es schnell gehen. Selbst, wenn sie in der Sofaecke sitzt, fummelt sie an irgendeiner Handarbeit. Ich hasse diese ständige Emsigkeit. Wenn ich sie dafür kritisiere, widerspricht sie: „Du warst Beamter und hast den ganzen Tag bequem in deinem Drehstuhl gesessen und ruhig in deine Akten geschaut, während ich meine Augen überall haben musste.“
Überall? Was hat sie schon getan? Sie musste nicht arbeiten, hatte den ganzen Tag Zeit für den Garten, das Haus und die vier Mädchen. Mit Kindern gespielt hat sie, oft sogar mit völlig fremden. Vor allem später, als sie wieder als Kindergärtnerin arbeitete. Kinder gehören zu ihren Müttern ins Haus und nicht an solch einen fremden Ort, wo sie aufbewahrt werden, während die Mütter einer Arbeit nachgehen. Was kann aus solchen Kindern schon werden?
*****
Ich mag Krimis, sie nicht. Wir schauen uns trotzdem jeden Abend einen Krimi an. Es kommt ja nichts anderes im Fernsehen.
Manchmal stelle ich mir vor, ich sei der Mörder und würde sie töten. Dann wäre Ruhe. Ich habe schon einmal ernsthaft darüber nachgedacht. Doch ich glaube nicht, dass ich das wirklich kann: sie umbringen. Der ganze lästige Papierkram, ehe sie endlich unter der Erde wäre, ginge mir furchtbar auf die Nerven und bringt mich schon beim Gedanken daran in Wut.
Sie behauptet, ich wäre sehr schnell wütend. Das glaube ich nicht. Ich glaube vieles nicht, was sie so behauptet.
Zum Beispiel sagte sie mal, dass Frauen, die wie sie eine lieblose und egoistische Mutter hatten, meist an einen Mann gerieten, der kaltherzig, grausam und gefühllos sei. Damit meinte sie eindeutig mich. Doch wie so oft liegt sie mit ihrer Meinung völlig falsch, denn ich bin nicht grausam. Und wenn ich kaltherzig wäre und kein Gefühl hätte, hätte ich sie nicht geheiratet.
„Ich habe dich geheiratet und damit ist die Sache klar.“
„Welche Sache?“, fragt sie.
Eigentlich sollte ich darauf nicht antworten, Trotzdem sage ich: „Ich habe mich für dich entschieden.“
„Und weiter? Du glaubst wohl, jetzt hast du genug getan?“
Ich verstehe nicht, worauf sie hinaus will, weshalb sie so unzufrieden ist.
„Das ist ganz einfach. Die Heirat ist eine Sache. Das ist ein einziger Punkt. Jeden Monat kommt Rente, das ist auch nur ein Punkt. Weiter tust du nichts. Ich dagegen mache Frühstück, das Mittag, das Abendessen, die Betten, die Wäsche, putze das Haus. Das sind sechs Punkte und zwar jeden Tag. Zusätzlich gehe ich einkaufen.“
„Moment! Du tust es nicht allein für mich, sondern auch für dich.“
„Das stimmt, doch auch dein Geld ist nicht allein für mich.“
„Mein Geld ist weit mehr wert als dein Abwasch.“
„Du irrst dich! Eine Sache ist eine Sache.“
Sie ist wirklich dumm, wenn sie einen ganzen Monatsverdienst mit fünf Minuten Abwasch gleichsetzt.
Während unserer ersten Ehejahre erwartete sie sogar, dass ich mich an der Hausarbeit beteilige. Doch der Haushalt ist und bleibt reine Frauensache, auch dann, wenn sie arbeiten geht. Dann kamen an drei Jahren hintereinander die Mädchen. Sie blieb daheim und hatte genügend Zeit zum Kochen und Putzen.
Als die Jüngste drei Jahre alt war, wollte sie, dass wir alle zusammen in den Urlaub fahren. Das habe ich abgelehnt. Wozu sollte das gut sein? Es ist reine Geldverschwendung, für eine Übernachtung in der Fremde zu zahlen, obwohl man daheim sein bequemes Bett hat. Außerdem gab es vom Amt keine Ferienplätze und privat konnte man zur damaligen Zeit ohnehin nichts buchen.
Sie fuhr dann immer allein weg, ohne mich, nur mit den Mädchen und einem Zelt. Immer an die Ostsee auf eine Wiese bei Verwandten. Ich mag ihre Verwandten nicht. Ich mag auch das Meer nicht und schon gar nicht das flache Land. In bin in Karl-Marx-Stadt geboren, was jetzt Chemnitz heißt. Und hier werde ich bleiben und auch sterben.
Nur nicht so bald.
*****
Schon zu Zeiten, in denen ich im Amt arbeitete, schätzte ich einen geregelten und genau strukturierten Tagesablauf. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Pünktlich um acht Uhr wünsche ich mein Frühstück. Darauf bestehe ich, auch wenn sie sich lieber noch länger im Bett herumwälzen würde. So etwas dulde ich nicht.
Ich hasse es, wenn sie im Morgenmantel am Tisch sitzt. Sie zieht sich trotzdem niemals ordentlich an. Im Haus und auch im Garten trägt sie eine Kittelschürze und darunter eine Jogginghose. Sie findet das praktisch. Doch so läuft man nicht herum, auch dann nicht, wenn es keiner sieht. Nur, wenn sie zum Einkaufen in die Stadt muss, zieht sie sich etwas Ordentliches über und macht dabei ein Riesentheater. Mehrmals wechselt sie die Bluse und die Schuhe. Dabei sieht sie in jedem Kleid gleich aus mit ihren Falten im Gesicht und den dicken Beinen.
Früher hatte sie Geschick, sich zu kleiden. Das muss ich zugeben. Trotzdem wollte sie immer wissen: „Geht das?“ Wenn ich dann ehrlich antwortete: „Das musst du selber wissen“, war sie beleidigt.
Ich trage Tag für Tag Hemd und Hose und wenn ich vor die Tür gehe, mein dunkles Jackett und einen Schlips; wie es sich für einen Mann meines Standes gehört.
Meist hockt sie schräg auf ihrem Stuhl, als ob sie gleich wieder aufstehen und etwas herbeiholen will. Ich mag sie nicht anschauen. Deshalb lese ich jeden Morgen beim Frühstück die Zeitung, obwohl mich der Mist, der darin steht, überhaupt nicht interessiert. Und jeden Morgen meckert sie, weil ich lese und sie nicht unterhalte. Was soll ich schon sagen? Und warum? Ich bin nicht dafür zuständig, sie zu unterhalten. Und ich bin ihr auch keine Rechenschaft schuldig, warum ich dies mache und jenes nicht. Das ist allein meine Sache.
Früher wollte sie immer, dass ich ihr ein paar Seiten meiner Zeitung abgebe. Die Kulturseite und die Todesanzeigen. Doch man zerpflückt eine Zeitung nicht in ihre Einzelteile. Es hat seinen Grund, weshalb eine Nachricht auf der ersten oder letzten Seite steht oder einfach mittendrin. Sie kann die Zeitung haben, wenn ich mit ihr fertig bin, eher nicht. Doch so lange wollte sie nicht warten.
Sie ist eben stur.
Mit großen Schlucken trinke ich meinen heißen Kaffee und greife blind nach dem Wurstbrötchen, das sie mir hinlegt. Immer eins mit Leberwurst und eins mit Salami. Anders will ich es nicht haben. Käse lehne ich ab, derartige Absonderlichkeiten aus verschimmelter Milch braucht sie mir gar nicht erst vorzusetzen.
Nach dem Frühstück drehe ich meine Runde. Zuerst gehe ich Richtung Kirche, dann am Friedhof entlang und durch den Park zurück. Im Büdchen kaufe ich meine Zigaretten.
*****
Das Büdchen ist ein kleiner Laden, der Dinge verkauft, die es früher in einem Kiosk gab wie Zeitschriften, Süßigkeiten und Zigaretten. Ich kaufe schon immer die gleiche Sorte. Früher war sie rot verpackt und hatte eine weiße Schrift. Heute kann man die Sorten nicht mehr so leicht unterscheiden, weil auf jeder Schachtel die gleichen grauenhaften Bilder abgedruckt sind von amputierten Armen und Beinen, verfaulten Organen und halbtoten Kindern. Der Verrückte, der dafür gesorgt hat, dass statt des Namens für ein Genussartikel derartig grässliche Bilder aufgedruckt und verbreitet werden, gehört in Behandlung – und zwar in die geschlossene.
Man kann im Büdchen auch Lotto spielen. Ich spiele kein Lotto, doch ich weiß, dass Monika jede Woche ihren Tippschein abgibt. Sie ist eben dumm und kann nicht einmal rechnen, weil ein Gewinn höchst unwahrscheinlich ist. Die Chance für einen Sechser steht bei geringer als Eins zu einer Million. Ich hatte schon erwogen, ihr weniger Taschengeld zu zahlen, doch dann müsste ich das begründen und für einen Streit mit ihr ist mir meine Zeit zu schade.
Ich streite nicht einmal mit ihr, wenn sie im Büdchen Kaffee trinkt. Im Stehen! So etwas tut man nicht.
Die Frau, der der kleine Laden gehört, weiß über jeden Nachbarn, was es zu wissen gibt. Ich will nichts über die Nachbarn wissen, aber Monika verbringt viel Zeit mit diesem unnützen Geschwätz. Sie ist neugierig wie alle Frauen, behauptet aber, sie habe nur ein menschliches Interesse an allem, was in ihrem Umfeld so passiert. Deshalb weiß sie auch, wer in unserem Viertel verstorben oder neu hinzugezogen ist, wer sich scheiden lässt und wer ein Kind erwartet. Alles Dinge, die sie nichts angehen und mich nicht interessieren.
Um die Mittagszeit herrscht im Büdchen der meiste Betrieb, wenn die Schulkinder ihre Naschereien kaufen, statt etwas Vernünftiges zu essen.
Monika findet die Kinder niedlich und hält es für normal, dass diese sich Süßkram kaufen, aber über mich und meine Zigaretten meckert sie.
Soll sie meckern. Es ist allein meine Sache, dass ich rauche. Ich rauche immer in meinem Sessel im Arbeitzimmer. Das ist der gemütlichste Platz im ganzen Haus.
Ich liebe den Duft nach Tabak und dazu mein Gläschen Weinbrand. Es muss einheimischer Weinbrand sein, ausländisches Zeug wie Cognac will ich nicht haben. Zu Weihnachten bekam ich mal eine Flasche Armagnac. Das sollte etwas Besonderes aus Frankreich sein – nicht für mich.
Anfangs verlangte Monika, dass ich draußen vor der Tür rauche. Ihre Blumen und Gardinen würden unter meinem Qualm leiden. Das fehlte noch, dass ich für Blumen und Gardinen auf meinen Genuss verzichte! Ich bot ihr stattdessen an, die Blumen und Gardinen aus meinem Arbeitszimmer zu entfernen. Ich brauche diesen Firlefanz nicht.
Draußen vor der Tür rauche ich schon gar nicht. Da käme ich mir wie ein Penner vor. Wozu habe ich meinen Raum, wenn ich ihn für die gemütlichsten Momente des Tages nicht nutzen soll?
Punkt 11:30 Uhr will ich mein Mittagessen. Wenn beim Gong der Wanduhr nicht serviert wird, sage ich: „Jetzt wäre der Zug abgefahren“, und gehe in den Gasthof. Dort schmeckt es mir zwar nicht, doch sie soll lernen, pünktlich zu sein.
Danach halte ich Mittagsruhe. Ruhe! In dieser Zeit wünsche ich keine Störung, kein Poltern im Haus und kein Gescharre im hinteren Garten.
Den Kaffee trinke ich in meinem Arbeitszimmer. Monika stellt immer etwas zu naschen dazu: ein Stück Kuchen, Kekse oder Schokolade. Sie sagt, das gehört dazu. Ich brauche das nicht. Mir reicht eine Zigarette.
Nach dem Vesper hole ich das Auto aus der Garage und fahre eine Stunde lang durch die Gegend. Auch, wenn es regnet. Nur bei Schnee bleibe ich drin. In meinem Alter muss man das Schicksal nicht provozieren.
Beim Autofahren kann ich wunderbar entspanen. Ich liebe es, kurvige Straßen über Land zu wählen und dabei Musik zu hören. Am liebsten fahre ich allein, doch manchmal setzt sich Monika einfach mit ins Auto und will einen Ausflug machen. Ich mag das nicht. Denn kaum sitzt sie auf dem Beifahrersitz, nörgelt sie: „Du könntest langsamer fahren.“
Ich mag auch nicht, wenn sie die Melodien mitsingt, weil sie immer die falschen Töne trifft und jedes Lied verdirbt. Sie singt trotzdem und ich regle den Ton lauter, damit ich sie nicht hören muss.
Der Unfall
Heute ist sie daheim geblieben, weshalb ich etwas schneller fahren kann, als wenn sie dabei wäre. Ich halte mich in der Regel an die Verkehrsvorschriften, doch für Monika fahre ich trotzdem zu schnell. Sie will in die Landschaft schauen, Tiere entdecken. Das ist so ein Frauending, die Augen überall zu haben. Ich schaue beim Autofahren nicht sinnlos umher, ich schaue auf die Straße.
Diese Strecke fahre ich besonders gern, denn sie führt recht kurvig zwischen sanften Hügeln und erweckt in mir ein regelrechtes Hochgefühl. Zudem brummt der Motor meines neuen Mercedes leise und gleichmäßig. Zufrieden lehne ich mich in den bequemen Sitz zurück. Er riecht noch frisch nach feinem Leder.
Im Radio singt Udo Jürgens, dass er noch niemals in New York war. Ich auch nicht. Ich müsste das einfach mal machen, wollte ich schon immer. Geld und Zeit habe ich genug. In Gedanken stimme ich mit ein: „Ich war noch niemals auf Hawaii. Ich war noch niemals wirklich frei.“
Wenn ich jetzt meinen Pass dabei hätte, könnte ich direkt zum Flughafen fahren und ab die Post. Vielleicht brauche ich den Pass gar nicht und es genügt der normale Personalausweis. Doch ich weiß, dass man für die USA diverse Genehmigungen benötigt.
Monika würde schön blöd schauen, wenn ich nicht zum Abendessen zurück bin und ihr eines Tages eine Karte entgegen flattert, aus Hawaii, wo die hübschen Hulamädchen leben. Das wäre mal ein Abenteuer.
Als ich mir ihr fassungsloses Gesicht vorstelle, kichere ich vor mich hin. Doch was soll ich auf Hawaii? Ich mag keine Inseln und auch kein Meer und schon gar keine Hitze. Die hübschen Hulamädchen würde ich mir schon gern anschauen, wenn sie so langsam ihre Hüften schwingen und sinnlich dabei lächeln.
Ausgerechnet jetzt will mich so ein Trottel in seiner Reiskiste überholen. Weiß der nicht, dass man hier nicht schneller als siebzig fahren darf? Mit mir macht der das nicht, nicht mit mir! Und schon gar nicht in dieser japanischen Karre. Ich drücke ein wenig das Gaspedal nach unten und schaue nach links. Der Typ ist jung und verzieht höhnisch das Gesicht. Soll er machen, doch vorbei kommt er nicht.
*****
Eine Hand tippt auf meinen Arm. Wer wagt es, mich in meiner Mittagsruhe zu stören?
„Ich bin´s, die Moni“, sagt sie leise. „Sie sind tot, alle beide.“
Was geht mich das an? Jeden Tag nervt sie mit ihren Geschichten über Verstorbene aus der Nachbarschaft. Die meisten kenne ich gar nicht. Jeder muss irgendwann sterben. Sie auch.
„Hörst du mich, Karli?“
Natürlich höre ich sie. Ich will sie aber nicht hören. Schon gar nicht, wenn sie mich Karli nennt. Sie weiß, dass ich das nicht leiden kann und sagt es trotzdem. Ich heiße Karl-Günther und will auch so gerufen werden. So viel Zeit muss sein. Manche Leute glauben, ich heiße Karl Günther, doch Günther ist nicht mein Nachname. Mein Nachname ist Fischer.
Sie soll mich mit ihren Geschichten über tote Nachbarn in Ruhe lassen. Ein für alle Mal! „Die Polizei ist draußen. Sie will dich verhören zu dem Unfall.“
Vernehmen. Polizeilich vernehmen heißt das. Wieso mich? Was für ein Unfall?
„Karli! Sie haben gesagt, ich soll denen sagen, wenn du wach bist.“
Wem soll sie das sagen? Sie weiß, dass ich in meiner Mittagsruhe nicht gestört werden will.
Jetzt tätschelt sie meine Hand, als wäre ich ein Hund. Am liebsten würde ich meine Hand zurückziehen. Doch dann merkt sie, dass ich nicht mehr schlafe.
„Am besten, du schläfst einfach weiter oder tust so, als ob du schläfst.“
Was glaubt sie, was ich jetzt mache? Sie ist wirklich dumm. Außerdem redet sie Unsinn. „Ich gehe jetzt.“
Endlich. Ich höre, wie sie keucht beim Aufstehen und wie der Stuhl auf dem Boden ratzt, als sie ihn zurückschiebt.
„Er schläft“, sagt sie.
Dann klappt die Tür zu.
Ich spüre einen dumpfen, warmen Schmerz im Bauch. Er ist nicht schlimm, nur ungewohnt.
Kurz irritiert er mich, dann döse ich weg.
*****
„Herr Fischer, hören Sie mich?“ Natürlich. Ich bin schließlich nicht taub.
„Öffnen Sie bitte Ihre Augen!“
Ich versuche es, doch es gelingt mir nicht. Mir ist übel. Ich überlege, was es heute zum Mittag zu essen gab. Kochen kann sie einfach nicht, obwohl man das von einer Frau erwarten sollte. Jetzt in ihrem Alter wird sie das nicht mehr lernen. Resigniert seufze ich.
Plötzlich merke ich, dass irgend etwas nicht stimmt. Mir fällt ein, dass mich eine Stimme Herr Fischer nannte, eine Stimme, die Sie zu mir sagt und die ich nicht kenne. Vermutlich träume ich. Dabei habe ich noch niemals in meinem ganzen Leben geträumt. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Für unsinnige Träume habe ich keine Zeit.
Ich spüre eine Hand auf meinem Arm, eine fleischige, fremde Hand. Erschrocken zucke ich zurück. Als die Hand mich fester packt, schlage ich sie weg. Im gleichen Moment verstärkt die Hand ihren Griff.
Verwirrt öffne ich meine Augen, kann aber nichts erkennen. Um mich herum ist dichter Nebel. Rauch! Hat sie etwas anbrennen lassen?
„Herr Fischer?“, fragt die Stimme, als wäre sie nicht sicher, ob ich ich bin.
Ich blinzle. Der Nebel wird dünner und ich sehe direkt über mir einen Bildschirm. Niemals zuvor hatte ich solch ein Gerät über meinem Bett. Das dulde ich nicht.
„Ihre Tochter ist hier. Ich komme später wieder.“ Wer sagt das? Ich sehe niemanden. Etwas unsicher schaue ich mich um.
„Papa! Ich bin´s, die Nadine.“ Entsetzt betrachte ich die junge Frau, die sich über mich beugt. Sie macht mir Angst. Ich weiß nicht, wer sie ist, aber ich weiß genau, dass ich sie nicht leiden kann.
„Mama kommt später wieder. Sie ist jetzt daheim.“
Natürlich ist sie daheim. Wo sollte sie sonst sein? Und ich? Bin ich nicht daheim?
Mich ergreift plötzlich Panik und ich schlage um mich. Sofort packen zwei Hände meine Arme und drücken sie nach unten. Es sind kühle Hände mit einem erbarmungslos festen Griff. Wütend spucke ich in die Richtung, wo diese Hände herkommen und erkenne eine dicke blonde Frau, die sich über mich beugt. Zugleich merke ich, dass meine Arme mit einem Gurt fixiert werden und spucke noch einmal. Doch ich treffe niemanden, die Frau ist aus meinem Blickfeld verschwunden.
„Ich bin Schwester Rita“, höre ich es leise flüstern und drehe meinen Kopf in die Richtung, aus der die Stimme kommt. Die Dicke trägt einen grünen Kittel, umarmt diese Nadine und streichelt über ihren Rücken. „Solch eine Reaktion kommt vor nach einer Operation. Machen Sie sich keine Sorgen! Ihr Vater ist hier gut aufgehoben.“
Nadine weint. Immer dieses Theater mit den Weibern! Sie heult wegen einer Operation.
Mich geht das jedenfalls nichts an. Oder doch?
„He!“, schreie ich. „Was ist hier los? Binden Sie
mich sofort frei! Sofort!“
„Ich bin Schwester Rita“, säuselt sie.
„Das sagten Sie bereits! Sie sollen mich losbinden!“
Operation. Schwester Rita. Krankenhaus. Ich bin im Krankenhaus! Aber warum? Hektisch durchforste ich mein Gedächtnis, ob ich wohl krank bin und das vergessen haben. Vielleicht ein Herzinfarkt?
„Papa!“
Ich will nicht, dass diese Frau mich Papa nennt.
Sie beugt sich wieder über mich und lächelt gequält. Dabei tupft sie mit einem Tuch über ihre Augen. Als sie ihre Hand auf meine Schulter legt; fauche ich: „Lassen Sie das!“
Sie soll verschwinden. Ich will sie nicht in meiner Nähe haben, schon gar nicht am Bett.
„Gehen Sie! Sofort!“
Unschlüssig bleibt sie stehen, als ob sie nicht gehört hat, was ich gesagt habe. Sie weint immer noch.
„Gehen Sie nur! Er wird sich beruhigen.“
„Reden Sie nicht über meinen Kopf hinweg!“, weise ich die dreiste Schwester zurecht. „Rufen Sie sofort den Arzt! Ich muss wissen, was hier los ist.“
*****
„Sie hatten einen Unfall“, sagt ein Mann.
Das kann nicht stimmen, denn das wüsste ich.
Doch zuerst müsste ich wissen, wer diesen Unsinn behauptet. Ich kenne den Mann nicht, der nicht einmal so viel Manieren hat, sich vorzustellen.
„Wer sind Sie überhaupt?“, frage ich.
„Doktor Fischer.“
Fischer? Fischer ist mein Name.
„Ihr behandelnder Arzt. Ich habe Sie operiert.“
„Wieso das denn?“, fauche ich ihn an.
„Sie hatten einen Unfall“, wiederholt er.
„Ich hatte keinen Unfall. Daran würde ich mich erinnern. Und jetzt binden Sie mich los!“
Ich versuche, mich aufzurichten. Doch ich kann kaum meinen Kopf anheben, als wäre dieser tonnenschwer und auf das Kissen fixiert. Fixieren ist strafbar, damit kenne ich mich aus.
„Zuerst versprechen Sie mir, dass Sie nicht wieder um sich schlagen!“.
„Ich verspreche Ihnen gar nichts!“
Das fehlte noch. Sind wir hier im Kindergarten?
Wie redet dieser Grünschnabel überhaupt mit mir?
„Schwester Rita musste verhindern, dass Sie sich selbst Schaden zufügen“, erklärt dieser Fischer.
Sofort spucke ich ihn an. In meiner misslichen Lage kann ich gar nichts anderes tun.
„Karli, du benimmst dich jetzt wie ein erwachsener Mann!“, höre ich die unangenehme Stimme meiner Frau.
Ich drehe meinen Kopf in die Richtung, in der ich Monika vermute und sehe sie tatsächlich direkt neben mir auf einem Stuhl sitzen. Hat diese Nadine-Frau nicht gesagt, sie sei daheim? Mir fällt ein, dass sie ergänzte, dass sie später wiederkommt. Hier geht es zu wie im Taubenschlag. Das gefällt mir nicht.
„Verschwinde!“, zische ich. „Du störst! Das ist ein Gespräch unter Männern.“
Monika verzieht ihr Gesicht, was wohl ein Lächeln sein soll. Doch es ist nur eine alberne Grimasse. Ich mag sie nicht ansehen und spucke in ihre Richtung, treffe sie aber nicht.
„Sie leiden seit der Operation unter einem Delir“, erklärt der Arzt.
Operation. Delir. Meint der Mann Delirium? Ein
Delirium ist eine Bewusstseinstrübung. Die müssen mir irgendwas gegeben haben.
„Einem was?“, fragt Monika ängstlich.
„Einem Delir. Ein Delir ist reversibel.“
„Oh Gott!“, stöhnt sie. „Was heißt das?“
Umkehrbar. So etwas weiß man. Doch es hat keinen Zweck, dieser dummen Frau etwas zu erklären.
„Patienten im Delir sind desorientiert und in der Wahrnehmung ihrer Umwelt beeinträchtigt“, erklärt der Arzt.
Er erklärt es ihr, als sei sie mein Vormund.
„Da ich der Patient bin, haben Sie mit mir zu sprechen und nicht mit meiner Frau“, weise ich ihn zurecht.
Doch er ignoriert meine Worte und spricht an Monika gewandt weiter.
„Dieser Zustand klingt ab.“
Sie seufzt erleichtert. Doch mich macht es wütend.
„Mit meinem Hirn ist alles in Ordnung“, schreie ich ihn an. „Nur mit Ihrem nicht! Sie machen sich strafbar, wenn Sie mich nicht sofort losbinden.“
Der Arzt dreht sich zur Seite, als ich ihn anspucke. Deshalb treffe ich nur seinen Kittel. Mein drohender Blick scheint ihn nicht aus der Ruhe zu bringen und macht mich noch wütender.
„Ein Delir ist eine akute Verwirrtheit, die manchmal nach einer schweren Operation auftritt. Wir geben Ihnen Medikamente, damit sich Ihr Zustand rasch normalisiert.“
„Sie nennen mich verwirrt? Verrückt? Bin ich etwa in einer Irrenanstalt? Hat sie mich hier reingebracht?“ Erbost schaue ich Monika an.
„Sie gehört hierher! Nicht ich!“ Ich versuche, meine Hände aus den Schlingen zu ziehen. Es gelingt mir nicht und deshalb schreie ich in meiner hilflosen Wut so laut ich kann um Hilfe.
Der Mann hält meinen Arm und sagt leise, aber eindringlich: „Hören Sie! Bei diesem Unfall sind Ihre Milz gerissen und zwei Rippen gebrochen. Wenn Sie sich zu heftig bewegen, haben Sie starke Schmerzen trotz der Schmerzmittel, die wir Ihnen verabreichen. Verstehen Sie das?“ Ich verstehe nichts. Ich begreife nicht, was hier gespielt wird.