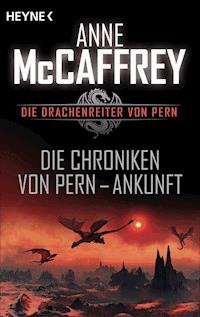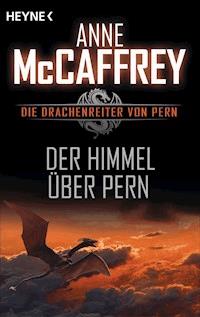
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Quo vadis, Drachenreiter?
Den Bewohnern von Pern gelingt es, mit Hilfe der Technik ihrer Vorfahren die Bahn des roten Unglückssterns zu verändern, der ihrer Welt immer wieder mit dem tödlichen Fädenfall bedroht. Für Pern könnte ein goldenes Zeitalter anbrechen, doch das würde gesellschaftliche Veränderungen voraussetzen. Aber starrköpfige Landbesitzer pochen auf alte verbriefte Rechte, und Fundamentalisten versuchen, jedwede Neuerung zu verhindern – und sei es mit Gewalt und Terror. Und schließlich stellt sich die Frage, welche Aufgabe nun den Drachenreitern zufallen soll, deren spezielle Funktion es seit Jahrhunderten war, Pern vor den verheerenden Fäden aus dem All zu schützen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 781
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ANNE McCAFFREY
DER HIMMEL ÜBER PERN
Die Drachenreiter von Pern
Band 16
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Den Bewohnern von Pern gelingt es, mit Hilfe der Technik ihrer Vorfahren die Bahn des roten Unglückssterns zu verändern, der ihre Welt immer wieder mit dem tödlichen Fädenfall bedroht. Für Pern könnte ein goldenes Zeitalter anbrechen, doch das würde gesellschaftliche Veränderungen voraussetzen. Aber starrköpfige Landbesitzer pochen auf alte verbriefte Rechte, und Fundamentalisten versuchen, jedwede Neuerung zu verhindern – und sei es mit Gewalt und Terror. Und schließlich stellt sich die Frage, welche Aufgabe nun den Drachenreitern zufallen soll, deren spezielle Funktion es seit Jahrhunderten war, Pern vor den verheerenden Fäden aus dem All zu schützen …
Die Autorin
Anne McCaffrey wurde am 1. April 1926 in Cambridge, Massachusetts, geboren, und schloss 1947 ihr Slawistik-Studium am Radcliffe College ab. Danach studierte sie Gesang und Opernregie. In den Fünfzigerjahren veröffentlichte sie ihre ersten Science-Fiction-Kurzgeschichten, ab 1956 widmete sie sich hauptberuflich dem Schreiben. 1967 erschien die erste Story über die Drachenreiter von Pern, »Weyr Search«, und gewann den Hugo Award im darauffolgenden Jahr. Für ihre zweite Drachenreiter-Story »Dragonrider« wurde sie 1969 mit dem Nebula Award ausgezeichnet. Anne McCaffrey war die erste Frau, die diese beiden Preise gewann, und kombinierte die beiden Geschichten später zu ihrem ersten Drachenreiter-Roman »Die Welt der Drachen«. 1970 wanderte sie nach Irland aus, wo sie Rennpferde züchtete. Bis zu ihrem Tod am 21. November 2011 im Alter von 85 Jahren setzte sie ihre große Drachenreiter-Saga fort, zuletzt zusammen mit ihrem Sohn Todd.
www.diezukunft.de
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der Originalausgabe
THE SKIES OF PERN
Aus dem Amerikanischen von Ingrid Herrmann-Nytko
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 2001 by Anne McCaffrey
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Karte: Andreas Hancock
Satz: Thomas Menne
ISBN 978-3-641-20887-5V002
Dieses Buch widme ich mit allem Respekt
Dr. phil. Steven M. Beard,
der mir eine ganze Welt geschenkt hat.
Danksagungen
Je länger ich an der Pern-Saga schreibe, umso ungewöhnlicher werden die Umstände, und umso mehr bin ich auf die Hilfe von Freunden und vor allen Dingen Experten auf gewissen Sachgebieten angewiesen.
Bei der Behandlung astronomischer Phänomene, wie sie in diesem Buch geschildert werden, unterstützten mich – wieder einmal – Dr. Steven M. Beard und Elizabeth Kerner. Außerdem ein Experte für Meteoriteneinschläge, Scott Manley vom Armagh-Observatorium, den ich persönlich aufsuchte, um mir Teleskope anzusehen und zu lernen, wie man den exakten Punkt des Aufpralls eines kosmischen Körpers auf einen Planeten berechnet. Obendrein hatte ich das Vergnügen, im Haus von Dr. Bill und Mrs. Nancy Napier zu Abend zu essen und einige ihrer Kollegen und Kolleginnen kennen zu lernen.
Marilyn und Harry Alm – und der in Ozeanographie bewanderte P. Burr Loomis – zeichneten mir wunderbare Landkarten und Schaubilder, damit ich mich auf Pern zurechtfinde.
Besonderen Dank schulde ich Georgeanne Kennedy, die dafür sorgte, dass ich in meiner Geschichte nicht zu sehr auf erzählerische Abwege geriet, bei mir eine ständige Gefahr, weil auf Pern halt so viele Menschen leben.
Mein Dank gilt auch Lea Day, Elizabeth Kerner und Elizabeth Ann Scarborough, die so freundlich waren, die Rohfassung des Buchs zu lesen und mir wertvolle Hinweise gaben.
Zu guter Letzt danke ich meinen Redakteurinnen, Shelly Shapiro und Diane Pearson, die mir halfen, das jüngste Abenteuer auf Pern zu entwerfen. Ihre Ideen haben meine Phantasie sehr beflügelt.
Des Weiteren danke ich http://science.nasa.gov/headlines/y2000 für die neuesten Informationen über das, was auf dieser Welt und darüber hinaus passiert.
Musik, die ich während des Schreibens hörte:
Jerry Goldsmith – The Ghost & The Darkness und andere Musik aus SF-Filmen
Percy Grainger – Piano for Four Hands (2 Bände)
Elgar – Enigma Variations
James Galway – verschiedene CDs
Mendelssohns Italienische Sinfonie
Inspector Morse CD
Janis Ian – verschiedene CDs
Manuel Barrueco plays Lennon & McCartney
Tania Opland und Mike Freeman – Masterharper und andere CDs
INHALT
Einführung
Prolog
Erster Teil – Ende des Planetenumlaufs
Zweiter Teil – Die Katastrophe
Dritter Teil – Nachwirkungen
Vierter Teil – Neue Dimensionen
Einführung
Anstatt über die Missstände in der Welt nachzugrübeln, sollten wir das Beste aus dem machen, was wir vorfinden.
Als die Menschheit Pern entdeckte, den dritten Planeten der Sonne Rubkat im Sagittarius-Sektor, schenkten sie der exzentrischen Umlaufbahn eines weiteren Himmelskörpers in diesem System wenig Beachtung.
Die Kolonisten besiedelten den Planeten, stellten sich auf die veränderten Lebensbedingungen ein und verbreiteten sich über den südlichen, leichter zu erschließenden Kontinent. Dann passierte eine Katastrophe in Form eines Regens aus mykorrhizoiden Organismen, die gierig alles verschlangen, womit sie in Kontakt kamen, bis auf Stein, Metall oder Wasser. Zu Anfang erlitten die Siedler verheerende Verluste. Doch zum Glück für die junge Kolonie waren die »Fäden«, wie man jene Tod bringenden Sporen nannte, nicht unbesiegbar. Sie konnten durch Feuer wie durch Wasser vernichtet werden.
Mittels Gentechnik veränderten die Siedler eine einheimische Lebensform, die den mythologischen Drachen aus der alten Welt ähnelte. Diese gigantischen Kreaturen, die bei ihrer Geburt mit einem Menschen eine telepathische Verbindung eingingen, entwickelten sich zu Perns wirksamster Waffe gegen die Fäden. Indem die Drachen ein phosphinhaltiges Gestein fraßen, konnten sie buchstäblich Feuer spucken und die Fäden in der Luft verbrennen, noch ehe sie den Boden erreichten. Da die Drachen nicht nur flugfähig waren, sondern außerdem die Teleportation beherrschten, vermochten sie durch unglaublich geschickte Manöver während eines Kampfes gegen die Fäden Kontakte mit den gefährlichen Organismen zu vermeiden. Und die telepathische Kommunikation untereinander sowie mit ihren Reitern ermöglichte ihnen die Aufstellung höchst effektiver Gefechtseinheiten oder Geschwader.
Von den Drachenreitern verlangte man besondere Talente und die völlige Hingabe an die Pflicht. Sie mauserten sich zu einer separaten Gruppe innerhalb der Perneser Gesellschaft, isoliert von den Bürgern, die trotz der Gefährdung durch die Fäden Ackerbau und Viehzucht betrieben oder in einer der Gildehallen ein Handwerk ausübten.
Im Lauf der Jahrhunderte vergaßen die Siedler, die sich darauf konzentrierten, die Fäden zu bekämpfen, welche immer dann abregneten, wenn der exzentrische Orbit des Roten Sterns sich Perns Umlaufbahn näherte, ihre Ursprünge und ihre Geschichte.
Es gab auch lange, gefahrlose Intervalle, in denen keine gefräßigen Sporen aus dem Weltall das Land heimsuchten. Während dieser friedvollen Zeiten hielten die Drachenreiter in den Weyrn ihren mächtigen Verbündeten die Treue, bis man sie wieder brauchte, um die Menschen zu beschützen, denen zu helfen sie sich verpflichtet fühlten.
Nach einem solch langen Intervall dezimierten sich die Drachenreiter auf einen einzigen Weyr: Benden. Dessen mutige Weyrherrin Lessa, Reiterin der letzten noch verbliebenen goldenen Königin, Ramoth, fand heraus, dass die Drachen sich nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit zu teleportieren vermochten. Lessa ging das tollkühne Wagnis ein, flog vierhundert Planetenumläufe zurück in die Vergangenheit und brachte die anderen fünf Weyr zurück in die Gegenwart, um die Verteidigung Perns zu sichern.
Die Umstände begünstigten eine Erforschung des Südkontinents, und dort entdeckte eine Gruppe von Leuten das wichtigste Artefakt der Ersten Siedler: das so genannte Akki, das Akustische System einer Künstlichen Intelligenz. Der bedeutsame Fund wurde in Landing gemacht, dem Landeplatz, an dem die Kolonisten zum ersten Mal den Fuß auf Perneser Boden setzten. Ihre Nachfahren, die so viele Planetenumläufe später das in Vergessenheit geratene Akki wiederentdeckten, waren Lord Jaxom, Reiter des weißen Drachen Ruth, sein Freund F'lessan, der den Bronzedrachen Golanth ritt, die Handwerksgesellin Jancis aus der Halle der Schmiedezunft und Piemur, seinerzeit Harfnergeselle.
Die Flut von Informationen, die das Akki in seinen Dateien gespeichert hatte, half den Handwerksständen, längst verloren gegangenes Wissen wieder für sich nutzbar zu machen. Obendrein wusste das Akki, wie sich die Perneser ein für alle Mal von der zyklisch auftretenden Bedrohung durch die Fäden befreien konnten.
F'lar und Lessa, Bendens tapfere und umsichtige Weyrführer, ermutigten die Burgherren und Gildemeister, sich nicht länger von den Gefahren, die der Rote Stern auf seiner erratischen Bahn mit sich brachte, beherrschen zu lassen und eine gänzlich neue Ära auf Pern einzuleiten. Nahezu alle Burgherren und Gildemeister erklärten sich einverstanden, nicht zuletzt, weil das Akki sie mit neuen Methoden und Technik versorgte, die das Gesundheitswesen und die gesamte Lebensqualität verbesserten.
Reaktionäre und Traditionalisten, die in dem Akki ein »Monstrum« sahen, versuchten, das kühne Projekt zu verhindern, allerdings ohne Erfolg. Unter der Anleitung des Akki beförderten junge Drachenreiter und Techniker die Antimaterie-Triebwerke der drei Kolonistenschiffe, die immer noch im Orbit über Landing schwebten, mittels Teleportation zum Roten Stern und platzieren sie dort in einer tiefen geologischen Verwerfung. Die darauf folgende Explosion konnte von Pern aus beobachtet werden, und die Menschen ergötzten sich an der Vorstellung, endlich die Fäden los zu sein.
Doch es regnet weiterhin Sporen aus dem Weltall, denn der Schwarm, den der Rote Stern mit sich schleppte, ist noch nicht gänzlich an Pern vorbeigezogen. Drachenreiter und Harfner erklären allen, die es wissen wollen, dass dieser Vorbeizug der Letzte sein wird, den Pern erdulden muss.
Nun heißt es, Pläne für die Zeit »Danach« zu schmieden, wenn es keine Fäden mehr gibt. Akkis Dateien quellen über vor nützlichen Informationen, die allen Einwohnern Perns das Leben erleichtern helfen. Und die Drachenreiter, die jahrhundertelang den Planeten verteidigten, müssen sich eine neue Beschäftigung suchen. Die Frage lautet: Welche Technik kann man übernehmen, ohne die Perneser Kultur zu zerstören? Und auf welche Weise können sich die Drachenreiter und ihre wunderbaren Freunde in die neue Gesellschaftsordnung einfügen?
Prolog
Die Minen von Crom –
5.27.30 – Gegenwärtige Annäherungsphase
Neue Zeitrechnung des Akki – 2552
Der Dienst habende Geselle im Gefangenenquartier der Mine 23 in den westlichen Vorbergen sah als Erster den grellen bläulichen Lichtstreifen am Himmel. Der Flammenschweif kam aus südwestlicher Richtung; und er schien geradewegs auf ihn zuzuhalten, deshalb schrie er eine Warnung, während er die Treppen des Wachturms hinunterstürmte.
Sein Gebrüll erregte die Aufmerksamkeit der anderen Bergleute, die soeben aus den Schächten nach oben fuhren, erschöpft und müde, weil sie den ganzen Tag lang nach Eisenerz geschürft hatten. Dann gewahrten auch sie die Lichterscheinung, die sich rasend schnell der Festung näherte. Schreiend stoben die Männer auseinander, die nächstbeste Deckung anpeilend, duckten sich unter Erzloren, kauerten hinter Schutthalden, Bretterstapel, manche rannten zurück in den Schacht.
Vom Himmel orgelte ein Dröhnen wie gewaltiger Donner – doch keine Wolke war in Sicht. Manche Männer behaupteten, ein hohes, schrilles Kreischen zu hören. Über die Richtung, aus der das Licht angesaust kam, herrschte Einigkeit: Südwest.
Plötzlich klaffte in der hohen Steinmauer, die den Gefängnishof umgab, eine Bresche. Lawinen aus Schutt und Gestein prasselten herunter. Bergleute warfen sich flach auf den Boden und hielten sich schützend die Arme über den Kopf. Ein zweites explosionsartiges Geräusch folgte dem ersten ohrenbetäubenden Krachen, durchsetzt von den Entsetzensschreien der in ihren Quartieren eingesperrten Gefangenen. Es stank nach überhitztem Metall, ein vertrauter Geruch an einem Ort, an dem Eisen in Blöcke geschmolzen wurde, ehe man es zu den Schmiedehallen transportierte. Doch dieser Ausdünstung haftete ein ungewöhnlich saurer, scharfer Mief an, den niemand so recht beschreiben konnte.
Seit dem Augenblick, als der Geselle seinen Warnruf ausstieß, behielt lediglich ein einziger Mann von den mehreren hundert Bergleuten, die die Minenfestung bewohnten, einen kühlen Kopf. Shankolin, der seit dreizehn Planetenumläufen in Crom inhaftiert war, hatte nur auf eine Gelegenheit wie diese gelauert – eine Chance zur Flucht. Er hörte, wie die Umfriedung einstürzte, sah in dem schmalen Fensterschlitz der massiven Tür, die den einzigen Eingang zum Kerker bildete, einen bläulich-weißen Blitz. Er tauchte nach links ab und verkroch sich unter einer Holzpritsche, als auch schon ein großes, heißes, stinkendes Geschoss die Wand an der Stelle durchschlug, an der sich kurz zuvor sein Schädel befunden hatte. Zischend pflügte sich das Ding den Mittelgang hinunter, fraß sich durch die hölzernen Planken, zertrümmerte eine Stützstrebe und brachte einen Teil des Dachs zum Einsturz. Jemand schrie vor Schmerzen und flehte um Hilfe. Alle anderen heulten vor Angst.
Shankolin kroch unter der Pritsche hervor, warf einen Blick auf das Loch, das der Meteorit – denn nur ein solches Objekt vermochte diese verheerende Wirkung zu entfalten – in die Wand gebohrt hatte, und reagierte geistesgegenwärtig. Durch die geborstene Wand konnte er über den Gefängnishof blicken und die eingestürzte Außenmauer sehen. Er hetzte aus seiner Zelle und spurtete zu der Lücke, sich vergewissernd, dass sich keiner der Wachleute auf dem Laufgang oder in einem der Türme befand. Vermutlich hatten sie allesamt ihre Posten verlassen, als der Meteor auf die Bergwerksfestung zuschoss.
Flink setzte er über den zertrümmerten Wall und rannte bergab in das nächste Dickicht aus Gestrüpp. Hinter den verfilzten Büschen kauernd, lauschte er mit angehaltenem Atem auf die chaotischen Geräusche, die aus der Festung herüberdrangen. Der Verletzte jammerte herzerweichend. Die Wachen würden ihn zuerst versorgen, ehe sie die Gefangenen durchzählten. Vermutlich inspizierten sie auch eingehend den Meteoriten, denn die Himmelsobjekte, die Metall enthielten, galten als äußerst wertvoll. Jedenfalls hatte er die Wachen darüber reden hören, nachdem seine Taubheit nachgelassen hatte. Er hörte immer noch schlecht, aber das Wichtigste bekam er mit, obwohl er sich mit voller Absicht taub stellte. Niemand brauchte zu wissen, dass er im Laufe der Zeit genesen war. Damals, vor dreizehn Planetenumläufen, hatte er einen Trupp Männer angeführt, die sein Vater, Meister Norist, ausgesucht hatte. Ihr Plan war es gewesen, dieses Monstrum, das Akki, zu zerstören und seinen bösen Einfluss auf die Menschen von Pern zu beenden. Doch dieses maschinelle Ungeheuer hatte sich gewehrt, indem es ein Schallbombardement losließ, das Shankolin für lange Zeit mit Taubheit schlug.
Als Shankolin glaubte, die Luft sei rein, ließ er sich den Hang hinunterrollen, bis er sich sicher genug wähnte, um in gebückter Haltung das kleine Wäldchen anzusteuern. Unentwegt den Kopf drehend, auf das leiseste Geräusch achtend, das etwaige Verfolger ankündigte, schlitterte er den zunehmend steiler werdenden Abhang hinab. Unter seinen Tritten lösten sich Kiesel und Steine, die vor ihm die Bergflanke hinunterpolterten.
Ein einziger Gedanke beherrschte ihn und trieb ihn an: Dieses Mal würde ihm die Flucht gelingen. Er musste frei sein, um den verderblichen Folgen, die durch die Einmischung des Akki entstanden waren, Einhalt zu gebieten. Dieses Monstrum war darauf aus, das Pern zu vernichten, das schon so lange bestand, hatte sein Vater ihm immer wieder mit angstvoller Stimme eingeflüstert.
Zu seinem Entsetzen hatte Meister Norist erfahren, dass die Weyrführer von Pern allen Ernstes glaubten, diese körperlose Stimme könnte ihnen einen Weg aufzeigen, wie man den Roten Stern von seiner Himmelsbahn ablenkte und so den Planeten von der zyklisch wiederkehrenden Fädenplage befreite. Die Fäden fraßen und verschlangen alles – Herdentiere, Menschen, Pflanzen. In kürzester Zeit vertilgten sie sogar einen riesigen Baum. Er, Shankolin, wusste das. Er hatte es mit eigenen Augen gesehen, als er in einem Bodentrupp arbeitete, den die Halle der Glasmacher zur Bekämpfung der Fäden rekrutierte.
Gewiss, die Fäden stellten eine Bedrohung für jedermann dar, doch das Akki gefährdete die Menschen auf eine weitaus heimtückischere Weise, indem es ihnen abartige Ideen in die Köpfe und Herzen pflanzte. Sein Vater konnte es nicht fassen, welch unsäglichen Dinge diese seelenlose Stimme den Burgherren und Zunftmeistern in Aussicht stellte. Die Maschinen und Gerätschaften, von denen es mit seiner mechanischen Stimme immerzu faselte, konnte es unmöglich geben, dennoch behauptete das Akki, ihre Ahnen hätten sie tatsächlich benutzt. Angeblich würden sie das Leben aller Perneser vereinfachen und bereichern – sogar die Kunst des Glasherstellens ließe sich durch bestimmte Verfahren verbessern. Alles Tinnef!, hatte sein Vater kopfschüttelnd entgegengehalten.
Damals, als jeder die Wunder, über die das Akki predigte, in höchsten Tönen pries, hatten sein Vater und ein paar weitere bedeutende Männer erkannt, welche Risiken diese Versprechungen und Verlockungen bargen. Als ob eine Stimme einen Stern so einfach bewegen könnte! Shankolin teilte voll und ganz die Skepsis seines Vaters. Sterne ließen sich nicht von ihrer vorgezeichneten Bahn abbringen. Auch er fand, die Weyrführer seien mit Dummheit geschlagen, wenn sie darauf abzielten, die Ursache zu vernichten, die ihnen und ihren Drachen überhaupt eine Daseinsberechtigung gab. Nur den Fäden verdankten sie ihren Status als Beschützer von Pern. Und er redete seinem Vater nach dem Mund, weil er sich dem Ende seiner Gesellenzeit näherte. Ihm lag daran, sich bei seinem Vater einzuschmeicheln, von ihm in die Geheimnisse der Glasmacherkunst eingeweiht zu werden. Nur ihm als einzigem seiner Söhne sollte Meister Norist verraten, wie man das herrlich bunte Glas fabrizierte, welchen Sand man der Schmelzmasse beifügen musste, um ein strahlendes Blau zu erhalten, und welche Pulver das überwältigend intensive Karmesinrot erzeugten.
Deshalb hatte er sich dem Trupp von Saboteuren angeschlossen, die das Akki zerschlagen und seinem unheilvollen Einfluss ein Ende setzen wollten. Man konnte es nicht länger zulassen, dass ansonsten intelligente und vernünftige Bürger sich von einer sprechenden Maschine gefährlich Flausen in den Kopf setzen ließen.
Ehe er es sich versah, befand er sich auch schon in einem Bach. Mit dem rechten Fuß trat er auf einen glitschigen Stein. Er stürzte hin und schlug mit dem Kopf gegen einen Felsbrocken. Durch den heftigen Schlag benommen, rappelte er sich langsam auf Hände und Knie hoch. Das kalte Wasser belebte ihn. Dann merkte er, dass seine Wunde blutete. Als er sie vorsichtig betastete, zuckte er vor Schmerzen zusammen. Er stellte fest, dass sich die Verletzung von der Stirn bis über die Wange zog.
Blut tropfte von seinem Kinn. Den Atem anhaltend, hielt er den Kopf ein Weilchen unter Wasser. Diesen Vorgang wiederholte er so lange, bis die Kälte den Blutfluss einigermaßen stoppte. Trotzdem musste er einen Streifen Stoff von seinem Hemd abreißen und sich einen behelfsmäßigen Verband um die Stirn wickeln, damit ihm das Blut nicht in die Augen rann. Einmal legte er den Kopf schräg und horchte, ob er verfolgt wurde. Doch kein Laut war zu vernehmen, nicht einmal die Geräusche von fliegenden Tieren oder das Rascheln von Schlangen. Vielleicht hatte er sie durch sein Gerenne verscheucht. In seinen klatschnassen Kleidungsstücken stand er auf und hob die Nase witternd in die Brise.
Während der vielen Planetenumdrehungen, als er stocktaub war, hatten sich seine anderen Sinne geschärft. Einmal hatte seine feine Nase ihm das Leben gerettet, wenn er auch bei diesem Ereignis die Spitze eines Fingers verlor. Er nahm den penetranten Gestank von Gas wahr, das freigesetzt wurde, ehe der Bergwerksstollen einstürzte. Zwei seiner Kollegen waren bei dem Unglück verschüttet worden.
Der Schnitt in der Wange fing wieder an zu bluten. Er riss noch einen Fetzen von seinem Hemd ab und drückte den Stoff gegen die Verletzung. Den Kopf hin und her drehend überlegte er, welche Richtung er einschlagen sollte.
In der Bergwerksfestung gab es Fährtensucher, die sich rühmten, jeden geflüchteten Gefangenen aufzuspüren. Blut, das auf den Boden oder Laubwerk tropfte, würde ihnen die Aufgabe erleichtern. Er konnte von Glück sagen, dass er sich die Wunde im Wasser zugezogen hatte.
Möglicherweise verzögerte der Meteoriteneinschlag, dass man nach ihm fahndete. Es musste Verletzte gegeben haben, und in dem allgemeinen Chaos würde es eine Weile dauern, bis man die Gefangenen gezählt hatte. Auch schloss er nicht aus, dass die Aufseher dem Meteoriten mehr Beachtung schenkten als den Inhaftierten. Die Halle der Schmiedezunft zahlte gut für solche Brocken, die vom Himmel fielen. Sollten sie ruhig ihre Zeit damit vergeuden, die nächst gelegene Schmiedehalle zu benachrichtigen. Hauptsache, er erreichte den Fluss.
Wenn er im Bachbett weitermarschierte, hinterließ er keine verräterische Blutspur. Einmal würde dieses Bächlein den großen Strom erreichen, der im Südmeer mündete. Den Stofffetzen musste er gegen die Wange pressen, weil Blut aus der Platzwunde quoll. Von dem Sturz fühlte er sich immer noch ein bisschen benebelt. Er hielt Ausschau nach einem Stock, auf den er sich stützen und mit dem er die Wassertiefe testen konnte. Ein Stück weiter am Ufer erspähte er einen geeigneten Knüppel. Vorsichtig durch das Bachbett watend, holte er sich den Stecken. Probehalber stieß er ihn ein paarmal in den Boden, um sicher zu gehen, dass er nicht morsch war. Der Knüttel war für seine Zwecke ideal.
Zielstrebig wanderte er durch die mondlose Nacht. Trotz des Stocks glitt er gelegentlich im Schlamm aus oder sackte in ein unerwartet tiefes Loch. Als die Verletzung an der Wange endlich aufhörte zu bluten, stopfte er den Stofffetzen in eine Jackentasche. Der Stirnverband klebte durch das sich verkrustende Blut an der Haut, deshalb ließ er ihn, wo er war.
Als der Morgen dämmerte, hatte er in den eiskalten Füßen, die in den schweren, mit Wasser voll gesogenen Arbeitsstiefeln steckten, kein Gefühl mehr. Er stolperte immer öfter, und seine Zähne begannen zu klappern. Der Bach verbreiterte sich zunehmend, und mitunter steckte er bis zur Taille im Wasser. Ihm wurde klar, dass er auf festem Boden weitergehen musste. An den überhängenden Ästen der Büsche, die das Ufer säumten, zog er sich die steile Böschung hoch und verbarg sich in dem dichten Gestrüpp. Um das bisschen Wärme, das sein Körper noch erzeugte, zu halten, nahm er eine gekrümmte Stellung ein.
Vor Erschöpfung döste er ein, bis der Hunger ihn schließlich weckte. Es war bereits Vormittag, und die Sonne stand hoch über dem Horizont. Auf seiner Flucht war er viel weiter gekommen, als er es für möglich gehalten hätte. Seine derbe Arbeitskleidung war halb trocken, aber das in den Stoff eingewebte Emblem der Bergwerksfestung Crom kennzeichnete ihn überall als entflohenen Sträfling. Er brauchte etwas zu essen und neue Kleidung, egal, in welcher Reihenfolge.
Behutsam tauchte er aus dem filzigen Dickicht auf und gewahrte zu seiner Überraschung ein kleines Gehöft am jenseitigen Ufer des Wasserlaufs. Er beobachtete das Anwesen eine Zeit lang, ehe er den Schluss zog, dass sich weder drinnen noch in unmittelbarer Nähe jemand aufhielt. Nachdem er den Bach überquert hatte, wobei seine wunden Füße jedes Mal, wenn sie auf einen Stein trafen, höllisch schmerzten, verharrte er noch ein Weilchen im dichten Gehölz, bis er absolut sicher war, nicht auf einen Bewohner des Hauses zu treffen.
Er pirschte sich an den Hof heran. Anscheinend lebte hier ein Viehzüchter, denn auf der primitiven Schlafstatt lagen Felle und Häute, weich und geschmeidig vom langem Gebrauch. Doch zuerst brauchte er Nahrung. Er gab sich nicht die Mühe, die Knollen zu waschen, die er in einem Korb neben der Herdstelle fand. Dann sah er die eiserne Pfanne mit dem erkalteten, grauen Fett darin. Kurzerhand tunkte er das rohe Knollengemüse hinein und aß gierig den salzig schmeckenden Schmer. Nachdem sein ärgster Hunger gestillt war, suchte er nach anderen Nahrungsmitteln und Sachen zum Anziehen. Früher wäre es ihm im Traum nicht eingefallen, auch nur einen Apfel oder ein paar Beeren zu stibitzen. Doch seine Lebenssituation hatte sich drastisch geändert, und mithin der Moralkodex, den sein Vater ihm eingebläut hatte. Jetzt galt es, eine Mission zu erfüllen, einen Missstand zu beheben, einer Idee zum Sieg zu verhelfen oder sie auf immer zu begraben.
Sein Magen rebellierte gegen das fette, kalte Essen, das er gierig in sich hineingeschlungen hatte. Hoffentlich musste er sich nicht übergeben. Der Gestank von Erbrochenem hing noch lange in der Luft.
In einem fest verschlossenen Behälter, der dazu diente, Ungeziefer fern zu halten, entdeckte er drei Viertel eines Käserads. Er dachte daran, wie lange er damit würde überleben können, doch je weniger Spuren er auf seiner Flucht hinterließ, umso besser. Der Bewohner dieses Gehöfts mochte das Fehlen von einigen Knollen und das verschmierte Fett in der Pfanne nicht bemerken, aber wenn so viel Käse verschwand, musste er Lunte riechen. Mit einem Messer, das er in einer Schublade fand, schnitt er sich ein Stück Käse ab, das für eine karge Mahlzeit reichte. Als würde seine Zurückhaltung auf der Stelle belohnt, förderte er aus einer Blechbüchse ein halbes Dutzend kleiner Brote zutage, die als Reiseproviant dienten, und er nahm sich zwei. Wenn er bescheiden blieb, würden ihm noch mehr nützliche Dinge in die Hände fallen, davon war er überzeugt. Er glaubte fest an diese Form von Gerechtigkeit.
Er entfernte den Verband von seiner Stirn, eine qualvolle Prozedur, selbst als er sein Gesicht ins kalte Wasser tauchte. Ein paar Blutstropfen traten aus, doch er legte die Bandage nicht wieder an, weil er fand, die saubere Gebirgsluft müsse den Heilungsprozess fördern.
Er ging noch einmal ins Haus zurück, um nach Bekleidung zu forschen, fand aber keine. Stattdessen nahm er sich eine alte, abgewetzte Lederdecke mit. Vermutlich würde er noch öfter im Freien übernachten müssen, und obwohl man den fünften Monat schrieb, wurde es nach Sonnenuntergang empfindlich kalt.
Das Gehöft hinter sich lassend, prüfte er die Wege, die in verschiedene Richtungen abzweigten. Ein aufblitzender Sonnenstrahl, der sich an einer Metallfläche brach, erregte seine Aufmerksamkeit. Erschrocken wirbelte er herum und befürchtete schon, man hätte ihn eingeholt. Schließlich entdeckte er die Ursache für die Reflexion – das Licht spiegelte sich auf den Riemendollen eines kleinen Boots. Unter dem buschigen Dickicht, das die Ufer überzog, war der Nachen fast nicht zu sehen. Der Strick, mit dem sein Besitzer ihn an einem Ast vertäut hatte, war durch das ständige Reiben an einem Felsblock so zerfasert, dass ein leichter Ruck genügte, um ihn zu zerreißen.
Er zog an dem Seil, das auch wie vorhergesehen nachgab, setzte sich vorsichtig in das Boot und stakte es mit Hilfe seines Stocks in die Mitte des Wasserlaufs, wo eine Strömung herrschte. Vielleicht wäre es klüger gewesen, nach den Rudern zu suchen, doch er wollte fort von dem Gehöft und sich den Fluss so weit wie möglich hinuntertreiben lassen. Der Kahn war immerhin so groß, dass er sich mit angewinkelten Knien flach auf den Boden legen konnte, sodass man ihn vom Ufer aus nicht zu sehen vermochte.
Als er in der Nacht die Leuchtkörbe einer kleineren Festung gewahrte – um sich einen Wachwher zu halten, war sie nicht groß genug –, stakte er das Boot ans Ufer und machte es dort mit dem zerfaserten alten Strick fest, den er mit Stofffetzen von seinem Hemd ausgebessert hatte.
Das Glück blieb ihm hold. Zuerst fand er einen Korb voller Eier, der an einem Haken neben der Stalltür hing. Drei davon trank er aus, drei weitere steckte er sich vorsichtig unter das Hemd. Dann fiel sein Blick auf die Hemden und Hosen, die zum Trocknen über Sträucher am Flussufer ausgebreitet waren. In der Nähe ragten flache Steine aus dem Wasser, vermutlich wuschen die Frauen dort die Wäsche. Er suchte sich halbwegs passende Kleidung aus und ordnete die übrigen Sachen so an, dass es aussah, als seien die fehlenden Stücke in den Fluss gefallen und von der Strömung weggeschwemmt worden.
Er ging noch einmal in den Stall zurück, um sich genauer umzusehen, obwohl die Hühner in Gegenwart eines Fremden unruhig hin und her liefen. Nach einigem Stöbern entdeckte er Kleie und eine alte, verbeulte Schöpfkelle. Am nächsten Tag wollte er die Kleie mit den Eiern kochen und sich eine schöne heiße Mahlzeit zubereiten. Plötzlich hörte er Stimmen und lief schleunigst zu seinem Boot zurück. Sachte bugsierte er es in die Strömung und legte sich flach auf den Boden, um nicht entdeckt zu werden.
Die Stimmen gingen unter in den Geräuschen der Nacht, und dann vernahm er nur noch das Glucksen des Flusses, in dem sein Kahn lautlos dahintrieb. Über ihm funkelten die Sterne. Der alte Harfner, der die Kinder in der Halle der Glasmacher unterrichtete, hatte ihm die Namen einiger Sterne aufgezählt. Er hatte sogar von Meteoriten und Geistern gesprochen, die gegen Ende eines jeden Planetenumlaufs in hellen, weit gespannten Bögen über den Himmel zogen. Shankolin hatte nicht geglaubt, dass diese blitzenden Funken die Geister von toten Drachen seien, doch einige der jüngeren Kinder waren fest davon überzeugt.
Die hellsten Sterne veränderten nie ihren Standort. Er erkannte das strahlende Licht von Wega – oder war es Canopus? An die Namen der anderen Sterne am Frühlingshimmel konnte er sich nicht erinnern. Indem er sein Gedächtnis durchforstete, fiel ihm unweigerlich das Akki ein und das Unrecht, das dieses ... dieses Ding ihm zugefügt hatte. Erst kürzlich war ihm zu Ohren gekommen, dass man seinen Vater zusammen mit den Burgherren und Handwerkern, die versucht hatten, das Monstrum zu zerstören, auf eine Insel im Ostmeer verbannt hatte.
Nun, da das Akki keinen Mucks mehr von sich gab, musste es möglich sein, die irregeleiteten Männer und Frauen wieder zur Vernunft zu bringen. Der Rote Stern überzog Pern mit Fädenschauern. Die Drachenreiter bekämpften die Fäden, und in den lange währenden gefahrlosen Intervallen lebte man friedlich auf dem Planeten. Jahrhundertelang war das Leben in diesen geordneten Bahnen verlaufen, und diese Ordnung galt es zu bewahren.
Als Shankolin hörte, dass man den Meisterharfner von Pern, eine Persönlichkeit, die er respektierte und bewunderte, entführt hatte, war er zutiefst verstört gewesen. Doch dann hatte das Akki ihn durch ein Schallbombardement taub gemacht, und erst viele Planetenumläufe später erfuhr er, welche Umstände zu diesem Ereignis geführt hatten. Er wusste, dass man den Meisterharfner in dem Raum, in dem das Akki stand, tot aufgefunden hatte, doch wie genau Meister Robinton zu Tode gekommen war, entzog sich seiner Kenntnis. Und auch das Akki hatte seinen Geist aufgegeben – wie einer der Minenarbeiter es ausdrückte. War Meister Robinton zum Schluss doch noch zu der Erkenntnis gelangt, welchen Schaden die Maschine Pern zufügte, und hatte sie einfach abgeschaltet? Oder war es genau umgekehrt verlaufen, und das Monstrum hatte Meister Robinton getötet? Er brannte darauf, die Wahrheit herauszufinden.
Sowie er den Fluss weit genug hinuntergefahren war, um sich sicher zu wähnen – Burg Keogh konnte ihm vielleicht ausreichend Schutz bieten –, würde er alles daransetzen um zu erfahren, inwieweit das Akki bereits die Lebensweise und die Traditionen von Pern beeinflusst hatte.
Im Frühling begannen die Versammlungen, wenn die Straßen schneefrei waren und der Schlamm trocknete. Inmitten der Menschenmassen konnte er untertauchen und nach Antworten auf seine drängenden Fragen suchen. Seine Hörfähigkeit besserte sich von Tag zu Tag, selbst das schrille Gezwitscher der Vögel reizte nun sein Trommelfell. Und hatte er erst genügend Informationen gesammelt, ließ sich sein weiteres Vorgehen planen.
Nicht jeder auf Pern legte Wert darauf, mit alten Traditionen zu brechen, und nicht alle Menschen glaubten blindlings an die Lügen, die das Akki verbreitete. Er rief sich die Namen der Leute ins Gedächtnis, die damals schon nichts von den so genannten Verbesserungen hielten, die das mechanische Monstrum ihnen vorgaukelte. Und nun, elf Planetenumdrehungen nach dem Tod des Akki, mussten die vernünftig denkenden Bewohner dieser Welt begriffen haben, dass der Rote Stern nicht einfach seine Bahn geändert hatte, weil man drei alte Schiffstriebwerke in einem Spalt auf seiner Oberfläche explodieren ließ. Denn es regnete immer noch Fäden, was auch richtig war, denn diese Welt wurde durch die ständig wiederkehrende Bedrohung aus dem All geeint und zusammengehalten.
Während einer Versammlung – 6.15.30
»Ich verstehe nicht, warum es die Zeit durcheinander gebracht hat. Es ist eine Schweinerei«, nörgelte der erste Mann, derweil er mit dem Finger die verschüttete Sauce auf dem Tisch verschmierte.
»Und du richtest eine Schweinerei auf dem Tisch an«, schimpfte der zweite Mann und deutete auf den Fleck.
»Es hatte kein Recht, die Zeit zu verändern«, empörte sich der erste Mann.
»Wovon sprichst du eigentlich?«, erkundigte sich Nummer Zwei verwirrt. »Was meinst du mit ›es‹?«
»Das Akki natürlich, was denn sonst?«
»Und was genau soll es getan haben?«
»Na ja, es hat an unserer Zeitrechnung herumgepfuscht. Damals, als es behauptete, wir schrieben schon das Datum 2538 – wo es nach unseren Berechnungen erst 2524 hätte sein sollen.« Der Mann furchte die Stirn, und die buschigen schwarzen Augenbrauen trafen über dem fleischigen Zinken zusammen. »Auf einen Schlag waren wir vierzehn Planetenumdrehungen weiter in der Zeit.«
»Das Akki hat die Zeitrechnung korrigiert«, hielt Nummer Zwei seinem Kumpan entgegen, über dessen Vehemenz er nur staunten konnte. Zu Anfang hatte der Mann einen recht freundlichen Eindruck gemacht. Er kannte sich in Musik aus und wusste den Text eines jeden Liedes, das die Harfner vortrugen, auswendig. Aber nach dem dritten Weinschlauch verließ ihn seine gute Stimmung und wohl auch sein gesunder Menschenverstand, wenn er sich darüber aufregte, nach welchen Maßstäben man die Zeit berechnete.
»Das macht mich älter als ich bin.«
»Aber nicht klüger«, versetzte Nummer Zwei mit einem rüden Schnauben. »Im Übrigen sagte der Meisterharfner selbst, das Akki habe Recht, und die Zeit müsse reguliert werden, weil Dis ... äh ... Disk ...« Er legte eine Pause ein und nahm einen Rülpser als Vorwand, seine Rede zu unterbrechen, während er nach einer verständlichen Formulierung suchte. »Also, unsere Zeitrechnung war nicht präzise, weil die Fäden einmal nur vierzig Planetenumläufe lang gefallen waren, anstatt fünfzig wie sonst, und man die Disk ...«
»Diskrepanzen«, half ein dritter Mann aus, der die beiden Gesprächspartner von oben herab betrachtete.
Nummer Zwei schnippte mit den Fingern und strahlte den dritten Mann dankbar an, weil er auf das richtige Wort gekommen war. »Das ist es! Wir hatten die Diskrepanzen in unserem Kalender nicht berücksichtigt!«
»Es geht nicht nur darum, was das Akki getan hat«, quengelte der erste Mann weiter, »sondern was es auch jetzt noch anrichtet. Es schadet uns allen.« Mit einer weit ausholenden Geste schloss er die Besucher der Versammlung ein, die ungeachtet der drohenden Gefahren ausgelassen sangen und lachten.
»Auch jetzt noch?« Eine Frau, die in der Nähe herumlungerte, setzte sich Nummer Eins und Nummer Zwei gegenüber an den langen Tisch.
»Ja. Es zwingt uns irgendwelche Dinge auf, gleichgültig, ob wir diesen ›Fortschritt‹ haben wollen oder nicht«, führte Nummer Eins bedächtig aus, während er die Frau in dem spärlichen Lichtschein, der den Tisch gerade noch erreichte, prüfend musterte. Sie war eine ausgemergelte Erscheinung mit unschönen Gesichtszügen, schmalen, verkniffenen Lippen, einem fliehenden Kinn und großen, stechenden Augen. In ihrem Blick brannte ein Ausdruck, als hätschelte sie einen lange währenden, nur mit Mühe gezügelten Groll.
»Wie das künstliche Licht zum Beispiel?«, fragte Nummer Zwei und zeigte auf eine der Lampen. »Das ist doch wirklich von Vorteil. Viel praktischer als das Herumhantieren mit Leuchtkörben.«
»Leuchtkörbe entsprechen unserer Tradition«, erklärte die Frau. Ihr harsches Organ drang bis in die verschatteten Winkel hinter den Tischen vor. »Das Leuchtmyzel wächst auf Pern, damit wir es hegen und kultivieren.«
»Leuchtmyzel ist ein natürliches Produkt und hat unsere Burgen und Höfe seit jeher erhellt«, dröhnte eine tiefe, missbilligend klingende Stimme aus dem Dunkel. Die Frau schnappte überrascht nach Luft und fasste sich vor Schreck an die Kehle.
Nummer Eins und Nummer Zwei, die gedacht hatten, sie würden ein privates Gespräch führen, reagierten anfangs verärgert auf die Einmischung, bis sich der hoch gewachsene Mann aus den Schatten löste. Während er sich gemessenen Schrittes dem Tisch näherte, beobachteten ihn die anderen und staunten über seine Körpergröße. Unaufgefordert setzte er sich neben Nummer Drei, die Anzahl der Gruppe auf fünf Mitglieder erhöhend. Auf dem Kopf trug er eine seltsam geformte lederne Kappe, die tief in die Stirn gezogen war, jedoch die Narbe, die sich längs des Nasenflügels bis auf die Wange erstreckte, nicht zu kaschieren vermochte. Am Zeigefinger der linken Hand fehlte das oberste Glied. Etwas an seiner verwegenen Erscheinung und seinem herrischen Auftreten ließ die anderen verstummen.
»In letzter Zeit hat Pern viel verloren und wenig gewonnen.« Seine unversehrte Hand deutete auf die Lichtpunkte. »Und das nur, weil eine Stimme ...« – er legte eine verächtliche Pause ein – »... uns Vorschriften erteilte.«
»Befreit euch von dem Roten Stern«, murmelte Nummer Zwei und rutschte nervös auf der Sitzbank hin und her.
Nummer Fünf wandte sich Nummer Zwei zu und fasste ihn spöttisch ins Auge. »Die Fäden fallen immer noch«, orgelte er in seinem eigentümlichen Bass, der fast keine Modulation aufwies.
»Ja, sicher, aber der Grund dafür wurde uns doch erklärt«, begehrte Nummer Zwei auf.
»Vielleicht zu deiner Zufriedenheit, zu meiner jedenfalls nicht.«
Zwei Männer, die an einem Nebentisch saßen, blickten interessiert zu der Gruppe herüber und gaben durch Zeichen zu verstehen, dass sie gern zu ihnen aufrücken wollten. Nummer Eins nickte zustimmend, und Nummer Sechs und Sieben zwängten sich auf die freien Plätze zwischen den anderen.
»Die Stimme gibt es nicht mehr«, erklärte Nummer Eins, nachdem die Neuankömmlinge es sich bequem gemacht hatten und er wieder die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Zuhörer genoss. »Das Monstrum hat sich abgeschaltet.«
»Man hätte es schon viel früher abschalten sollen, ehe es seine Irrlehren verbreitete und die Menschen verdarb«, fuhr Nummer Fünf fort.
»Und es hat eine Menge Zeug hinterlassen, das zu nichts Gutem führt, wenn man es anwendet«, ergänzte die Frau in verschwörerischem Ton.
»Spielst du auf die Gerätschaften und Methoden an, die uns das Leben erleichtern sollen, wie elektrischer Strom zum Beispiel?« Nummer Zwei konnte es sich nicht verkneifen, diese ernsthaften und humorlosen Leute zu necken.
»Eigentlich merkwürdig, dass das Akki sich selbst abschaltete, als es anfing, ausnahmsweise einmal etwas Nützliches zu bewirken«, sinnierte Nummer Eins.
»Aber seine Pläne sind noch vorhanden!«, meinte Nummer Vier gewichtig.
»Viel zu viele Pläne«, pflichtete Nummer Fünf ihm mit seiner dunklen Stimme bei.
»Welche denn?«, wollte Nummer Drei wissen. Nummer Viers Augen weiteten sich vor Anspannung und Furcht.
»Na, Chirurgie zum einen!« Das tiefe Organ senkte sich zu einem Flüstern, als sei von etwas höchst Unmoralischem die Rede.
»Chirurgie?« Nummer Sechs zog die Stirn kraus. »Was ist das?«
»Wenn man einen Körper aufschneidet und darin herummurkst«, erklärte Nummer Eins, gleichfalls die Stimme dämpfend.
Nummer Sechs erschauerte. »Manchmal müssen wir ein Fohlen aus dem Bauch der Mutter holen, indem wir die Stute aufschlitzen. Weil es anders nicht auf die Welt käme.« Als die anderen ihn daraufhin misstrauisch beäugten, fügte er hastig hinzu: »Das tun wir natürlich nur bei reinrassigen Fohlen, wenn wir es uns nicht leisten können, es zu verlieren. Und einmal habe ich zugesehen, wie der Heiler einen Blinddarm entfernte. Andernfalls wäre die Frau gestorben, behauptete er. Sie hat den Eingriff nicht mal gespürt.«
»Sie hat den Eingriff nicht mal gespürt«, wiederholte Nummer Fünf, auf den Satz eine unheilvolle Betonung legend.
»Der Heiler hätte mit ihr alles Mögliche anstellen können, und sie hätte nichts gemerkt«, zischelte Nummer Vier entrüstet.
Mit einem Grunzen tat Nummer Zwei diesen Einwand ab. »Er hat ihr nicht geschadet. Sie lebt immer noch und ist eine fleißige Arbeiterin.«
»Ich denke nur so«, resümierte Nummer Eins. »In den Handwerkshallen – nicht nur bei den Heilern – wird viel ausprobiert. Ein Fehler kann einen Menschen das Leben kosten. An mir sollen sie nicht herumexperimentieren, weder äußerlich noch innerlich.«
»Die Entscheidung liegt bei dir«, meinte Nummer Zwei.
»Nicht immer«, unkte Nummer Vier. Die magere Frau beugte sich über den Tisch und klopfte mit den Fingern auf die Platte, um die Bedeutung des Gesagten zu unterstreichen.
Auch Nummer Drei lehnte sich weit nach vorn. »Welche Wahl lässt man uns denn? Haben wir wirklich darüber zu bestimmen, welche von Akkis Vorschlägen wir übernehmen und welche wir ablehnen? In seinen so genannten Dateien befinden sich angeblich massenhaft Anleitungen für alles und jedes im Leben. Doch woher sollen wir wissen, was für uns gut ist und was nicht? Diese neumodischen Techniken sind uns doch völlig fremd. Und die eigentlichen Entscheidungen werden von anderen Leuten getroffen, über unsere Köpfe hinweg. Wir haben nichts zu sagen. Und das passt mir nicht.« Er nickte heftig mit dem Kopf, um seiner Meinung Nachdruck zu verleihen.
»Und keiner kann mit Bestimmtheit vorhersagen, dass die Dinge, die uns das Akki verspricht, auch wirklich zu unserer Zufriedenheit funktionieren«, warf Nummer Sieben giftig ein. »Man kann uns viel erzählen, aber wenn irgendetwas schief geht, sind wir die Dummen.«
Nummer Drei ergriff jetzt das Wort. »Nicht alle Burgherren und Gildemeister sind von diesem neuen Firlefanz angetan. Ich selbst habe gehört, wie Meisterin Menolly sagte ...« Selbst Nummer Fünf betrachtete ihn nun voller Neugier. »Wir sollten abwarten und nichts überstürzen. Vieles von dem, was das Akki als Verbesserung anbieten würde, brauchten wir gar nicht.«
»Mit unseren traditionellen Geräten und Methoden sind wir Hunderte von Planetenumläufen lang gut gefahren«, übertönte der unmelodische Bass von Nummer Fünf den hellen Tenor von Nummer Drei.
Nummer Drei hob warnend den Finger. »Man muss gut Acht geben, wenn man irgendwelche Neuerungen einführt. Nicht alles, was modern ist, bedeutet gleichzeitig Fortschritt.«
»Gibt es da, wo du herkommst, elektrischen Strom?«, erkundigte sich Nummer Sechs.
»Ja, aber er wird auf natürlichem Wege erzeugt. Wir benutzen Solarzellen, die schon immer da gewesen sind.«
»Unsere Vorfahren haben sie gebaut«, erklärte Nummer Eins.
»Wie ich bereits sagte«, fuhr Nummer Drei fort, »mag es durchaus Umstellungen geben, die von Nutzen sind, aber man muss vorsichtig sein, sonst ergeht es uns so wie unseren Ahnen. Zu viel Technik bewirkte ihren Untergang. Das steht sogar in der Charta.«
»Tatsächlich?«, staunte Nummer Zwei.
»Tatsächlich!«, bekräftigte Nummer Drei. »Wir können dafür sorgen, dass die Traditionen bewahrt und wir nicht mit modernem Krempel überschwemmt werden, den wir gar nicht brauchen.«
»Was genau könnten wir denn unternehmen?«, fragte Nummer Eins.
»Ich werde darüber nachdenken«, erwiderte Nummer Vier. »Ich bin dagegen, dass man Menschen ein Leid zufügt, aber unbelebte Gegenstände, Sachen, die uns mehr schaden als nützen, kann man sabotieren.« Erwartungsvoll blickte sie Nummer Fünf an.
Nummer Drei brach in schallendes Gelächter aus. »Ein paar Leute haben das vor Jahren mal versucht. Seitdem sind sie taub ...«
»Aber das Akki ist tot«, gab Nummer Eins zu bedenken.
Nummer Drei fauchte ihn wütend an. »Man hat sie verbannt, weil sie sich an dem Meisterharfner von Pern vergriffen haben ...«
»Wie ich hörte, starb Meister Robinton in dem Raum, in dem das Akki untergebracht war. Vielleicht hatte er die Gefährlichkeit des Monstrums erkannt und es abgeschaltet«, spekulierte Nummer Fünf.
Die Frau stieß einen erstickten Schrei aus.
»Eine interessante Theorie«, sagte ihr Sitznachbar und beugte sich in komplizenhafter Manier vor. »Gibt es irgendwelche Beweise?«
»Natürlich nicht. Wie könnte es auch sein«, entgegnete Nummer Eins mit allen Anzeichen des Entsetzens. »Die Heiler sagten, Meister Robintons Herz hätte aufgehört zu schlagen. Weil es bei seiner Entführung sehr strapaziert worden sei.«
»Hinterher war er nie wieder derselbe«, pflichtete Nummer Zwei ihm bei, der bei Meister Robintons Tod aufrichtige Trauer empfunden hatte, wie wohl jeder Bewohner von Pern. »Auf dem Akki-Bildschirm soll eine Nachricht gestanden haben. Sie blieb dort eine sehr lange Zeit und verschwand dann von selbst.«
»›Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde‹«, murmelte Nummer Sechs.
»Das gibt einem zu denken, findet ihr nicht auch?«, meinte Nummer Drei.
»Allerdings«, stimmte Nummer Vier mit blitzenden Augen zu.
»Es gibt noch mehr Stoff, über den nachzudenken es sich lohnt«, warf Nummer Fünf mit seiner tonlosen Stimme ein. »Nämlich wie das Akki unseren herkömmlichen Lebensstil beeinflusst hat. Sitten und Gebräuche, die seit jeher bei uns in hohem Ansehen standen, und die für unser Überleben unabdingbar waren, sollten auf einmal nichts mehr gelten.« Abermals dominierte Nummer Fünf das Gespräch. »Auch ich ...« – er legte eine Kunstpause ein – »bin dagegen, dass man Lebewesen Schaden zufügt.« Um der dramatischen Wirkung willen hielt er noch einmal im Sprechen inne. »Doch Gegenstände zu vernichten, die arglosen Menschen auf Dauer zum Nachteil gereichen, ist etwas völlig anderes. Man sollte sicherstellen, dass neumodische Materialien und Objekte, die nur Unheil anrichten, gar nicht erst fabriziert werden können.«
»Elektrische Lampen zum Beispiel«, frotzelte Nummer Zwei, doch die Ironie kam bei Nummer Drei nicht gut an. Nummer Fünf und Vier funkelten ihn so böse an, dass er sich innerlich vor Verlegenheit wand.
»Ich bin dafür, dass man einige dieser neumodischen Geräte vernichtet«, murmelte Nummer Zwei, doch es klang nicht sehr überzeugend. »Unsereins kommt ja doch nie in den Genuss solcher Apparate«, klagte er neidvoll.
»Dem stimme ich aus ganzem Herzen zu. Man bedenke nur, dass die Drachenreiter am meisten von irgendwelchen Errungenschaften profitieren. Ihre Wünsche haben immer Vorrang«, meinte Nummer Drei. »Sie nehmen uns weg, was uns von Rechts wegen zusteht.«
»Es gibt mehr Leute als ihr denkt, die daran zweifeln, dass das Akki tatsächlich einen Fortschritt für Pern bedeutet«, verlautbarte Nummer Fünf mit seiner eintönigen Stimme. »Sie finden, eine Maschine dürfe nicht schlauer sein als die Menschen.«
Nummer Eins nickte kräftig mit dem Kopf und stand auf. »Ich komme gleich zurück und bringe ein paar Leute mit, die dieselbe Auffassung vertreten wie wir.«
Als sich das Fest dem Ende zuneigte, hatten sich über zwanzig »rechtschaffen denkende« Männer und Frauen zusammengefunden und diskutierten leise darüber, ob das Akki-Monstrum überhaupt das Wohl der Perneser im Sinn haben könnte, da es sich letzten Endes nur um eine Maschine handelte.
Niemand nannte seinen Namen oder seine Herkunft, doch man kam überein, sich bei der nächsten Versammlung wieder zu treffen. In der Zwischenzeit wollte ein jeder nach Gleichgesinnten Ausschau halten, die gegen unerwünschte und möglicherweise nachteilige Veränderungen rebellierten, die man fälschlicherweise als »Fortschritt« darstellte.
Es überraschte Nummer Eins und Nummer Zwei, wenn auch nicht Nummer Drei, Vier, Sechs und vor allem nicht Nummer Fünf, die diese Bezeichnungen weiterhin bei Versammlungen benutzten, dass viele Menschen kleine und große, eingebildete und reale Sorgen hatten, um die man sich kümmern konnte. Nummer Fünf sprach nie wieder über das merkwürdige Zusammentreffen von Meister Robintons Tod und dem Abschalten des Akki, doch dieses Gerücht machte die Runde und verschaffte den Traditionalisten einen Zulauf, den sie normalerweise nicht bekommen hätten.
Meister Robinton war ungemein beliebt gewesen, und falls das Monstrum in irgendeiner Weise seinen Tod verursacht hatte, war dies für viele Grund genug, sich seinen Gegnern anzuschließen. Wenn neu eingeführte Maschinen oder Techniken, die das Begriffsvermögen der einfachen Menschen überstiegen, den Plänen des Akki entstammten, schürte dies ein Klima aus Angst und Misstrauen, sodass es ein Kinderspiel war, die Leute zum aktiven Handeln zu verleiten. Der Umstand, dass niemand wusste, wer zuerst verschieden war, das Akki oder der Meisterharfner, ließ sich trefflich für Propagandazwecke nutzen.
Manch einer gab sich damit zufrieden, Mitglied einer subversiven Gruppe zu sein und kleinere Sabotageakte zu planen, die dann mit einer perversen Lust am Zerstören in die Tat umgesetzt wurden. Andere hingegen strebten mehr an als diese relativ harmlosen Aktionen, die nur geringen Schaden anrichteten, die Produktion von weiteren »monströsen« Apparaturen nicht verhinderten und weder in den Burgen noch in den Hallen für nennenswerte Unruhe sorgten.
Obwohl die Heiler ungehalten waren, wenn auf einmal die letzten Sendungen an Medikamenten aus ihren Regalen verschwanden, machte sich niemand Gedanken darüber, wieso ausschließlich die modernen Heilmittel und niemals die herkömmlichen Arzneien stibitzt wurden.
Wenn in einer Handwerkshalle Maschinenteile für irgendein neues Gerät kaputt gingen oder jemand Säure über Transportkisten verschüttet hatte, versah man die Türen mit stabileren Schlössern und hielt ein wachsames Auge auf Fremde, die in der Halle herumstromerten.
Als in der Halle der Drucker Altpapier gestohlen wurde, das zum Recyceln bestimmt war, dachte keiner der Lehrlinge daran, den Vorfall zu melden.
Eines Tages entdeckten die Händler der Lilcamp Handelskarawane, die wertvolle Bauteile von einer Schmiedehalle zur anderen transportierten, dass die sorgfältig in Kisten verpackten Waren fehlten. Man erstattete Meister Fandarel von der Halle der Schmiedezunft in Telgar Bericht. Fandarel schickte eine in scharfen Worten abgefasste Nachricht an den Meisterharfner Sebell und wies nachdrücklich darauf hin, dass nicht zum ersten Mal kostbares Transportgut, das für eine Schmiedehalle bestimmt war, auf mysteriöse Weise abhanden kam. Einer der Heilergesellen hatte sich beiläufig darüber beklagt, dass er immer öfter losgeschickt wurde, um Heiler, die in abgeschiedenen Gegenden praktizierten, mit neuen Medikamenten zu versorgen. Fandarel, Sebell und Meisterheiler Oldive dämmerte es allmählich, dass hier nicht der blinde Zufall waltete, sondern dass irgendjemand versuchte, gewisse Dinge zu blockieren.
Meisterharfner Mekelroy, alias Pinch, befasste sich ausgiebig mit diesen Vorfällen und entdeckte das Muster, das hinter den Diebstählen und dem Vandalismus steckte.
ERSTER TEIL
Ende des Planetenumlaufs
Ende des Planetenumlaufs in Landing –
1.1.31 Gegenwärtige Annäherungsphase Akki –
Planetenumlauf 2553 nach der Zeitrechnung des Akki
Da ein Drachenreiter, der in den weitläufigen Akki-Archiven über dicken Wälzern brütete, ganz und gar kein ungewohnter Anblick war, wunderte sich F'lessan, der Reiter des bronzenen Golanth, keineswegs, ein in ihre Studien vertieftes Mädchen zu sehen, deren Schulterknoten sie als grüne Reiterin von der Monaco-Bucht kennzeichnete. Merkwürdig kam ihm vor, dass sie sich während der Festlichkeiten zum Ende des Planetenumlaufs im Lesezimmer des Hauptarchivs verschanzte.
In dieser Nacht feierte der gesamte Planet, der Nord- wie der Südkontinent, den Beginn der zweiunddreißigsten und hoffentlich letzten Saison des Fädenfalls. Selbst durch die dicken Mauern des Gebäudes hörte man die Trommeln und gelegentlich die Blasinstrumente von Landings zentralem Versammlungsplatz.
Wieso war das Mädchen, noch dazu eine grüne Reiterin, nicht draußen und tanzte? Warum machte er nicht bei den Lustbarkeiten mit? Er schnitt eine Grimasse. Noch immer arbeitete er daran, sich von dem Ruf zu befreien, den er sich zu Anfang dieser Fädensaison erworben hatte. Allgemein galt er als leichtsinnig und verwegen. Nicht, dass er sich dadurch von den meisten bronzenen und braunen Drachenreitern unterschieden hätte. »Du hast nur ein bisschen übertrieben«, hatte Mirrim ihm in ihrer unverblümten Art auf den Kopf zu gesagt. Mirrim, die zu jedermanns – nicht zuletzt zu ihrer eigenen – Überraschung beim Gegenüberstellungszeremoniell in Benden den grünen Drachen Path für sich gewonnen hatte. Als T'gellans Weyrgefährtin hatte sie nach und nach ihr anmaßendes Auftreten abgelegt, doch aus ihrer Meinung machte sie immer noch kein Hehl.
Das Mädchen im Archiv beugte sich über eine Sternenkarte, die Rubkats Planetensystem zeigte. Ein Sachgebiet, für das sich gewiss nicht jeder interessierte, dachte F'lessan.
Viele der jüngeren Reiter, deren Karriere mit dem Ausklingen des derzeitigen Fädenfalls in sechzehn Planetenumläufen zu Ende ging, lernten bereits jetzt neue Berufe. Auf diese Weise konnten sie für sich selbst sorgen, wenn die traditionellen Abgaben an die Weyr ausblieben. Solange es Fäden regnete, unterstützten die Burgen und Hallen die Drachenreiter, die sie im Gegenzug vor den gefräßigen Organismen schützten, die außer Metall und Stein alles vertilgten. Doch diese Quelle versiegte, wenn die Heimsuchung aus dem Weltall an Pern vorbeigezogen war.
Die Reiter, deren Familien Burgen oder Gewerbehallen besaßen, wurden problemlos in die heimischen Stätten integriert, doch Drachenreiter, die in einem Weyr groß geworden waren, wie F'lessan, mussten sich eine völlig neue Existenz aufbauen. Er konnte von Glück sagen, dass er in den Vorbergen der großen südlichen Gebirgskette Honshu entdeckt hatte. Und da die Weyr dem Rat, der den Planeten informell regierte, das Zugeständnis abgerungen hatten, Drachenreiter auf dem Südkontinent siedeln zu lassen, konnte F'lessan Honshu als seinen Privatbesitz deklarieren.
Um seine Ansprüche zu untermauern, hatte er angeführt, er wolle diesen Wohnsitz der ersten Kolonisten, die auf Pern landeten, komplett restaurieren und seine architektonischen und künstlerischen Schätze jedem zugänglich machen. Er hatte seinen nicht unbeträchtlichen Charme eingesetzt und war vor keiner List zurückgeschreckt, als er die anderen Weyrführer, Gildemeister und Burgherren dazu überredete, ihm den Titel zuzusprechen. Und sowie das Akki – das Akustische System einer Künstlichen Intelligenz – es den Drachenreitern ermöglicht hatte, die Bahn des Tod und Verderbnis bringenden Roten Sterns zu verändern, schickte er sich an, die imposante Felsenfestung Honshu zu restaurieren. Seine Pflichten als Geschwaderführer des Benden-Weyr ließen ihm nicht viel Zeit, doch wann immer es sich einrichten ließ, begab er sich nach Honshu.
Als junger Bursche hatte F'lessan kein Interesse an akademischer Bildung gezeigt. Er schwänzte die Schule, konnte sich nicht aufs Studieren konzentrieren und war nur auf sein Vergnügen aus. Nachdem er den bronzenen Golanth für sich gewonnen hatte, lernte er endlich Disziplin, denn um nichts in der Welt hätte er seinen Drachen vernachlässigt. Seine Zielstrebigkeit und Entschlusskraft machten ihn zu einem überaus geschickten Reiter, der seinen Kameraden als Vorbild dienen konnte – das meinten zumindest die Weyrlingmeister.
Honshu war seine zweite große Leidenschaft. Von Anfang an übte die uralte Festung mit ihren herrlichen Wandmalereien in der Haupthalle eine eigentümliche Faszination auf ihn aus. Er war besessen von dem Wunsch, dieses Kulturerbe zu erhalten und so viel wie möglich über seine Gründer und Bewohner herauszufinden. Mit dem für ihn typischen Enthusiasmus ernannte er sich selbst zum Hüter dieser Felsenburg.
Er schuftete mehr als alle anderen, um den Ort zu säubern und seine ehemalige Pracht wiederherzustellen. Und heute trachtete er danach, ein Geheimnis zu lüften. Für seinen Besuch der Akki-Einrichtungen hatte er speziell diesen Zeitpunkt gewählt, weil er hoffte, der einzige Besucher zu sein. An seinen Recherchen ließ er niemanden teilnehmen, da diese Obsession, die er für Honshu entwickelte, bei den meisten Menschen auf Unverständnis stieß.
Du bist der Beschützer von Honshu. Ich halte mich gern dort auf, sagte Golanth, der sich zusammen mit den anderen Drachen, die ihre Reiter zum Fest nach Landing gebracht hatten, in der heißen Mittagssonne aalte. Es gibt schöne Stellen, an denen ich mich sonnen kann, sauberes Wasser und viele fette Herdentiere.
F'lessan, der immer noch an der Schwelle zum Lesesaal stand, grinste. Du hast Honshu entdeckt. Es ist unsere Heimstatt.
Ja, stimmte Golanth freudig zu.
F'lessan stopfte seine Reithandschuhe in einen hübschen Packsack, ein Geschenk, das er zum Ende des Planetenumlaufs bekommen hatte. Auch die Handschuhe waren neu, und das Leder aus Wherhaut blieb trotz intensiven Einölens zäh. Der Packsack stammte von Lessa und F'lar. Für ihn waren sie weniger seine Eltern, sondern in erster Linie seine Weyrführer, ein Umstand, der ihm wichtiger schien als die Blutsbande.
Zu seinem Geburtstag, am Tag seiner Prägung auf Golanth, und zum Ende eines Planetenumlaufs machten sie ihm jedes Mal ein Geschenk. F'lessan wusste nicht recht, ob sie ihn durch diese Aufmerksamkeiten daran erinnern wollten, dass er Eltern hatte, oder ob sie selbst ein Ritual brauchten, um an ihren Sohn zu denken. In einem Weyr war es gang und gäbe, dass Kinder in Pflegefamilien aufwuchsen und somit viele Bezugspersonen kannten. Es mussten nicht notgedrungen die leiblichen Eltern sein, die Interesse an einem jungen Menschen bekundeten. Als F'lessan älter wurde, erkannte er, wie unbeschwert es sich in einem Weyr lebte. Von den Jugendlichen, die in einer Burg groß wurden, verlangte man Angepasstheit und Konformität, und er war froh, dass ihm dieser Zwang erspart blieb.
Nachdem er die derben Handschuhe im Packsack verstaut hatte, zögerte er, den Raum zu betreten. Er wollte die junge Frau nicht stören, die so in ihre Studien versunken war, dass sie seine Anwesenheit nicht bemerkte.
An deiner Gesellschaft hatte noch nie jemand etwas auszusetzen, meinte sein Drache.
Es widerstrebt mir, jemanden aus seiner Konzentration zu reißen, gab F'lessan zurück. Vielleicht lernt sie ja für einen Beruf, den sie nach dem Ende des Fädenfalls ausüben möchte.
Auf Pern wird man immer Drachen brauchen, behauptete Golanth zuversichtlich.
Golanth wurde nicht müde, auf diesen Umstand hinzuweisen. Fast schien es, als wolle er sich damit selbst Mut zusprechen. Vielleicht lag es an der Denkweise der bronzenen Drachen – oder er ließ sich von Mnementh beeinflussen. Denn F'lars großer Bronzedrache legte Wert darauf, jeden einzelnen Bronzenen, der in Bendens Brutstätte schlüpfte, subtil zu unterrichten.
F'lessan plante indessen nicht, nach F'lar der nächste Weyrführer von Benden zu werden. F'lessan hoffte, F'lar möge seinen Status bis zum Ende des Fädenfalls beibehalten. Der Posten des Geschwaderführers behagte F'lessan am meisten, vor allen Dingen jetzt, da er Honshu als seinen Privatbesitz beanspruchte. Wenn F'lar und Lessa später möglicherweise Honshu zu ihrem Ruhesitz auserkoren, käme niemand mehr auf den Gedanken, ihm den Titel streitig zu machen.
Im Gegensatz zur Stellung eines Burgherrn war das Amt des Weyrführers nicht erblich. Zum Beispiel waren erst kürzlich R'mart und Bedella aus Telgar abgesetzt worden. Um neuer Weyrführer zu werden, musste der Bronzedrache eines Reiters die paarungswillige Jungkönigin befliegen. J'fery, der Reiter des bronzenen Willerth, hatte die Herausforderung bestanden, und Palla, die Reiterin der goldenen Talmanth, war seine Weyrherrin. F'lessan kannte die beiden gut und wusste, dass sie dem Telgar-Weyr hervorragend dienen würden, bis es keine Fäden mehr gab, die Pern bedrohten.
Wir dürfen nur nicht übermütig werden und in denselben Fehler verfallen wie unsere Ahnen, dachte F'lessan bei sich. Sowie die Gefahr durch die Fäden endgültig ausgemerzt ist, müssen wir freiwillig auf unsere Privilegien verzichten.
Eine Bewegung erregte seine Aufmerksamkeit. Die Stiefel der jungen Frau scharrten über den Steinfußboden, als sie die Knöchel übereinander kreuzte. Mit aufgestützten Ellbogen beugte sie sich über das Lesepult. Das weiche Licht beleuchtete ihr Profil, und er sah, wie sie mit höchster Anspannung die Sternenkarte studierte. Einmal seufzte sie und furchte die Stirn.
Sie war eine ungemein aparte junge Frau. Das mittelbraune, leicht rötlich schimmernde Haar war am Oberkopf kurz getrimmt, um zu vermeiden, dass sie unter der eng anliegenden Reitkappe schwitzte. Das lange, gewellte Nackenhaar reichte bis auf den Rücken und war unten in einer geraden Linie gestutzt. Wohlwollend betrachtete er ihre schmale Nase und die zart geschwungenen Augenbrauen.
Jählings kehrte sie ihm ihr Gesicht zu und merkte, dass sie beobachtet wurde.
»Entschuldige bitte. Ich hatte nicht damit gerechnet, um diese Zeit jemanden hier anzutreffen«, gab F'lessan munter von sich und betrat den Raum. Seine Schuhe aus weichem Leder verursachten auf den Steinplatten kaum ein Geräusch.
Ihre erschrockene Reaktion verriet ihm, dass auch sie gehofft hatte, allein und in Ruhe studieren zu können. Sie stand im Begriff, ihren Stuhl zurückzuschieben, und ehe sie aufstehen konnte, hob er abwehrend die Hand. Die meisten Reiter kannten ihn. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, mit den beiden südlichen Weyrn gemeinsam gegen die Fäden zu kämpfen, und er fehlte bei kaum einer Gegenüberstellungszeremonie. Er war dabei, weil ihm dieses Prägungsritual gefiel, und bei jeder dieser Gelegenheiten festigten er und Golanth ihre lebenslange Bindung aufs Neue.
Jetzt, da er dem Mädchen direkt ins Gesicht sah, erkannte er sie.
»Du bist Tai, Zaranths Reiterin, nicht wahr?«, fragte er sie und hoffte, dass er sich nicht irrte.
Auf dein Gedächtnis kannst du dich doch verlassen, murmelte Golanth.
Unverhofft hatte sie vor ungefähr fünf Planetenumläufen im Weyr der Monaco-Bucht einen grünen Drachen für sich gewonnen. Sie war in den Süden gereist, doch woher sie kam, wusste er nicht mehr. Seit man das Akki damals, im Jahre 2538 nach alter perneser Zeitrechnung, entdeckt hatte, strömten die Menschen in Scharen nach Landing, aber nicht immer, um dort zu bleiben. Er schätzte das Mädchen auf Mitte Zwanzig, und er fragte sich, ob sie wohl während der fünf denkwürdigen Planetenumläufe, in denen das Akki aktiv war, zu einer der Arbeitsgruppen gehört hatte. Immerhin legte das Akki eine ganz besondere Vorliebe für grüne Drachen und deren Reiterinnen an den Tag.
F'lessan streckte ihr zum Gruß die Hand entgegen. Sie blickte verlegen drein und schlug die Augen nieder, sowie sich ihre Finger berührten. Sie hatte einen kräftigen Händedruck, und er spürte, dass ihr Handrücken mit kleinen Schnittwunden übersät war, als hätte sie ihn bei einem Sturz aufgeschürft. Eine Schönheit im klassischen Sinne war sie nicht, sie verströmte auch keine Aura von Sinnlichkeit, wie so viele grüne Reiterinnen, und sie war nur um einen halben Kopf kleiner als er. Außerdem erschien sie ihm zu dünn, doch ihre knabenhafte Figur verlieh ihr einen ganz eigenen Reiz.
»Ich bin F'lessan von Benden, Golanths Reiter.«
»Ja«, gab sie kurz angebunden zurück und maß ihn mit einem durchdringenden Blick. Sie hatte mandelförmige, schräg gestellte Augen, doch da sie gleich darauf wieder die Lider senkte, konnte er ihre Farbe nicht feststellen. Zu seinem Erstaunen errötete sie. »Ich weiß.« Sie schien erst Luft zu holen, ehe sie fortfuhr: »Zaranth erzählt mir, Golanth würde sich bei ihr entschuldigen, weil er ihre Mittagsruhe gestört hat.« Sie bedachte ihn mit einem weiteren verstohlenen Blick, während sie linkisch ihre Hände so fest ineinander verschränkte, dass die Knöchel weiß hervortraten.
F'lessan setzte sein strahlendstes Lächeln auf. »Golanth ist immer sehr rücksichtsvoll.« Er verbeugte sich und zeigte auf das Buch auf dem Lesepult. »Lass dich von mir nicht stören. Ich verziehe mich nach dort hinten.« Er deutete auf eine entfernte Ecke.
Er konnte ebenso gut in einem Alkoven arbeiten und brauchte den Hauptlesesaal gar nicht zu benutzen. Im Nu hatte er sich drei der Berichte besorgt, in denen er die Informationen, auf die es ihm ankam, zu finden hoffte, und schleppte sie an einen Tisch im Alkoven. Ein schmales Fenster gewährte einen Blick auf die Hügel im Osten und das im Sonnenglast schimmernde Meer. Er nahm Platz, legte den Stapel Dokumente auf das Pult und begann in den alten COM-Tower-Aufzeichnungen zu blättern. Er suchte nach einem ganz bestimmten Namen: Stev Kimmer, der in den Personallisten der Kolonie als Verwalter der Insel Bitkim aufgeführt wurde, wo sich nun Burg Ista befand. F'lessan interessierte sich, welche Beziehung zwischen Kimmer und Kenjo Fusaiyuki bestanden hatte, der als Erster in Honshu gesiedelt hatte.