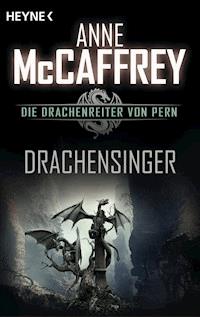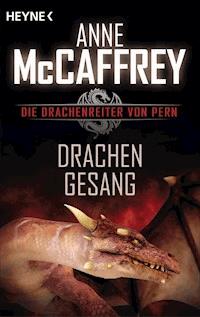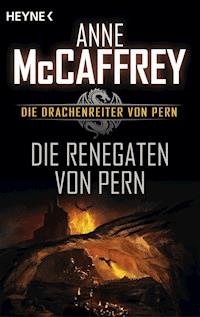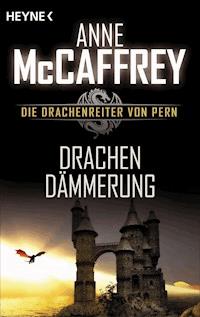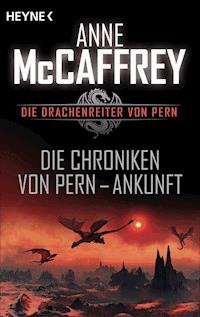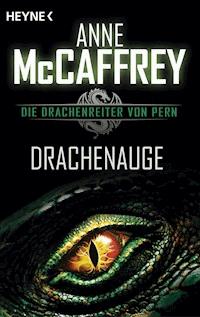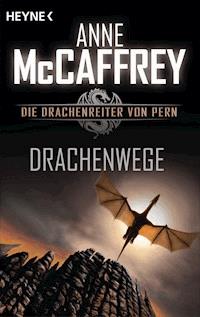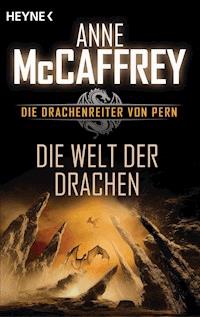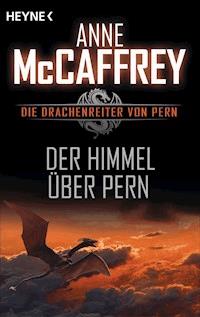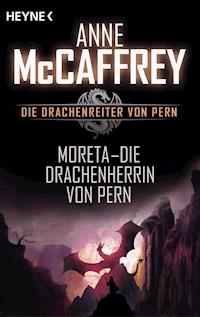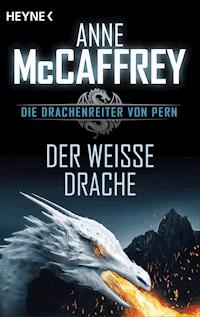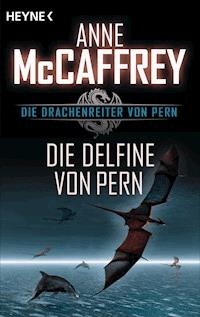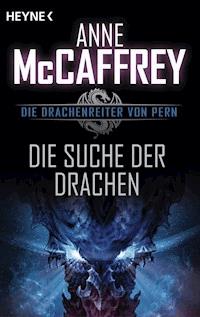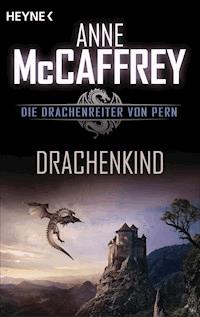
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Mädchen, das mit Drachen spricht
Die junge Aramina hat die ungewöhnliche Fähigkeit, die telepathisch begabten Drachen von Pern hören zu können – sehr zur Besorgnis ihrer Mutter, die fürchtet, dass Aramina eines Tages die Familie verlassen könnte, um eine Drachenreiterin zu werden. Ihre Familie gehört zu den Nomaden, die das freie Leben jenseits der Burgen und Höfe vorzieht. Aramina muss einen Weg finden, ihr Talent zu erforschen, ohne ihre Familie dafür zu opfern …
Diese Kurzgeschichte aus dem Drachenreiter-Universum und weitere Erzählungen von Anne McCaffrey finden Sie in diesem Band.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ANNE McCAFFREY
DRACHENKIND
Die Drachenreiter von Pern
Band 18
Erzählungen
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Die junge Aramina hat die ungewöhnliche Fähigkeit, die telepathisch begabten Drachen von Pern hören zu können – sehr zur Besorgnis ihrer Mutter, die fürchtet, dass Aramina eines Tages die Familie verlassen könnte, um eine Drachenreiterin zu werden. Ihre Familie gehört zu den Nomaden, die das freie Leben jenseits der Burgen und Höfe vorzieht. Aramina muss einen Weg finden, ihr Talent zu erforschen, ohne ihre Familie dafür zu opfern …
Diese Kurzgeschichte aus dem Drachenreiter-Universum und weitere Erzählungen von Anne McCaffrey finden Sie in diesem Band.
Die Autorin
Anne McCaffrey wurde am 1. April 1926 in Cambridge, Massachusetts, geboren, und schloss 1947 ihr Slawistik-Studium am Radcliffe College ab. Danach studierte sie Gesang und Opernregie. In den Fünfzigerjahren veröffentlichte sie ihre ersten Science-Fiction-Kurzgeschichten, ab 1956 widmete sie sich hauptberuflich dem Schreiben. 1967 erschien die erste Story über die Drachenreiter von Pern, »Weyr Search«, und gewann den Hugo Award im darauffolgenden Jahr. Für ihre zweite Drachenreiter-Story »Dragonrider« wurde sie 1969 mit dem Nebula Award ausgezeichnet. Anne McCaffrey war die erste Frau, die diese beiden Preise gewann, und kombinierte die beiden Geschichten später zu ihrem ersten Drachenreiter-Roman »Die Welt der Drachen«. 1970 wanderte sie nach Irland aus, wo sie Rennpferde züchtete. Bis zu ihrem Tod am 21. November 2011 im Alter von 85 Jahren setzte sie ihre große Drachenreiter-Saga fort, zuletzt zusammen mit ihrem Sohn Todd.
www.diezukunft.de
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der Originalausgabe
THE GIRL WHO HEARD DRAGONS
Aus dem Amerikanischen von Ingrid Herrmann-Nytko
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1994 by Anne McCaffrey
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Karte: Andreas Hancock
Satz: Thomas Menne
ISBN 978-3-641-20888-2V002
INHALT
Einführung: Ach, Sie sind Anne McCaffrey
Introduction: So You're Anne McCaffrey
1. Drachenkind
The Girl Who Heard Dragons
2. Die samtenen Felder
Velvet Fields
3. Euterpe amüsiert sich
Euterpe on a Fling
4. Die Pflicht ruft
Duty Calls
5. Das ramponierte Dornröschen
A Sleeping Humpty Dumpty Beauty
6. Die Mandalay-Kur
The Mandalay Cure
7. Gänse im Flug
A Flock of Geese
8. Ein Liebesdienst
The Greatest Love
9. Das stille Wasser
A Quiet One
10. Das Spiel
If Madam Likes you ...
11. Zulei, Grace, Nimshi und die verdammten Yankees
Zulei, Grace, Nimshi, and the Damnyankees
12. Der Cinderella-Trick
Cinderella Switch
13. Die Macht der Gewohnheit
Habit Is an Old Horse
14. Die Hofdamen
Lady-in-Waiting
15. Gestrandet
The Bones Do Lie
EINFÜHRUNG
Ach, Sie sind Anne McCaffrey
Ich weiß nie so genau, welches Bild sich meine Leser von mir machen. Aber wenn Sie mich persönlich kennen lernen, reagieren sie im Allgemeinen mit dem Ausruf: »Ach, Sie sind Anne McCaffrey?« Bis jetzt brachte ich noch nie den Mut auf zu fragen, was sie denn erwartet hatten. Der Tonfall schwankt zwischen Staunen, Skepsis und tiefer Enttäuschung. Dabei würde ich mich mit folgenden Worten beschreiben: »Mein Haar ist silbergrau, ich habe grüne Augen und das Gesicht ist voller Sommersprossen. Der Rest verändert sich, ohne dass es jemandem auffällt« – wobei mit »Rest« mein übriger Körper gemeint ist, der dem Alterungsprozess unterworfen ist, was mich jedoch nicht weiter bekümmert.
Zum Glück erfreuen sich die Porträts von Autoren keiner so großen Verbreitung wie die Gesichter anderer Berühmtheiten. Oftmals prangt hinten auf dem Schutzumschlag eines Buches ein privat oder offiziell aufgenommenes Foto des Schriftstellers, doch nur die wenigsten Menschen bringen es dann mit der Person in Verbindung, die in einem Flugzeug neben ihnen sitzt oder durch ein Einkaufszentrum schlendert.
Einmal, in einem Shuttle von New York nach Boston, wurde ich erkannt. Um die Mittagsstunde hatte ich in Boston in einer Fernseh-Talkshow mitgewirkt. An diese Show erinnere ich mich sehr gut, weil ich während einer Werbepause im Publikum saß und darauf wartete, dass ich an die Reihe kam, als Ethel Merman plötzlich hereinrauschte. Sie war gekommen, um ihre Autobiographie vorzustellen. Nachdem sie dies getan hatte, segelte sie wieder hinaus. Zu meinem Entsetzen wurde ich unmittelbar darauf auf die Bühne gebeten.
Ich befand mich immer noch in einer Art Trance (weil ich viele Lieder zu singen pflegte, die durch Ethel Merman populär wurden), und dann fragte mich der Moderator, wie ich auf meine phantastischen Ideen käme.
»Das ist nicht annähernd so anstrengend als Ethel Mermans Auftritt in dieser Show zu verfolgen«, erwiderte ich und erntete Gelächter und Applaus.
Ungefähr zwei Stunden später ging ich durch den Mittelgang des Shuttles; ein junges Mädchen tippte mir auf die Schulter und wollte wissen, ob ich nicht Anne McCaffrey sei.
»Ach, Sie lesen meine Bücher?«, entgegnete ich erfreut.
»Nein, aber ich habe Sie aus der Show mit Ethel Merman wiedererkannt.«
Am Anfang meiner Karriere gewöhnte ich mir an, meinen Sitznachbarn im Flugzeug (vor allen Dingen auf Langstreckenflügen) niemals zu verraten, dass ich von Beruf Schriftstellerin bin.
Denn sowie sie es erfuhren, legten sie mir in aller Ausführlichkeit dar, wie man einen Bestseller schreibt, wobei der Inhalt stets ihre persönliche Lebensgeschichte wiedergab. Wenn man mich darauf anspricht, was ich so mache, antworte ich meistens, ich würde 1) Kartoffeln anbauen, 2) Pferde züchten, 3) meine Enkel besuchen. Die letzte Version bringt, bis auf die redseligsten Leute, fast jeden zum Schweigen, denn wer möchte schon mit Fotos oder Anekdoten von der lieben Nachkommenschaft gelangweilt werden?
Zweimal jedoch bereiteten mir Sitznachbarn eine große Freude. 1980 flog ich innerhalb Australiens von Melbourne nach Sydney und brütete gerade eine schwere Erkältung aus. Um mich zu beschäftigen, löste ich ein Riesen-Kreuzworträtsel, und da ich am Fenster saß, achtete ich nicht auf die beiden Passagiere, die neben mir Platz nahmen.
Als ich dann hochblickte, bemerkte ich zu meiner Überraschung, dass der Herr neben mir – Mitte dreißig, attraktiv, sehr elegant gekleidet in feinem grauem Flanell mit Seidenhemd und Countess Mara-Krawatte – in ein Buch vertieft war, dessen Einband mir nur allzu bekannt vorkam. Es handelte sich um meinen Roman Wilde Talente. Ich wartete, bis er eine Seite umblätterte, dann fragte ich ihn in halbwegs skeptischem Ton, ob das Buch gut sei.
Er sah mich an und erwiderte, doch, es sei gut, aber ihm gefielen alle Werke dieser Autorin.
»Das freut mich«, gab ich zurück, »denn Sie sitzen neben ihr!«
Er stellte sich als David Ogilvy vor, Leiter der Sydney Opera Company, und er war unterwegs, um bei einer Konzertversion von Lucia di Lammermoor, bei der Joan Sutherland mitwirkte, Regie zu führen. Bis zur Landung plauderten wir freundschaftlich miteinander, und ich zähle ihn zu meinen prominentesten Lesern.
Jedes Mal, wenn ich mich im Andromeda Book Shop in Birmingham aufhalte, bittet man mich, ein Buch für Bob Monkhouse zu signieren. »Wir müssen aufhören, uns auf diese Art und Weise zu begegnen!«
Im April 1984, auf einer dieser beachtlichen Zickzack-Routen von New York nach Alaska, gesellten sich in Dallas zwei neue Sitznachbarn zu mir: In der Mitte saß ein bildhübsches Mädchen, und am Gang ein schlaksiger junger Bursche, der sie sofort in ein Gespräch verwickelte. Sie war Kosmetikerin und wollte nach Seattle, er erzählte, er habe soeben einen Erste-Hilfe-Kurs für Hubschrauberpiloten absolviert und befände sich auf dem Heimflug nach Fairbanks in Alaska – was auch mein Ziel war. Ich lauschte ihrem Wortgeplänkel, ohne mich daran zu beteiligen.
Als sie in Seattle ausstieg, erkundigte ich mich bei ihm nach dem Wetter in Fairbanks. Er blieb freundlich, wollte aber offensichtlich in seinem Buch schmökern – einem SF-Titel. Ich wollte von ihm wissen, ob er ein Fan dieses Genres sei. Er erwiderte, er liebe harte, wissenschaftlich fundierte SF, und Fantasy fände er langweilig. Aus lauter Höflichkeit fragte er mich, aus welchem Grund ich nach Alaska flöge, und ich erzählte, ich würde Kartoffeln anbauen.
Als Autorin mit Lehrauftrag verbrachte ich eine herrliche Zeit in Fairbanks, fuhr mit Hundeschlitten, aß Spaghetti mit Elchfleisch, beobachtete die Aurora borealis, übte einen verderblichen Einfluss auf Studenten der High-School und der Universität von Alaska aus – sowie auf jeden, der mir über den Weg lief. In Fairbanks feierte ich meinen Geburtstag, und die Lehrlinge der örtlichen Bäckerei produzierten einen gigantischen Kuchen in Form eines Weißen Drachen – der für sämtliche Besucher des Fairbanks Arts Buffet reichte. Am letzten Samstag meines Aufenthalts gab ich eine Autogramm-Stunde in einem der Einkaufszentren – und herein kommt mein Freund aus dem Flugzeug, vollbepackt mit Büchern, seine Ehefrau und Töchter im Gefolge. Vor meinem Tisch blieb er stehen und knallte mir jedes einzelne Buch, das ich je geschrieben habe, auf den Tisch, einschließlich der drei Dell-Liebesromane.
»Sie haben mir verschwiegen, dass Sie berühmt sind«, fuhr er mich an.
»Sie haben mich nicht danach gefragt!«
Auf Tagungen kommt es mitunter vor, dass die Anwesenden mich nicht als den angekündigten Ehrengast identifizieren. Wenn mein Zeitplan es erlaubt, sitze ich zu gern am Anmeldetisch und lasse mich von den Reaktionen der Leute inspirieren.
Es geschah 1977 in Baltimore (dem Jahr, in dem ich entdeckte, dass ich eine Kultfigur geworden war). Ich saß an der Anmeldung, als eine Frau in einem adretten Hemdblusenkleid hereinkam; zwei schwere Lord & Taylor-Einkaufstüten schleppend, steuerte sie das Pult an. Sie sah nicht aus wie jemand, dem man zutraut, dass er Science-Fiction-Literatur liest, und ich dachte, sie befände sich im falschen Hotel. Sie erkundigte sich, ob Anne McCaffrey an diesem Tag auch wirklich sprechen würde. Ich versicherte ihr, dass dem so sei. Die Frau fragte mich, wann genau der Vortrag begänne, und ich gab ihr Bescheid (derweil die beiden für die Anmeldung zuständigen Mitarbeiter Mühe hatten, ernst zu bleiben).
»Sind Sie auch ganz sicher, dass sie sprechen wird?«
»Und ob, dafür verbürge ich mich. Sie ist hier und wird um vierzehn Uhr einen Vortrag halten.«
Erst danach bezahlte sie die Gebühr für die Tageskarte.
Nach meiner Rede kam die Dame abermals zu mir, noch immer beladen mit ihren Einkaufstüten. Sie gönnte mir einen Seitenblick und schmunzelte.
»Sie haben mich an der Nase herumgeführt.« Dann kippte sie ihre Tüten aus und zeigte mir meine sämtlichen Romane, inklusive der Liebesromane, obendrein die Magazine, in denen meine Kurzgeschichten veröffentlicht waren.
»Sie mich auch«, versetzte ich und deutete auf die Tüten. Dann fingen wir beide an zu lachen.
Ich entsinne mich, dass ich einmal gefragt wurde, ob ich Doris Pitkin Buck kenne; als ich ihr zum ersten Mal in Milford, Pennsylvania, begegnete, war sie schon über siebzig, doch sie schrieb Erzählungen, die beklemmende Einblicke in die Abgründe der menschlichen Natur bieten, aber auch heitere und erbauliche Geschichten. Als ich einräumte, die Dame sei mir bekannt, fragte mich der Junge nach ihrem Alter.
»Für wie alt hältst du sie denn?«, wollte ich wissen.
»Ach, für Anfang zwanzig.« Offensichtlich kam ihm das sehr alt vor.
»Wie bist du bloß darauf gekommen?«
Eigentlich nicht verwunderlich. Doris schrieb zuweilen in einem frischen, sehr jung wirkenden, romantischen Stil, und als Verfasserin dieser Geschichten blieb sie Anfang zwanzig.
Die Spaltung der Identität, das Aufteilen in die reale und die imaginäre Person, begann für mich gegen Ende der sechziger Jahre, zurzeit des Studentenmassakers von Kent.
Mein Sohn Alec, der damals seine Laufbahn als Protestler einläutete, bat um Erlaubnis, den SFWA-Vervielfältigungsapparat zu benutzen, um ein paar Flugblätter zu kopieren, in denen zu einer Demonstration in Sea Cliff, Long Island, aufgerufen wurde, wo wir damals wohnten. Alec fuhrwerkte in meinem Büro herum und stellte seine Mutter den Columbia-Studenten vor, die an dem Protestmarsch teilnehmen wollten. Einer von ihnen interessierte sich für die Buchtitel in den Regalen.
»Hey, wer liest denn hier Science Fiction?«, fragte er.
»Meine Mutter«, erwiderte Alec, der sich noch nicht schlüssig war, ob er eine Science Fiction-Autorin als Mutter haben wollte.
»Hey, wieso besitzt deine Mutter vier oder fünf der gleichen Exemplare von Anne McCaffreys Büchern?«, hakte der Junge nach.
»Weil sie Anne McCaffrey ist«, gestand Alec gereizt ein.
»Mich laust der Affe!«, staunte der Junge.
Ich glaube, in diesem Augenblick begriff Alex, dass es nicht unbedingt eine Schande bedeutet, wenn die eigene Mutter Science Fiction-Romane schreibt.
Allerdings hat Alec nie gern Romane gelesen, und auf gar keinen Fall war er so besessen von Science Fiction wie sein Bruder Todd. Tatsächlich las Alec erst mein Buch Die Welt der Drachen, nachdem er von Kunden des 100 Flowers Book Shop, den er in Cambridge leitete, auf recht peinliche Weise bloßgestellt wurde.
Jetzt ist er sehr stolz auf meinen Erfolg, berichtet mir fleißig, wie meine Bücher in den örtlichen Buchläden präsentiert werden, und legt meine Titel möglichst gut sichtbar aus.
Etwas Ähnliches passierte an dem Tag, als ich nach einem Exemplar von Todds erstem veröffentlichtem Roman Ausschau hielt: Slammers Down, ein Pathway-Abenteuer, basierend auf David Drakes Soldatenromanen.
Der Manager des B. Dalton-Geschäfts erkannte mich und eilte voller Stolz zu mir, um mir die Präsentation meiner Titel zu zeigen.
»Ich suche nach einem Roman von Todd Johnson«, erklärte ich zu seiner Verblüffung. »Er ist mein Sohn und das ist sein erstes veröffentlichtes Buch!«, fügte ich hinzu und strahlte wie eine einfältige Mutter, die vor lauter Stolz auf ihr Kind beinahe platzt. Und ich gebe zu, ich war stolz.
»Aber Sie sind doch Anne McCaffrey?«, hielt mir der Manager verdutzt entgegen.
»Deshalb kann ich trotzdem Todd Johnsons Mutter sein!«
Ähnlichen Zweifeln begegnete Todd; das ist verständlich, denn nach meiner Scheidung nahm ich meinen Mädchennamen wieder an. Eines Abends, Todd war Portier in Lehighs Sporthalle und las meinen neu erschienen Roman Der weiße Drache, da erkannte einer der Studenten den Titel.
»Hey, ist das Buch gut?«, fragte er Todd.
»Es ist nicht übel«, antwortete Todd, und da er sehr ehrlich ist, fügte er hinzu: »Aber es stecken jede Menge Druckfehler drin.«
»Ach, wirklich? Wirst du das dem Verleger mitteilen?«
»Nein, ich sag's Anne McCaffrey.«
»Das würdest du wagen?«
»Klar, sie ist meine Mutter.«
»Es fällt mir schwer, das zu glauben«, erwiderte der Student und stakste davon.
Auf Grund von Todds bemerkenswerter Persönlichkeit heißt es in Planet der Entscheidung »gewidmet Todd Johnson, wie könnte es anders sein.«
Als ich dann später zwischen zwei Tagungen in Lehigh eintraf, signierte ich sämtliche Exemplare von Planet der Entscheidung in Lehighs Buchladen und fügte hinzu: »Jawohl, ICH BIN seine Mutter!«
Während Todds Militärdienst, den er in Böblingen, Westdeutschland, absolvierte, pflegte er im Buchladen des Stützpunktes nach Neuerscheinungen zu stöbern. Zu seinem gelinden Erstaunen traf er seinen Captain dabei an, wie der nach SF-Titeln suchte. Sie unterhielten sich über Autoren und neue Titel, und dann nahm der Captain ein Exemplar von Moreta – Die Drachenherrin von Pern in die Hand, das er Todd als Lektüre empfahl. Mein Sohn erwiderte:
»Danke, Sir, aber ich kenne das Buch.«
»Es ist doch gerade erst herausgekommen.«
»Ich habe das Manuskript gelesen.«
»Wie kamen Sie dazu, Johnson?«
»Die Autorin ist meine Mutter!«
(Und wieder) »Mich laust der Affe!«
Fans in Schlüsselpositionen zu haben, ist ein Phänomen, mit dem man konfrontiert wird, wenn man es am wenigsten erwartet und am dringendsten braucht.
Lassen Sie mich ein Beispiel anführen. Es passierte 1979 während meiner anstrengenden Werbetour für Der weiße Drache – zweiundzwanzig Städte in zweiunddreißig Tagen. Als ich in Toledo, Kansas, eintraf, war mein Adrenalinspiegel so hoch, dass ich fünf Nächte lang nicht geschlafen hatte. Meine Begleiter engagierten einen Arzt, der während eines Presseempfangs neben mir saß – der Doktor war jemand, der selbst gern las –, und er verschrieb mir ein Beruhigungsmittel, welches meinen Stress tatsächlich abmilderte. Leider half es mir nicht einzuschlafen. Am Abend musste ich nach Minneapolis weiterreisen, und um halb vier Uhr morgens hatte ich immer noch keine Ruhe gefunden. Ich rief den Portier an der Hotelrezeption an und fragte ihn, was in einem medizinischen Notfall zu tun sei. Er riet mir, mit dem Taxi zum nächsten Krankenhaus zu fahren.
Ich war die einzige Patientin in der Notaufnahme und wurde sofort behandelt. Ich erzählte der Krankenschwester, die wie üblich den Puls, die Temperatur und den Blutdruck maß, was mein Problem sei und zeigte ihr meinen Furcht einflößenden Terminplan. Sie ließ mich im Behandlungsraum zurück und zog los, um mit dem diensthabenden Arzt zu sprechen. Ich hörte, wie sie flüsterte: »Wissen Sie nicht, wer sie ist?«
Er mochte ahnungslos sein, aber die Schwester war im Bilde, und ich bekam ein paar Schlaftabletten – vermutlich nur, weil sie wusste, »wer ich war«, halt nicht nur irgendeine Frau mittleren Alters, die auf einer strapaziösen Reise schlappmachte. Ich fuhr ins Hotel zurück und schlief vier Stunden lang tief und fest.
Seit ich in Irland lebe, tauchen nicht allzu häufig unverhoffte Besucher bei mir auf, obwohl ich staune, wie viele Leute sich die Mühe machen, Dragonhold zu »suchen«, während sie durch Irland reisen. Ich habe es gern, wenn man mir seinen Besuch rechtzeitig telefonisch ankündigt – damit ich wenigstens ein bisschen Ordnung in dem gemütlichen Chaos des Wohnzimmers schaffe und ausreichend Kekse zum Kaffee oder Tee da habe.
Einmal traf ein junger Mann genau in dem Moment ein, als eine störrische Stute über den Zaun der Trainingskoppel sprang und in Richtung Straße galoppierte. Zum Glück besaß er die Geistesgegenwart, beide Arme hochzureißen und das Pferd zurückzuscheuchen. Für seinen Besuch hatte er einen Tag erwischt, wie er für Dragonhold nicht typischer sein kann – es geht aber auch alles schief!
Es ist immer dasselbe: Besucher, mit denen man sich gern länger unterhalten und die man zum Essen einladen möchte, bestehen darauf, bereits nach einer Stunde aufzubrechen. Aber diejenigen, die einen zu Tode langweilen, scheinen Wurzeln zu schlagen. Glücklicherweise weiß meine Schwägerin, Sara Brooks, die jetzt bei mir wohnt, die Symptome richtig zu deuten und liefert mir dann eine passende Ausrede, um den Besuch zu beenden.
Ich führte ein sehr intensives Gespräch mit einer jungen Frau, die darauf bestand, es müsse auf Pern eine Religion geben. Sie fand es absolut unbegreiflich, dass sich innerhalb der Kolonie keine Religion entwickelt hatte. Ich erklärte ihr in resolutem Ton und mit deutlichen Worten, Pern sei meine Welt, und ich könnte damit tun und lassen, was ich wollte. Pern sollte keine Religion haben, da im Namen irgendwelcher Gottheiten schon immer viel zu viele Verbrechen begangen wurden.
Aber mit manchen Leuten kann man nicht diskutieren. Wie auf ein Stichwort hin, »erinnerte« mich meine Schwägerin, mein Buchhalter würde bald eintreffen, und ich sollte ihm schon mal die Akten griffbereit hinlegen.
Dann gibt es die ernsthaften Interviewer, von denen einige ziemlich jung sind. Weil unlängst in einigen Artikeln regelrechter Blödsinn über mich verbreitet wurde – Unwahrheiten und Missverständnisse, die man mühsam widerlegen muss, wenn man darauf angesprochen wird –, bat ich eine nette, junge Interviewerin, ihren Artikel lesen zu dürfen, ehe er in den Druck ging. Mit überschwänglichen Worten stimmte sie zu.
Die beiden Bücher, um die es in dem Interview gehen sollte, hatte sie bei sich, außerdem ein Tonbandgerät, und sie machte sich zusätzlich Notizen. Anderntags rief sie mich an, um mir zu sagen, der Artikel würde unverzüglich gedruckt, deshalb könnte ich das Interview nicht mehr lesen, aber sie sei sich sicher, dass ihr keine Fehler unterlaufen seien. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu seufzen und das Beste zu hoffen.
Ich wurde bitter enttäuscht. Mein Name war kein einziges Mal richtig geschrieben; sie hatte die Titel der beiden Bücher verwechselt; von meiner Schwägerin behauptete sie, sie würde in der Küche »herumwerkeln« – was immer sie darunter verstand. Um der Verwirrung die Krone aufzusetzen, ließ sie meinen Vater im Krimkrieg sterben, dabei fiel er in Korea. Als ich sie anrief und um eine Korrektur bat, war ihr nicht einmal der zeitliche Unterschied zwischen den beiden Kriegen bewusst. Beide fingen mit einem »K« an; ob Korea oder Krim – was machte das schon aus? Schließlich waren beides bewaffnete Konflikte, oder? Da ich ein Mensch bin, der versucht, das Positive an solchen Schnitzern zu sehen, erzählte ich jedem, ich sei in Wahrheit 134 Jahre alt und meine Mutter hätte meinen jüngeren Bruder nach ihrem Tod geboren. Als ich Kevin von den Fehlern berichtete, meinte er nur, dies könne vielleicht erklären, warum er in seinem Leben so viele Probleme hatte!
Weihnachten '91 besuchte ich die in alle Winde verstreuten Mitglieder meiner Familie und erklärte mich zu Autogrammstunden bereit, die stattfanden in Dayton, Ohio; St. Louis, Missouri; Las Vegas, Nevada und Los Angeles. Auf diese Weise revanchierte ich mich für Gefälligkeiten, die man meinen Verwandten erwiesen hatte.
Ich entdeckte, dass es in meiner Lesergemeinde zwei neue Entwicklungen gab: 1) Die Kinder, die die Geschichten von der Harfnerhalle gelesen haben, sind mittlerweile erwachsen und führen ihre eigene Nachkommenschaft an diese Serien heran. 2) Es gibt Kinder, die entweder »The Smallest Dragonboy« oder eine andere Harfnerhallen-Erzählung für den Schulunterricht lesen mussten.
Was Pflichtlektüre betrifft, bin ich ziemlich skeptisch. Ich habe die Bücher gehasst, die ich zwangsweise lesen musste. Als mir in St. Louis drei Jungen erzählten, sie hätten »The Smallest Dragonboy« gelesen und mich dann noch baten, ihnen eine persönliche Widmung in ihre Exemplare von Drachentrommeln zu schreiben, nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte sie, ob ihnen die Geschichte gefallen hätte.
»Na ja, sie war nicht schlecht«, erklärte einer der Buben, der mich an Tom Sawyer erinnerte. »Wirklich nicht übel.«
»Ich fand sie toll«, ergänzte ein anderer aus der Gruppe.
»Seht ihr den Herrn dort auf der Bank?« Ich zeigte auf meinen Bruder, Kevin, der die gleichen silbergrauen Haare hat wie ich und den buchstäblich nichts erschüttern kann. »Das ist mein Bruder, der mir als Vorbild für Keevan diente« – der Held von »The Smallest Dragonboy«. »Von ihm solltet ihr euch auch ein Autogramm holen.«
»Von dem?«, fragte der dritte Junge völlig perplex.
»Er war auch mal jung und sehr tapfer, so wie Keevan.«
Sie holten sich Keves Autogramm. Warum soll ich die ganze Arbeit machen?
Ich kann nicht behaupten, dass ich Autogrammstunden liebe. Nach der letzten Werbetour hatte ich einen Tennisarm. Aber diese Sitzungen geben mir das Feedback, das ein Autor braucht, der viele einsame Stunden am Schreibtisch verbringt. Außerdem geben sie den Leuten die Gelegenheit, mich zu fragen: »Ach, Sie sind Anne McCaffrey?«
Drachenkind
Aramina wurde geweckt durch die eindringlichen Stimmen ihrer Eltern; im zischelnden Flüsterton versuchte Dowell, ihr Vater, die Mutter zu etwas zu überreden, die ihm ängstlich ihre Bedenken entgegenhielt. Anfangs blieb Aramina ganz still liegen, weil sie glaubte, ihre Mutter hätte wieder einmal eine ihrer »Visionen«, doch bei solchen Gelegenheiten klang Barlas Stimme völlig emotionslos. Sie spitzte die Ohren, um das Gesagte zu verstehen, und blendete die vielen nächtlichen Geräusche in der gigantischen Höhle von Igen aus, die ein paar Hundert Heimatlose von Pern beherbergte.
»Schuldzuweisungen nützen uns jetzt auch nichts mehr, Barla«, wisperte ihr Vater, »genauso wenig wie unser Stolz auf Araminas Fähigkeiten. Wir müssen fort. Noch heute Nacht.«
»Aber der Winter steht vor der Tür«, jammerte Barla. »Wie sollen wir überleben?«
»Den letzten Winter in dieser Höhle haben wir auch nur mit knapper Not überstanden. Das erlegte Wild hat für die vielen Menschen kaum gereicht«, entgegnete Dowell, derweil er hastig ihre Siebensachen in den großen Packsack stopfte. »Ich habe gehört, dass es in Lemos Höhlen gibt. Und Lemos ...«
»Verfügt über Holzbestände!« In Barlas Stimme schwang Bitterkeit mit. »Und in Igen sagt dir keines der Hölzer zu.«
»Wir mögen heimatlos sein, Frau, aber unsere Ehre und unsere Würde haben wir uns bewahrt. Bei Lady Thellas Plänen mache ich nicht mit. Ich lasse es nicht zu, dass man unsere Tochter ausnutzt. Pack deine Sachen. Sofort. Ich wecke die Kinder.«
Als Dowell Aramina an der Schulter berührte, schluckte sie ihre Furcht hinunter. Lady Thella Ohneland, Herrin von eigenen Gnaden, war ihr herzlich unsympathisch gewesen, als sie einige Male die Höhlen von Igen aufsuchte, um Anhänger für ihre umherziehenden Banden zu rekrutieren. Giron, Thellas Stellvertreter, fand sie faszinierend und abstoßend zugleich. Dieser ehemalige Drachenreiter hatte Aramina so durchdringend gemustert, dass das Mädchen sich beherrschen musste, um sich unter den Blicken aus diesen kalten, seelenlosen Augen nicht zu krümmen. Es hieß, ein Drachenreiter, der seinen Drachen verloren hatte, sei nur noch ein halber Mann. Thella ließ Andeutungen fallen, Araminas Familie könnte von einem Arrangement profitieren, vielleicht sogar einen festen Wohnsitz in einer Festung ergattern; aber Aramina war nicht so naiv, diesen Köder zu schlucken. Desgleichen stieß Thellas Argument, die Heimatlosen müssten sich zusammentun und ihre gesamte Habe miteinander teilen, bei ihr auf taube Ohren; solche Vorschläge zogen nicht bei einem Kind, welches früh gelernt hatte, dass es nichts umsonst gab.
»Es tut mir Leid, Vater«, murmelte sie ängstlich und zerknirscht.
»Was tut dir Leid? Wofür entschuldigst du dich, mein Kind? Ach so, du hast mitgehört? Es ist nicht deine Schuld, 'Mina. Könntest du dich um deine Schwester kümmern? Wir müssen gleich aufbrechen.«
Aramina nickte. Sie stand auf und wickelte sich geschickt ihre Decke so um die Schultern, dass für Nexa eine Trageschlinge entstand. Als die kleine Familie in Richtung Osten wanderte, hatte sie die Schwester häufig auf diese Weise transportiert. Und als es dann soweit war, legte Nexa lediglich ihre Ärmchen um Araminas magere Schultern und schmiegte sich in die Decke, ohne richtig wach zu werden.
Aus Gewohnheit blickte Aramina in die Runde, um sich zu vergewissern, dass sie nichts von ihrer spärlichen Habe zurückließen.
»Alles, was wir mitnehmen können, habe ich schon auf den Wagen geladen«, erklärte Dowell.
»Und Mutter verdächtigte die diebische Familie aus Nerat, sie hätte sich wieder mal an unseren Sachen vergriffen.« Aramina war ein bisschen verschnupft, weil sie den ganzen Tag lang um das widerliche Camp hatte herumstreichen müssen, für den Fall, dass ihr stibitztes Eigentum auftauchte.
Barla hatte bereits ihre kostbaren Kochtöpfe eingesammelt und in alte Kleidungsstücke gewickelt, damit sie nicht gegeneinander klapperten. Ein Umschlagtuch enthielt den Rest der tragbaren Habe der Familie, die wegen der kriminellen Neigungen der Höhlenbewohner nicht aus den Augen gelassen werden durfte.
»Ganz ruhig jetzt! Kommt mit. Wir müssen das Licht der vollen Monde ausnutzen.«
Zum ersten Mal bedauerte Aramina, dass das Talent ihres Vaters, der exzellent Holz verarbeiten konnte, ihnen eine relativ abgeschiedene Nische im hinteren Bereich der enormen Igen-Höhle verschafft hatte. Selbst während der mörderischen sommerlichen Hitze blieb es dort angenehm kühl, und im Winter waren sie vor den eisigen Stürmen geschützt; nun jedoch kam ihr der Weg nach draußen endlos lang vor, als sie sich behutsam an den schlafenden Menschen vorbeilavierten, bis sie den vom Wind glattgeschliffenen Ausgang der Sandsteinhöhle erreichten.
Ehe sie an den Fluss gelangten, musste Aramina Nexa mehrere Male in der Trageschlinge zurechtrücken. Immer wieder versanken ihre Beine in alten Abfallgruben, und sie musste höllisch aufpassen, um nicht über irgendwelchen Müll zu stolpern. Da die Heimatlosen, die in der Kaverne von Igen hausten, keinen festen Wohnsitz hatten, auf den sie stolz sein konnten, entwickelten sie auch kein Gefühl dafür, dass sie ihre Umgebung sauber halten mussten; und an jedem Ort, an dem sie sich für kürzere oder längere Zeit aufhielten, hinterließen sie ihre Spuren.
Die Monde gingen auf; der hell strahlende, hoch am Himmel stehende Belior und der kleinere, schwächer funkelnde Timor, dessen Bahn niedriger verlief, beleuchteten den Igen-Fluss. Aramina fragte sich, wie lange ihr Vater diesen Exodus geplant hatte, denn nicht nur die Lichtverhältnisse waren ideal, sondern auch der von der Sommersonne halb ausgetrocknete Fluss führte so wenig Wasser, dass die Überquerung zur anderen Seite, an der Lemos begann, gefahrlos vonstatten gehen konnte. Schon bald, wenn im Gebirge die herbstlichen Regenschauer einsetzten, wäre der Strom an dieser Stelle unpassierbar; dort, wo sich jetzt eine seichte Furt befand, würden sich tosende Wassermassen zu Tal wälzen.
Aramina fiel ein, dass Thella und Giron noch am vergangenen Nachmittag die Höhle aufgesucht hatten; das bedeutete, dass sie in den nächsten Tagen nicht zurückkehren würden, was der flüchtenden Familie einen gewissen Vorsprung verschaffte. Keiner der beiden hatte sich Aramina genähert, und dafür war sie dankbar, aber vielleicht hatte Thella Dowell erschreckt. Was auch immer Dowell zum Aufbruch bewogen haben mochte, Aramina war aus vielen Gründen froh, den stinkenden, lärmenden, überfüllten Höhlen entronnen zu sein. Und sie wusste, dass es ihrer Mutter genauso ging. Ihr Bruder Pell neigte dazu, mit seiner Familie zu prahlen, doch hier, in den bewaldeten Bergen, konnten ihn nur Wherrys und Tunnelschlangen hören.
Die Zugtiere waren bereits vor den Reisewagen gespannt, der nicht groß war, aber vier Personen Platz bot. Da Aramina Drachen hören konnte und deshalb Bescheid wusste, wann ein Fädenfall drohte, war es der Familie überhaupt nur vergönnt, diese Reise zu wagen. Und genau diese Fähigkeit, die Stimmen der Drachen zu vernehmen, ein Talent, welches die Familie bis vor kurzem als ihre höchste Trumpfkarte betrachtet hatte, gereichte ihr zum Nachteil; denn Lady Thella Ohneland trachtete danach, sich diese seltene Gabe für ihre ruchlosen Pläne zunutze zu machen.
Abermals rückte Aramina ihre schlummernde Schwester zurecht, denn ihr taten die Schultern weh, und Nexa schien immer schwerer zu werden. Zwischenzeitlich war auch Pell aufgewacht; der Redeschwall, mit dem er loslegen wollte, wurde von Dowells großer Pranke erstickt, und nun trottete der Junge neben seinem Vater her, das aus dem Umschlagtuch geknüpfte Bündel schleppend und leise vor sich hin murrend. Aramina schloss zu ihm auf.
»Hättest du den Mund gehalten und nicht geplaudert, um anzugeben, brauchten wir jetzt nicht wegzulaufen«, raunte sie ihm so leise zu, dass nur er es hören konnte.
»Wir laufen nicht weg!«, schnauzte Pell zurück und ächzte, als das Bündel gegen sein rechtes Schienbein prallte. »Wir sind doch nicht auf der Flucht. Wir suchen uns ein neues Lager!« Er stichelte sie, indem er ihre eigenen Worte benutzte, mit denen sie bei früheren Gelegenheiten versucht hatte, das Stigma ihrer Heimatlosigkeit abzumildern. »Aber wohin können wir gehen?«, klagte er. »Thella findet uns überall.«
»Sie hat es auf mich abgesehen, und mich wird sie nicht kriegen. Du bist vor ihr sicher.«
»Ich will gar nicht vor ihr sicher sein«, versetzte Pell störrisch. »Denn ich hab uns ja eingebrockt, dass wir uns jetzt bei Nacht und Nebel davonmachen müssen.«
»Psst!«, zischte Dowell energisch. Die Kinder setzen den Weg schweigend fort.
Die Zugtiere, Nudge und Shove, drehten den Kopf und muhten leise, als sich die Familie ihnen näherte. Dowell hatte ihnen reichlich Getreide in die Futtersäcke gegeben, damit sie ruhig blieben. Barla kletterte hinten auf den mit einer Lederplane bespannten Wagen, nahm Aramina die schlafende Nexa und Pell das Bündel ab, dann scheuchte sie die Kinder nach vorn, wo Dowell die um einen Stein geschlungenen Zügel losband. Aramina und Pell nahmen ihre Plätze zu beiden Seiten des Gespanns ein, bereit, die Tiere durch den Fluss zu treiben. Dowell und Barla bildeten die Nachhut, bereit, den Wagen von hinten anzuschieben, sollte er steckenbleiben.
Obwohl es mitten in der Nacht war und sie nicht freiwillig die Höhle verließen, verspürte Aramina Erleichterung. Noch vor zwei Planetenumläufen war sie froh gewesen, nicht tagtäglich neben dem Gespann hertrotten zu müssen, aber dieses unstete Leben war immer noch besser, als in Thellas bösartige Machenschaften verwickelt zu werden.
»Wir sind nicht aus freien Stücken heimatlos, Aramina«, hatte Barla ihrer Tochter mehrmals eindringlich erklärt. »Unter Lord Kale von der Festung Ruatha ging es deinem Vater sehr gut. Ach«, dann senkte Barla immer den Kopf und presste die Hände gegen den Mund, weil entsetzliche Erinnerungen sie zu überwältigen drohten, »wie kann ein Mensch nur so perfide sein! Binnen einer Stunde ließ er sämtliche Leute vom Geblüt der Ruatha ermorden!« Daraufhin pflegte Barla stolz den Kopf zu heben. »Im Traum wäre es deinem Vater nicht eingefallen, Lord Fax aus dem Hochland zu dienen.«
Barla war eher eine zurückhaltende Frau, die trotz aller Widrigkeiten und Diskriminierungen, die den Heimatlosen zuteil wurden, eine stille Würde bewahrte. Deshalb fiel ihre Bitterkeit umso mehr ins Gewicht, und sowohl Aramina als auch ihre beiden überlebenden Geschwister hielten Fax für einen abgefeimten Schurken und Tyrannen, der weder Moral noch Erbarmen kannte. Ihre Mutter ließ an ihm kein gutes Haar.
»Wir brachten den Mut auf und zogen weg, als er uns mit diesem unsäglichen Ansinnen belästigte ...« Bei diesem Teil der Geschichte wurde Barla abwechselnd rot und blass. »Euer Vater hatte diesen Wagen gebaut, damit wir Feste und Versammlungen besuchen konnten.« Barla stieß einen Seufzer aus. »Aber als achtbare Pächter, nicht als Vagabunden, ohne Heimat und ohne Freunde. Damals wollten sich andere Burgherren nicht mit Fax anlegen, und obschon euer Vater geglaubt hatte, wir seien andernorts willkommen, nahm uns niemand auf. Aber wir sind nicht wie die anderen, Kinder. Wir hatten uns entschieden, unsere Ehre nicht zu verraten, und wir wollten uns keinem Halunken wie diesem Fax unterwerfen.«
Barla hatte nie ausgesprochen, was genau Fax verlangt hatte, doch seit Aramina selbst zu einer Frau heranwuchs, dämmerte ihr, worum es damals ging. Denn trotz der Mühsalen eines nunmehr vierzehn Planetenumläufe währenden Nomadenlebens und zahlreicher Schwangerschaften als Zeichen von Dowells Zuneigung besaß sie immer noch ein hübsches Gesicht und eine schlanke Gestalt. Aramina war alt genug, um zu merken, dass Barla viel ansehnlicher war als die meisten heimatlosen Frauen, und jedes Mal, wenn sie eine neue Festung betraten, verbarg Barla ihr glänzendes Haar unter einem zerlumpten Kopftuch und trug mehrere ihrer ärmlichsten Gewänder übereinander.
Dowell war ein geschickter Zimmermann und Tischler und hatte unter Lord Kale einen kleinen aber profitablen Pachtbetrieb in den Wäldern von Ruatha bewirtschaftet. Die Nachricht von dem Massaker, in dem eine gesamte Sippe ausgerottet worden war, erreichte die im Gebirge wohnende Familie erst lange nach dem Ereignis, als ein Kontingent von Fax' Soldateska in den Hof des Anwesens galoppierte und dem verblüfften Dowell erklärte, er unterstünde nun einem neuen Burgherrn. Widerstrebend, aber der Not gehorchend, neigte Dowell bei dieser Ankündigung das Haupt und bemühte sich, seinen Abscheu und sein Entsetzen zu verbergen; er hoffte, niemandem von der wilden Horde sei bekannt, dass seine Gemahlin Barla, die ihr erstes Kind erwartete, auch aus dem Geblüt von Ruatha stammte.
Falls Dowell angenommen hatte, seine stumme Duldsamkeit und die abgeschiedene Lage seines Anwesens würden ihn vor Fax' Schikanen schützen, so wurde er eines Besseren belehrt. Der Anführer der Meute hatte Augen im Kopf; zwar entging ihm, dass Barla dem Geschlecht von Ruatha angehörte, doch er merkte sofort, dass sie eine Frau war, für die sich Fax interessieren würde. Dowell fing den listigen Blick des Mannes auf, und er schmiedete Pläne für den Notfall; als erstes versteckte er den Reisewagen und zwei kräftige Zugtiere in einem schwer zugänglichen Tal unweit der Grenze nach Tillek. Nachdem ein halber Planetenumlauf vergangen war, ohne dass abermals Besucher auftauchten, glaubte Dowell schon, er habe übervorsichtig gehandelt und die Blicke des Anführers, mit denen er Barla musterte, falsch gedeutet.
Doch dann kam Lord Fax, zwanzig seiner Männer im Gefolge, über den schmalen Waldweg herangeprescht. Als er die hochschwangere Barla sah, setzte er eine Furcht einflößende Miene auf.
»Ich kann's kaum abwarten, mich an ihr gütlich zu tun. Na ja, sie wird bald werfen. Holt sie in zwei Monaten ab. Sie soll sich bereit halten, dem Ruf ihres Burgherrn zu folgen!«
Ohne sich ein einziges Mal umzublicken, riss Fax seinen Renner erbarmungslos herum, bearbeitete die schäumenden Flanken des Tieres mit seiner Peitsche aus Rohleder und hetzte auf demselben Weg zurück, den er gekommen war.
Keine Stunde war vergangen, da verließen Dowell und Barla ihren Hof. Sieben Tage später kam es zu einer Frühgeburt, und das Kind, ein Junge, starb. Und in Burg Tillek fanden Dowell und Barla nicht die erhoffte Zuflucht.
»Doch nicht so nahe bei Fax, Mann. Versucht es weiter im Westen«, schlug ihr erster Gastgeber vor. »Ich will nicht, dass er bei mir an die Tür klopft. Das hätte mir gerade noch gefehlt.«
Seitdem waren Dowell und Barla ständig unterwegs; sie bewegten sich auf die Westgrenze von Tillek zu. Gelegentlich blieben sie für eine kurze Weile an einem Ort, und Dowell schnitzte Schüsseln und Becher, schreinerte Möbel oder zimmerte Reisewagen. Ein paar Wochen hier, einen halben Planetenumlauf dort; während ihres Marsches durch das Gebirge von Fort wurde Aramina geboren, das erste von Barlas Kindern, das überlebte. Die Nachricht von Fax' Tod erreichte sie auf den riesigen Ebenen Keroons, kurz nachdem Nexa auf die Welt kam.
»Burg Ruatha brachte Fax nichts als Kummer und Probleme«, erzählte ein Harfner Dowell und Barla in Keroon, wo Dowell für einen Viehzüchter Ställe baute.
»Dann könnten wir ja zurückkehren und unser Anwesen wieder beziehen.«
»Falls es überhaupt noch steht. Aber es heißt, Lytol sei ein gerechter Burgherr, und er wird tüchtige Arbeiter brauchen«, meinte der Harfner und betrachtete die sauber eingekerbten Bohlen, die Dowell zusammensetzte.
»Wir gehen zurück«, hatte Dowell zu Barla gesagt, »sowie ich meinen Vertrag hier erfüllt habe.«
Mehr als einen Planetenumlauf später brachen sie zu ihrer langen Reise über die Halbinsel von Keroon auf, begleitet von einer stämmigen Tochter, einem kleinen Sohn und einem winzigen Baby.
Dann regneten Fäden auf das unschuldige grüne Land, brachten Tod und Zerstörung über ein Volk, welches die Existenz seines uralten Feindes geleugnet hatte. Wieder einmal füllten Drachen den Himmel mit ihrem feurigen Atem, verbrannten den gefürchteten Organismus in der Luft und bewahrten die üppigen Felder vor der Vernichtung durch die gefräßigen Sporen aus dem Weltall.
Für die Heimatlosen wurde das Reisen somit immer gefährlicher. Die Menschen suchten Sicherheit in steinernen Behausungen und hinter massiven Türen, vertrauten sich traditionsgemäß der Führerschaft ihrer Burgherren an. In diesen Zufluchtsstätten gab es wenig Raum für Leute, die sich nicht auf ein angestammtes Aufenthaltsrecht berufen konnten. Ein neuer Terror bedrohte die glücklosen Wanderer, die aus den unterschiedlichsten Gründen keiner Festung oder Zunft angehörten.
Dowell und Barla erging es ein wenig besser, weil Aramina die seltene Gabe besaß, die Stimmen der Drachen hören zu können. Als sie das erste Mal völlig arglos solche belauschten Gespräche wiedergab, erntete sie eine Tracht Prügel, weil man glaubte, sie erzähle Lügen. Doch eines Tages ließ sie sich nicht davon abbringen, die Drachen hätten einen kurz bevorstehenden Fädenfall angekündigt. Trotz der Drohung, sie würde wieder geschlagen und ohne Abendbrot zu Bett geschickt, blieb sie weinend bei ihrer Aussage. Erst als Dowell den Rand der Fädenwolke heranrücken sah, ein verschwommener, silbrig glänzender Fleck am Himmel, durchsetzt von den Flammenstößen der angreifenden Drachen, hatte er sich entschuldigt. Dankbar für die Warnung, verkroch sich die Familie unter einem Felsband, das gerade mal breit genug war, um sie zu schützen.
»Die Herren von Ruatha erwiesen den Drachenreitern seit jeher Gastfreundschaft«, erklärte Barla und drückte die weinende Nexa an sich. Sie verstummte kurz und wischte sich Dreckspritzer von den Lippen. »Keiner aus meiner nächsten Verwandtschaft wurde für eine Gegenüberstellung ausgewählt, aber zu meiner Zeit gab es auch nicht viele Gelege. Aramina hat ihr Talent geerbt.«
»Und ich war enttäuscht, weil unser erstgeborenes Kind ein Mädchen ist«, brummte Dowell und lächelte Aramina zu, die im hintersten Winkel der Felsnische kauerte. »Ich frage mich, ob Nexa eines Tages auch die Drachen hören kann.«
»Ich kann es bestimmt, wenn ich älter bin«, ließ Pell sich vernehmen, der sich von seinen Schwestern nicht ausstechen lassen wollte.
»Das heißt, dass wir auf unserem Weg nach Ruatha die Ebenen von Telgar sicher durchqueren können, denn Aramina wird uns vor jedem Fädenfall warnen. Wir brauchen bei keinem Burgherrn um Unterkunft zu bitten.«
Dowell bedeutete es viel, unabhängig und niemandem verpflichtet zu sein. Seit es wieder Fäden regnete, mussten die Heimatlosen mehr als die üblichen Demütigungen seitens der Burgherren einstecken, egal, ob diese nun eine unbedeutende oder große Festung regierten. Leuten, die keiner sozialen Gemeinschaft angehörten, brauchte man kein Obdach zu gewähren, und man durfte sie übervorteilen, wenn sie gezwungen waren, ihre wenigen Marken für Güter auszugeben. Notgedrungen mussten sie Schwerstarbeit leisten, nur um eine Bleibe zu haben, wo sie vor den Fäden sicher waren. Man trat ihre Ehre und ihre Würde mit Füßen, und selbst für die geringste und unbedeutendste Leistung, die ihnen ein Pächter oder Burgherr bot, verlangte man von ihnen Dankbarkeit.
Die gute Laune der kleinen Familie war nur von kurzer Dauer, denn durch den Fädenfall gerieten die Zugtiere in Panik und rannten davon. Zu Fuß musste Dowell zu dem Viehzüchter in Keroon zurückkehren, sich bei ihm zu einem Spottpreis für den nächsten Planetenumlauf als Arbeiter verdingen, und dann den ganzen Weg mit dem neuen Gespann zu seiner Frau und den Kindern marschieren, die schon sehnsüchtig auf ihn warteten, in ständiger Angst vor marodierenden Heimatlosen und einem neuerlichen Fädenfall.
Nachdem der Arbeitsvertrag ausgelaufen war, zog Dowell erneut mit seiner Familie gen Westen. Eine Fehlgeburt und eine fieberhafte Erkrankung zwang sie, in der riesigen Igen-Höhle zu kampieren; aus praktischen Erwägungen blieben sie dann dort, da eine Reihe von Fehlschlägen und eine Pechsträhne sie immer wieder daran hinderten, in ihre alte Heimat Ruatha zurückzukehren.
Nun jedoch stapften sie durch die Nacht, bestrebt, einem neuerlichen Angriff auf ihre Ehre und Integrität zu entrinnen.
Von irgendwoher hatte sich Dowell eine Karte von Lemos beschafft, komplett mit Wegen, Pfaden und Schneisen. In Lemos gab es so viel Wald und Gebirge, dass Perns andere Verkehrsrouten, die Flüsse, nicht zum Vorwärtskommen taugten. Dowell beschloss, dem schmalsten Pfad zu folgen und entfernte sorgfältig jeden Dunghaufen, den die Zugtiere hinterließen. Als er endlich eine Rast genehmigte, war es bereits Mittag. Während der kurzen Verschnaufpause, die er seiner Familie und dem Gespann gönnte, zerstampfte er Blätter und tupfte grüne Flecken auf die lederne Deckplane des Wagens, um ihn besser vor spähenden Blicken zu tarnen.
»In den Wäldern von Lemos sind wir sicher«, meinte er, um seine Familie und sich selbst zu beruhigen. »In den Bergen gibt es Höhlen, die keiner findet ...«
»Wenn keiner sie findet, wie sollen wir sie dann entdecken?«, wandte Pell vernünftigerweise ein.
»Weil wir nach ihnen Ausschau halten, deshalb«, erwiderte Aramina, ehe ihr abgekämpfter Vater aufbrausen konnte.
»Ach so!«
»Wir werden ganz für uns allein sein und uns von den Früchten des Waldes ernähren«, fuhr Aramina fort. »Holz für ein Feuer gibt es im Überfluss, wir wissen, an welchen Stellen Nüsse und Wurzeln wachsen, wir pflücken Beeren, braten Wherrys ...«
»Wir braten Wherrys?« Bei der Vorstellung solcher Köstlichkeiten fingen Pells Augen an zu glänzen.
»Du fängst sie mit deinen Schlingen, darin bist du doch unübertroffen ...«
»In Igen erbeutete ich mehr Tunnelschlangen als jeder andere«, warf Pell sich in die Brust. Dann fiel ihm ein, dass ihr überhasteter Aufbruch seiner Aufschneiderei zu verdanken war; er hielt sich den Mund zu und zog reumütig den Kopf ein.
»In diesen Höhlen hier müssten doch jede Menge Schlangen hausen, meinst du nicht auch, Mutter?«, fragte Aramina, um ihre traurig dreinblickende Mutter aufzuheitern und ihren Bruder von seinen Schuldgefühlen abzulenken.
»Doch, sicher«, erwiderte Barla in dem abwesenden Ton, den Eltern immer dann anschlagen, wenn sie ihren Kindern nur mit halbem Ohr zuhören.
Dowell mahnte zur Ruhe, und sie setzten ihren Weg fort, bis Nudge sich weigerte, noch einen Schritt weiterzugehen; als Dowell ihm mit dem Stock eins überzog, sank er störrisch auf die Knie. Sie lösten das streikende Biest aus dem Zuggeschirr und ließen Shove den Wagen in das Dickicht seitlich des Weges ziehen.
»Nudge ist schlau«, flüsterte Pell seiner Schwester zu, als die erschöpften Kinder Zweige sammelten, um das Gefährt damit zu bedecken.
»Vater ist aber auch nicht dumm. Ich hatte wirklich keine Lust, Thella zu helfen oder Giron, diesem Drachenreiter ohne Drachen.« Aramina schüttelte sich vor Abscheu.
»Die beiden sind genauso schlimm wie Fax.«
»Noch schlimmer, wenn du mich fragst.«
Als Barla sich endlich dazu aufraffte, die Essensrationen auszuteilen, waren Aramina und Pell bereits eingeschlafen.
Erst als vier Berge zwischen ihnen und dem Igen-Fluss lagen, erlaubte Dowell, dass sie ein gemächlicheres Tempo anschlugen. Auf den schmalen Pfaden, die eher Holzfäller-Schneisen glichen als regulären Wegen, konnten sie unbeobachtet den gewaltigen Gebirgszug von Lemos hinaufsteigen.
Sie waren nicht völlig allein, denn hoch über ihnen kreisten Drachen auf ihren täglichen Patrouillenflügen, und Aramina ergötzte sich an ihren Gesprächen. In witziger Weise erzählte sie ihrer Familie, was sie gehört hatte, um die Stimmung am abendlichen Lagerfeuer zu heben; Dowell war zu der Überzeugung gelangt, dass ein kleines Feuer, welches nicht qualmte, in den dichten Wäldern nicht entdeckt werden konnte.
»Heute kam wieder der grüne Path vorbei, zusammen mit Heth und Monarth«, sagte Aramina am zehnten Tag nach ihrem Exodus aus der Igen-Höhle. »Lamanth, die Königin, hat dreißig schöne Eier gelegt, aber Monarth behauptet, es seien keine Königinnen-Eier dabei.«
»Nicht jedes Gelege enthält Königinnen-Eier«, tröstete Dowell Aramina, die sehr unglücklich klang.
»Das meinte Path auch. Ich weiß nicht, warum Monarth sich so aufregte.«
»Ich wusste gar nicht, dass Drachen sich miteinander unterhalten«, erklärte Barla verwirrt. »Ich dachte, sie würden nur mit ihren Reitern sprechen.«
»Mit denen reden sie natürlich auch«, bekräftigte Aramina. »Heth plaudert unentwegt mit K'van, wenn sie allein einen Patrouillenflug absolvieren.«
»Warum waren sie dann heute zu dritt?«, wunderte sich Pell.
»Weil ein Fädenfall kurz bevorsteht.«
»Warum hast du das nicht gleich gesagt?«, schnauzte Dowell, der sich über die Nachlässigkeit seiner Tochter ärgerte.
»Ich stand im Begriff, es zu tun. Die Drachen glauben, dass morgen am späten Nachmittag Fäden über Lemos niedergehen werden.«
»Wie sollen wir einen Fädenschauer hier draußen in den Wäldern überleben?«, polterte Dowell frustriert los.
»Du sagtest doch, in dieser Gegend gäbe es massenhaft Höhlen«, erinnerte Pell ihn und verzog weinerlich das Gesicht.
»Wir müssen so schnell wie möglich eine finden«, verkündete Dowell grimmig. »Gleich morgen früh, beim ersten Tageslicht, fangen wir mit der Suche an. Aramina, du gehst mit Pell voraus auf die Anhöhe. Droben tritt der nackte Fels zutage, und dort muss es einen Unterschlupf geben.«
»Außerdem benötigen wir Proviant, sammelt alles Essbare, was ihr unterwegs findet«, fügte Barla hinzu und zeigte ihnen demonstrativ den leeren Kochtopf. »Von dem Dörrfleisch und dem Gemüse ist nichts mehr übrig.«
»Wieso regnet es immer dann Fäden, wenn man am wenigsten vorbereitet ist?«, jammerte Pell, ohne indessen eine Antwort zu erwarten.
Am nächsten Morgen hatte er Grund genug, seine Klagen zu wiederholen, denn eines der Hinterräder sackte in ein mit Laub bedecktes Loch, der Splint zerbrach und das Rad machte sich selbstständig. Das Gespann zog den Wagen noch ein Stück weiter und grub die Nabe ins Erdreich, ehe Dowell die Tiere zum Stehen brachte. Mit grimmiger Miene begutachtete er den Schaden. Dann stieß er einen abgrundtiefen Seufzer aus und schickte sich an, das Rad zu reparieren.
Es war beileibe nicht das erste Mal, dass ein Rad abging, und Aramina und Pell wussten, was zu tun war. Ohne dass jemand sie dazu aufforderte, suchten sie starke Äste und halfen, einen Stein an die richtige Stelle zu rücken, wo man einen Hebel ansetzen konnte. Alle arbeiteten Hand in Hand; sobald Dowell und Barla den Wagen hochgestemmt hatten, schoben Aramina und Pell zwei Keile darunter. Das Rad befand sich schon wieder an der Achse, als Dowell bemerkte, dass sie keine Splinte oder Zapfen mehr bei sich hatten. Die letzten hatte er während ihrer Reise zur Igen-Höhle benutzt, und seitdem keinen Anlass mehr gehabt, neue anzufertigen.
»Was willst du, Holz gibt es hier in Hülle und Fülle«, unterbrach Barla seinen Schwall an Selbstvorwürfen. »Da drüben steht ja schon ein Hartholzbaum. So lange kann es doch nicht dauern, neue Zapfen zu schnitzen. Die Kinder laufen derweil vor und suchen Nahrung und eine Höhle. Nun mach schon!« Sie reichte ihm die Axt. »Ich helfe dir. Aramina, schnapp dir einen Sack und einen Ledereimer. Pell, du nimmst eine Schlinge und stellst sie auf, sowie du eine Schlangenspur entdeckst. Nexa, du darfst die kleine Schaufel tragen, aber dass du sie ja nicht im Wald verlierst.«
»Aramina, wenn du wieder die Drachen hörst und es etwas Neues über den bevorstehenden Fädenfall gibt, macht ihr auf der Stelle kehrt und kommt zu uns zurück«, befahl Dowell, während er auf den Hartholzbaum zusteuerte. »Und nicht trödeln.«
In dem Bewusstsein, ein spannendes Abenteuer zu erleben, rannten die Kinder den Pfad hinauf. Viermal machte der Weg eine Biegung, ohne dass sich die Gegend änderte – ringsum nichts als Wald. Doch Pell bestand darauf, ein paar aus dem Boden ragende Felsblöcke zu inspizieren, die ihm vielversprechend erschienen.
Dann verlief die Schneise schnurgerade, um schließlich hinter einer Felsnase zu verschwinden. Zu ihrer Rechten stieg der Hang steil an, und die Bäume wuchsen spärlicher, je mehr der gewachsene Fels hervortrat.
»Ich geh mal da oben nachsehen, 'Mina!«, rief Pell und flitzte los, gerade als Nexa Araminas Augenmerk auf die welken aber nicht zu übersehenden Spitzen einiger Rotwurzeln lenkte, die weiter unten an der Böschung wuchsen.
Aramina sah, wie Pell an der steilen und glitschigen Bergflanke hochkletterte und entschloss sich, mit Nexa nach den Wurzeln zu graben. Schon nach kurzer Zeit hörten sie Pells trillernden Ruf, das Signal der Familie, dass jemand in Not war. Voller Angst, Pell könnte sich verletzt haben, hetzte Aramina zum Weg zurück.
»Ich habe eine Höhle gefunden, 'Mina! Ich habe eine Höhle gefunden.« Pell rutschte den Hang herunter. »Sie ist schön tief. Sogar Nudge und Shove passen hinein.« Seine Stimme bebte in dem Rhythmus, in dem er halb schlitternd, halb laufend, die restliche Strecke zurücklegte.
»Du hast den eingesammelten Proviant verloren!«, tadelte Aramina ihn und zeigte auf die abgebrochenen Zweige des Nussstrauchs, die er mit der linken Hand umklammerte.
»Ach, das macht nichts.« Pell warf die Äste weg, stand auf und klopfte sich das feuchte Laub von seiner ledernen Hose. »Da oben wächst noch viel mehr von dem Zeug ...« Er brach ab, die Hand erhoben, und blickte beklommen drein.
»Hmm, die Nähte sind wieder mal geplatzt«, fuhr Aramina ihn ungeduldig an. Sie packte ihn und drehte ihn herum, um sich den Schaden anzusehen, den die Rutschpartie verursacht hatte. Seufzend rang sie um Selbstbeherrschung. Pell achtete nie auf Gefahren oder Konsequenzen.
»Es ist doch nur die Naht. Dem Leder ist nichts passiert. Mutter kann sie flicken. In der Höhle, die ich gefunden habe. Sie ist riesengroß.« Er grinste breit, um seine Schwester aufzumuntern, und ruderte hektisch mit den Armen durch die Luft, bestrebt, die Bedeutung seiner Entdeckung zu unterstreichen.
»Wie weit oben liegt sie?« Skeptisch betrachtete Aramina den jäh abfallenden Hang. »Ich bin mir nicht sicher, ob Nudge und Shove da hinaufkommen.«
»Sie werden sich anstrengen, denn dort finden sie Gras und Wasser ...«
»Ist die Höhle etwa feucht?«
»Nee! Ich ging ein Stück weit hinein, und bis dahin war sie trocken.« Pell legte den Kopf schräg. »Aber ich lief nicht bis ans Ende, weil du mich davor gewarnt hast. Nur so tief, um zu sehen, dass sie für uns alle groß genug ist und trocken. Im Übrigen sah ich Spuren von Tunnelschlangen. Hmm, lecker!« Er verdrehte die Augen und schmatzte mit den Lippen bei der Aussicht auf das gute Essen. »Es gibt da sogar einen Bach – und einen Wasserfall.«
Aramina zögerte; prüfend musterte sie den steilen Hang und fragte sich, ob Pells Enthusiasmus vielleicht sein Urteilsvermögen trübte. Pell sah immer nur das, was er zu sehen wünschte. Doch jetzt kam es darauf an, schnellstmöglich einen Unterstand aufzusuchen. Pell mochte ja übertreiben, aber er hatte eine Höhle gefunden. Sollte ihr Vater entscheiden, ob sie geeignet war.
»Wo genau befindet sich die Höhle?«
»Man klettert bis auf den Grat hinauf« – Pell deutete in die Richtung – »und auf der anderen Seite steigt man ein Stück weit hinunter in eine Mulde, wo Nussbäume wachsen. An denen geht man vorbei, bis man an eine Birke gelangt, deren Stamm sich gabelt. Links davon liegt der Eingang. Er ist durch einen Felsüberhang geschützt. Komm mit, ich zeig's dir.«
»Nein, du bleibst hier stehen. Nexa gräbt da drunten nach Wurzeln« – Aramina blickte streng drein, als Pell eine Schnute zog –, »die wir genauso dringend benötigen wie eine Höhle.« Abermals zauderte sie. Vielleicht sollte sie doch lieber zuerst die Höhle besichtigen, um keine falschen Hoffnungen zu wecken.
»Komm schon, 'Mina, wenn es um einen Unterstand geht, würde ich keine Lügen erzählen.«
Aramina schaut ihrem Bruder forschend ins Gesicht; seine Züge drückten absolute Vertrauenswürdigkeit aus. Nein, wenn es um etwas so Wichtiges ging, würde Pell niemals flunkern. Ein Sonnenstrahl brach durch die Wolken, beleuchtete die im Wind ächzenden Baumkronen und erinnerte sie daran, dass ihnen nicht mehr viel Zeit blieb, um sich in einen Unterschlupf zu flüchten.
»Dass du mir ja nicht wegläufst! Du weißt, wie leicht Nexa sich ängstigt.« Aramina band den Sack mit den erbeuteten Wurzeln zu und stellte ihn an den Wegrand.
»Ich weiche nicht von ihrer Seite. Aber vielleicht sollte ich schon mal Feuerholz sammeln.« Um nicht nach Wurzeln graben zu müssen, eine Arbeit, die ihm verhasst war, trug Pell fleißig Zweige zusammen.
Im Laufschritt trottete Aramina den Pfad zurück, wobei ihre langen Zöpfe gegen ihre Schultern und Hüften pendelten. Sie war leichtfüßig und bewegte sich mit einem so geringen Kraftaufwand, dass ein berufsmäßiger Eilläufer sie beneidet hätte.
Das Sonnenlicht schien ihr zu folgen und erhellte den überwucherten Weg. Auf dem weichen, federnden Untergrund bereitete das Laufen Vergnügen. Sie machte kürzere Schritte, als die Schneise sich in Schlangenlinien krümmte und horchte angestrengt auf Geräusche, die von ihrem Reisewagen kamen. Ihr Vater hatte die erforderlichen Zapfen sicher im Handumdrehen geschnitzt. Mittlerweile mussten Dowell und Barla ihnen schon ein gutes Stück entgegengekommen sein. Eigentlich hätte sie längst das Rumpeln des Wagens und die Rufe ihres Vaters, mit denen er Nudge und Shove antrieb, hören müssen.
Durch die dicht an dicht stehenden Bäume spähend, hielt Aramina Ausschau nach ihrem Gefährt. Die innere Anspannung verlieh ihr Flügel, und sie hetzte den Pfad entlang, sämtliche Sinne geschärft, um irgendein beruhigendes Zeichen von ihren Eltern aufzuschnappen. Sie legte noch Tempo zu. In ihr wuchs die Gewissheit, dass etwas passiert sein musste. Ob Lady Thella Ohneland sie eingeholt hatte?
Eine Abkürzung wählend, schnitt sie die nächste Wegbiegung ab und pflügte durch das Unterholz. Als sie endlich das grün gefleckte Schutzdach des Wagens gewahrte, bewegte sie sich mit äußerster Vorsicht. Der Wagen hatte sich nicht von der Stelle gerührt, an der er vor zwei Stunden stecken geblieben war.
Vor Furcht bebend hielt Aramina inne und lauschte nach Stimmen, Girons grollendem Bass oder Thellas scharfem, durchdringendem Organ. Als sie nichts hörte außer dem Seufzen des Windes, der durch die Baumwipfel strich, pirschte sie sich behutsam die Böschung hinunter, bis sie sich oberhalb des immer noch verkanteten Wagens befand. Einen Schreckensschrei unterdrückend, rutschte Aramina den Hang hinab; zu ihrem Entsetzen sah sie, dass der Kopf und die Schultern ihres Vaters unter dem Wagen hervorragten. Aus irgendeinem Grund waren die Keile verrutscht, und das Rad lag wieder auf der Seite. Im ersten Moment war sich Aramina sicher, ihr Vater sei zu Tode gequetscht worden, doch dann erkannte sie, dass ein Keil unter dem Wagenkasten gelandet war und verhinderte, dass das volle Gewicht des Gefährts auf den Brustkorb drückte.
Erst dann vernahm Aramina das heisere Ächzen und erstickte Schluchzen ihrer Mutter, die versuchte, den schweren Wagen mit einem Hebel hochzuwuchten.
»Mutter!«
»Ich schaff es nicht, ich kann den Wagen nicht hochheben, 'Mina!« Barla weinte und lehnte sich erschöpft gegen den dicken Ast. »Ich versuche es schon die ganze Zeit, aber ich bin zu schwach.«
Ohne Worte zu verlieren stemmte sich Aramina mit aller Kraft gegen den Hebel, und obwohl Barla ihre letzten Kräfte mobilisierte, gelang es den beiden Frauen nicht, den Wagen höher als einen Finger breit anzuheben.
»Ach, 'Mina, was sollen wir nur tun? Selbst wenn Pell und Nexa hier wären, könnten sie uns nicht helfen ...« Verzweifelt sank Barla zu Boden und ließ ihren Tränen freien Lauf.
»Wir beide konnten den Wagen ein Stückchen anheben. Pell und Nexa könnten Vater darunter hervorziehen ...« Aramina wandte sich an ihren Vater, dessen gebräuntes Gesicht vor Schock fahl war; der Puls an seinem Hals schlug langsam aber kräftig. »Pell hat eine Höhle gefunden. Sie liegt nicht besonders weit entfernt. Ich bin gleich wieder da.«
Ehe Barla einen Einwand erheben konnte, sauste Aramina so schnell sie konnte den Pfad zurück. Pell und Nexa mussten einfach stark genug sein. Sie gestattete sich keine Zweifel. Und sie mussten sich sputen. Die Sonne, die ihr in die Augen schien, warnte sie, dass die Zeit drängte, wenn sie Dowell retten und den Wagen zur Höhle bringen wollten. Sie konzentrierte sich so auf die dringlichsten Probleme, dass sie um ein Haar den Drachen nicht gesehen hätte, der über ihrem Kopf dahinglitt. Um ein Haar wäre sie gestürzt, so abrupt hielt sie in ihrem Lauf inne.
Drache, Drache, hörst du mich? Hilf mir! HILF MIR! Noch nie zuvor hatte Aramina versucht, mit einem Drachen zu sprechen, doch ein Drachenreiter wäre kräftig genug, um ihnen zu helfen. Ein Drachenreiter würde sie gewiss nicht in ihrer Not im Stich lassen.
Wer ruft da einen Drachen?
Sie erkannte Heths Stimme.
Ich bin's, Aramina. Hier unten auf dem Waldweg, oberhalb des Flusses. Mein Vater liegt eingeklemmt unter unserem Wagen. Und bald werden die Fäden fallen! Mitten auf dem Pfad sprang sie hin und her, wild mit den Armen winkend. Bitte, helft uns!
Du brauchst nicht so laut zu schreien. Ich habe dich bereits beim ersten Mal gehört. Mein Reiter möchte wissen, wer du bist.
Zu ihrer Erleichterung sah Aramina, wie der Drache die Richtung änderte und in geringer Höhe über dem Weg kreiste.
Ich sagte doch schon, ich heiße Aramina.
Darf ich ihm deinen Namen verraten?
Mit solcher Höflichkeit begegnete man Aramina nur selten.
Ja, ja, natürlich. Bist du nicht Heth?
Richtig, ich bin Heth. Und mein Reiter nennt sich K'van.
Es ist mir eine Ehre.
Wir würden das Kompliment erwidern, wenn wir dich sehen könnten.
Aber ich befinde mich direkt unter euch. Auf der schmalen Schneise, die durch den Wald führt. Der Wagen ist ziemlich groß ... O je, mein Vater hat das Schutzdach grün gefärbt. Wenn du noch ein bisschen niedriger fliegen könntest ...
Ich bin ein Drache und kein Wherry ... K'van hat den Wagen entdeckt.
Aramina brach durch das Unterholz und erreichte den Wagen gleichzeitig mit dem Drachen und seinem Reiter. Barla sah aus, als würde sie vor Schreck über deren unverhofftes Auftauchen im nächsten Moment in Ohnmacht fallen.
»Schon gut, Mutter. Sie werden uns helfen. Sie sind viel kräftiger als Pell und Nexa.« Dann merkte Aramina, dass Shove und Nudge sich vor dem Drachen fürchteten. Sie band die Zugtiere straff an ihren Nasenringen fest, damit die Schmerzen sie ablenkten und ihr kleines Hirn mit etwas anderem beschäftigt war.
Zum Glück landete der Drache hinter dem Wagen, wo Shove und Nudge ihn nicht in ihrem Blickfeld hatten.
Ernüchtert stellte Aramina fest, dass sowohl der Drache als auch sein Reiter noch sehr jung waren. Sie hatte immer geglaubt, Bronzedrachen seien groß, und Heths Silhouette am Himmel hatte in der Tat gigantisch gewirkt. Nun jedoch merkte sie, dass der Drache noch nicht voll ausgewachsen war, und sein Reiter, K'van, war nicht nur jünger, sondern auch kleiner als sie selbst.
K'van schien ihre Enttäuschung zu spüren, denn er drückte die Schultern durch und reckte das Kinn vor. Resolut trat er an den havarierten Wagen heran, warf einen Blick auf den Hebel, der an einem Stein lehnte, und schaute dann auf Dowell hinunter.
»Wir mögen zwar Weyrlinge sein, aber wir können euch helfen«, erklärte K'van schlicht. Er wandte sich an Heth. »Ich möchte, dass du mit deinen Vordertatzen auf den Hebel drückst, Heth. Komm, Aramina, fass mal mit an.«
Aramina hörte auf, den Bronzedrachen anzugaffen, der vorwärts watschelte und mit seinen fünffingrigen Klauen den Hebel packte.
»Du drückst erst zu, wenn ich es dir sage, Heth«, ermahnte K'van seinen Drachen. Er grinste Aramina kurz zu, dann knieten sich die beiden neben den bewusstlosen Dowell und schoben ihre Hände unter seine Achseln. »Jetzt, Heth! Runter mit dem Hebel!«
So schnell es ging zerrten Aramina und K'van Dowell unter dem Wagen hervor. Barla schrie erleichtert auf, eilte zu ihrem Mann und öffnete sein Hemd, um das Ausmaß der Verletzungen zu prüfen. K'van besaß die Geistesgegenwart, den umgekippten Keil wieder an Ort und Stelle zu rücken und den Wagen aufzubocken.
»Jetzt müssen wir das Rad anmontieren«, sagte er zu Aramina. »Gut gemacht, Heth.«
Ich bin sehr stark, entgegnete der Drache selbstgefällig; in seinen großen Facettenaugen wirbelten blaugrüne Lichter, derweil er immer noch den Hebel herunterdrückte.
»Das stimmt, und obendrein bist du wunderschön«, rief Aramina.
»In Ordnung, Heth, jetzt lass den Wagen langsam wieder herunter«, befahl K'van und hielt den Keil fest. »Ganz vorsichtig.«
Der Wagen sank nach unten und gab knarrende Geräusche von sich, als er auf dem Keil zu liegen kam. K'van klaubte im Gras herum und hielt triumphierend die Splinte hoch.
»Mutter?« In Araminas zitternder Stimme schwang eine Frage mit, als sie sich umdrehte und auf ihren Vater blickte.