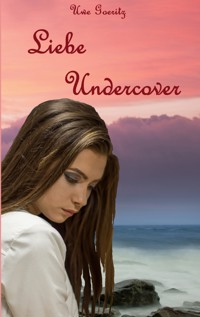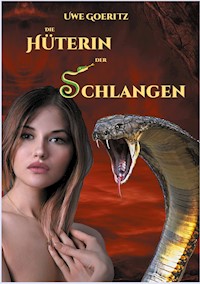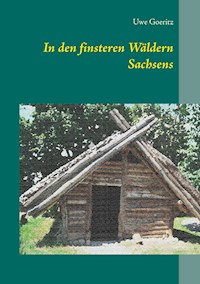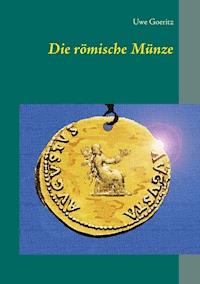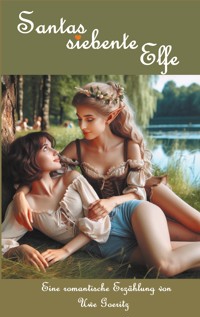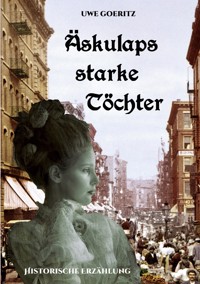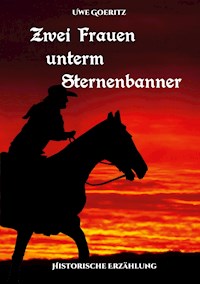2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der schwarze Tod" Altersempfehlung: ab 16 Jahre Als im Jahre 1346 die Pest über Europa hereinbrach, da wusste noch niemand, dass der "schwarze Tod" binnen weniger Jahre mehr als ein Drittel der Bevölkerung Europas hinwegraffen würde. Die Angst vor der unbekannten Seuche führt zu Hysterie und zu Pogromen an Andersgläubigen. Der Tod zog durch die Straßen der Städte und nach dem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung spielten sich apokalyptische Szenarien in Mitteleuropa ab. Dies ist die Geschichte von drei junge Frauen, die im Jahre 1349 in Mainz aufeinandertreffen, und die unterschiedlicher nicht sein könnten. Gundel, die Magd aus dem Dorfe, Lorena, die Hübschlerin aus der Stadt und Sarah, die junge Jüdin, schließen eine ungewöhnliche Freundschaft. Doch wird dieser Bund den Wirren der Zeit standhalten können? Die drei Frauen erleben in der Stadt ein Zeitalter der Gewalt, der Not sowie des Schreckens und kämpfen täglich um ihr Überleben. Können sie dieser tückischen Krankheit entgehen oder fallen sie der Hysterie ihrer Mitmenschen zum Opfer? Die weiteren Bücher in dieser Reihe, erschienen im Verlag BoD, finden Sie unter www.buch.goeritz-netz.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der schwarze Tod – Mainz, im Jahre 1349
Stille
Der bunte Wagen
Ein verlorener Schleier
Neue Wege
Ferne Weiten
Stadtluft
Neue Hilfe
Dunkle Wolken
Mägdeleben
Der Stolz der Kaufleute
Ein tödlicher Schwarm
Gute Freunde
Derselbe Gott
Unhaltbare Anschuldigungen
Verbündete
Fieber
Drei Freundinnen
Der Reiz der Frauen
Neue Ängste
Ein Prozess
Gerechte Strafe?
Das Leiden einer Freundin
Ein Opfer für die Gemeinschaft
Gewalt und Schmerz
Augen wie das Meer
Eine verfängliche Geste
Schreckensbotschaften
Glück oder Unglück
Entscheidung aus Liebe
Die Gestalt eines Engels
Modefragen
Verfluchte Menschen
Zwischen Leben und Tod
Ein gefährlicher Freundschaftsdienst
Gefesselt und geknebelt
Verzweifelte Suche
Dunkle Stunden
Ein Geschöpf der Nacht
Ein Mann des Glaubens
Tod und Elend
Spätes Glück
Eine missglückte Intrige?
Angst
Das Übel der Welt
Dem Tode so nah
Am Ende?
Ehrbare Frauen?
Vergebung und Verzeihung
Gekaufte Zeugen
Der Herr des Hauses
Der perfekte Plan
Ein leises Gebet
Gefunden und verloren
Am Pfahl der Schande
Im Feuersturm
Seelische Schmerzen
Gottes Rache und der Menschen Schuld
Die silberne Spange
Im letzten Augenblick
Tod auf Tod
Tiefe Wunden
Bittere Ernte
Saat der Gewalt
Gehen oder Bleiben
Wiedersehensfreude
Fremde Gebräuche und eine Lüge
Neue Zeiten
Noch ein bunter Wagen
Abschied von Freunden
Vertraute Nähe, unbekannte Weite
Eine besondere Gabe
Ende und Neubeginn
Zeitliche Einordnung der Handlung:
Der schwarze Tod – Mainz, im Jahre 1349
A ls im Jahre 1346 die Pest über Europa hereinbrach, da wusste noch niemand, dass der „schwarze Tod“ binnen weniger Jahre mehr als ein Drittel der Bevölkerung Europas hinwegraffen würde. Die Angst vor der unbekannten Seuche führt zu Hysterie und zu Pogromen an Andersgläubigen. Der Tod zog durch die Straßen der Städte und nach dem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung spielten sich apokalyptische Szenarien in Mitteleuropa ab.
Dies ist die Geschichte von drei junge Frauen, die im Jahre 1349 in Mainz aufeinandertreffen, und die unterschiedlicher nicht sein könnten. Gundel, die Magd aus dem Dorfe, Lorena, die Hübschlerin aus der Stadt und Sarah, die junge Jüdin, schließen eine ungewöhnliche Freundschaft. Doch wird dieser Bund den Wirren der Zeit standhalten können?
Die drei Frauen erleben in der Stadt ein Zeitalter der Gewalt, der Not sowie des Schreckens und kämpfen täglich um ihr Überleben. Können sie dieser tückischen Krankheit entgehen oder fallen sie der Hysterie ihrer Mitmenschen zum Opfer?
Die handelnden Figuren sind zu großen Teilen frei erfunden, aber die historischen Bezüge sind durch archäologische Ausgrabungen, Dokumente, Sagen und Überlieferungen belegt.
1. Kapitel
Stille
G undel schlug die Augen auf. Sie lag im Halbdunkel der Hütte. Die Tür stand offen und die Sonne fiel in den Raum. In deren Strahlen bewegten sich über der jungen Frau ein paar Staubkörner in der Luft. Sie bildeten einen bizarren Tanz. Das eigentlich seltsame war aber die Stille in der Hütte. Es war heller Tag und kein Laut traf an ihr Ohr. Sonst war von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang der Lärm der Menschen und Tiere hier drin zu hören gewesen. Zehn Menschen, vier Schweine und zwei Kühe waren nun mal nicht leise. Umso mehr störte sie daher diese Stille! Wie um dies noch zu unterstreichen, begann ein Vogel vor der Hütte zu singen. Sein Lied schallte durch ihren Kopf.
Die Frau war zu schwach, um sich zu erheben. Im Moment konnte sie noch nicht mal den Kopf bewegen. Starr war ihr Blick zur Hüttendecke gerichtet. Dort sah sie die Balken der Dachkonstruktion und die Schilfbündel. Ausgestreckt lag sie auf ihrem Lager und konnte nichts weiter machen, außer nachzudenken. Sie war gerade erst sechzehn Jahre alt geworden und das letzte, woran sie sich erinnern konnte, war, dass sie Fieber bekommen hatte und die Mutter sie hier auf diesen Strohsack gelegt hatte. „Mutter!“, flüsterte sie in die Ruhe hinein. Es hatte eine unendliche Kraftanstrengung gekostet, doch niemand antwortete. Wo waren alle hin? Hatte man sie hier alleine zurückgelassen? Ein Schreck zuckte durch ihren Körper und dieser gab ihr die Kraft, sich aufzusetzen.
Ihre Haare fielen nach vorn und verdeckten kurz ihr Gesicht, dann schob sie diese zur Seite und sah sich um. Das erste, was sie sehen konnte, war, das ein Schwein Mitten im Raum lag. Es war noch angebunden und lag einfach so dort herum, ohne sich zu bewegen. Offensichtlich war es tot, denn Schweine bewegten sich eigentlich immer. Gundel erschrak noch mehr. Wer hatte das wertvolle Tier getötet? Dann erkannte sie weitere Gestalten, die in der Hütte lagen. Keiner rührte sich. Mühsam setzte sie die Füße auf den Boden und stand schwankend auf.
Sie begann in der Hütte herumzutorkeln. Von einer Gestalt zur nächsten, sie rüttelte an ihnen, doch alle waren Tod. Auf dem Tisch stand ein Krug Bier und Gundel verspürte großen Durst beim Anblick des Getränkes. Sie trank das Bier so schnell, dass es ihr aus den Mundwinkeln herauslief. Nun fühlte sie sich stärker und suchte etwas zu essen. Weit über ihr hing noch ein Stück Schweinefleisch im Rauchabzug.
Wie sollte sie da heran kommen? Und durfte sie das überhaupt? Nur der Bauer hatte das Recht, über das Fleisch zu bestimmen, doch der lag tot neben der Tür. Seine starren Augen waren auf diesen letzten Schinken gerichtet, so als wolle er ihn immer noch im Tode beschützen. Gundel zog den Tisch zur Seite und kletterte über die Bank hinauf. Mit den Fingerspitzen konnte sie die ersehnte Nahrung erwischen und schob das Fleischstück hoch.
Mit einem polternden Geräusch schlug das Stück geräuchertes Fleisch auf dem Tisch auf. Gundel blieb einen Moment so stehen. Wer bis jetzt noch nicht gewusst hatte, dass sie wach war, der musste es nun, nach dem Diebstahl des Schinkens, Wissen. Doch nichts rührte sich. Alles blieb ruhig.
Beschwerlich stieg sie vom Tisch und zog das Messer aus dem Gürtel des Bauern. Damit schnitt sie sich eine Scheibe von dem Schinken ab und biss gierig hinein. Das Fleisch war fest und gut. Gundel schnitt das Fleisch vor ihrem Mund ab. Die Kraft zum Kauen war noch nicht zurück. Nur zum Schlucken reichte es, aber mit jedem Stück Schinken, dass sie mit Bier aus dem Krug herunterspülte, wurde sie kräftiger.
Endlich war sie satt und konnte sich weiter umblicken. Die Mutter war nirgendwo zu sehen. Der Stall war leer, nur das eine Schwein lag am Boden. Wieder rief das Mädchen „Mutter!“ Nun schon viel lauter, aber auch darauf erhielt sie keine Antwort. Sie trat durch die Hüttentür und wäre davor fast mit einer Kuh zusammen geprallt, die den Weg entlang zum Kornfeld lief. Es war die Kuh des Nachbarn und ihr Feld. Zumindest das ihres Bauern, bei dem Gundels Mutter als Magd arbeitete. Gundel folgte der Kuh ein Stück des Pfades und fand nach wenigen Schritten ihre Mutter.
Die Frau lehnte an der Hüttenwand und Gundel beugte sich zu ihr hinab. Die Mutter hatte die Augen geschlossen und die junge Frau berührte sie zögerlich an der Schulter. „Ist auch meine Mutter gestorben?“, fragte sie sich in Gedanken, doch da öffnete die Frau die Augen und Gundel fiel ihr um den Hals.
„Trinken!“, sagte die Mutter schwach und die Tochter spürte die Hitze der älteren Frau durch deren Kleidung hindurch. Sie hatte Fieber und schwarze Flecken am Hals. „Ich hole etwas!“, sagte Gundel und lief zurück in die Hütte. Der Bierkrug war aber leer. Vielleicht konnte der Nachbar helfen? So schnell sie konnte, rannte sie die fünfzig Schritte bis zu dessen Hütte. „Hallo?“, rief sie in das Dunkel, erhielt aber keine Antwort.
Zögernd stand sie vor dem Haus. Sollte sie einfach so hineingehen? Der alte Bauer war ziemlich jähzornig, aber sie konnte ihm ja sagen, wo seine Kuh war, das würde ihn vielleicht besänftigen. Langsam ging sie in die Hütte hinein. Immer wieder verhielt sie ihre Schritte. Die Angst vor dem alten Mann steckte tief in ihr drin. Manchmal hatte der alte Bauer sie schon draußen vor der Hütte auf dem Pfad mit einem Stock geschlagen, weil sie ihm nicht schnell genug aus dem Weg gegangen war.
Noch einen Schritt, dann stand sie in der Mitte des Raumes. „Hallo?“, rief sie erneut und der Raum verstärkte ihren Ruf. Gundel zuckte zusammen. Es war dunkel in dem Raum und nur langsam gewöhnten sich ihre Augen an das Dämmerlicht. Jederzeit zum Sprung bereit und geduckt stand sie dort hinter der Tür. Auch hier schien niemand mehr am Leben zu sein.
Langsam und vorsichtig schob sie sich zur Vorratskammer hinüber. Im Dunkel tastete sie sich voran und stürzte über einen Körper. Erschrocken sprang sie wieder auf. Der Körper war schon steif wie ein Brett! Sie eilte die letzten Schritte bis zu dem Gestell, das auch in dieser Hütte an derselben Stelle war, wie in ihrer. Warum war sie eigentlich nicht dorthin gegangen?
Gundels Finger tasteten nach einem Krug. Dann fand sie einen und hob ihn an. Er war schwer, aber war Bier darin? Sie steckte einen Finger hinein und leckte diesen danach ab. „Igitt. Essig!“, rief sie und spukte aus. Die junge Frau stellte den Krug zur Seite, tastete sich zum nächsten Behälter und hatte Glück. In diesem befand sich das ersehnte Bier.
Mit dem tönernen Gefäß ging sie zum Licht der Tür zurück. Schnell lief sie zu ihrer Mutter zurück und reichte ihr das Getränk. Gierig trank die am Boden liegende Frau. „Was ist passiert?“, fragte Gundel nun, nachdem sie sich neben die Mutter gesetzt hatte. „Erinnerst du dich an die Händler, die von fern gekommen waren?“, fragte die ältere Frau leise. „Ja“, antwortete Gundel und dachte an den bunten Wagen mit den Waren aus fernen Ländern. Alle Kinder waren dort gewesen. „Als sie wieder fortgefahren waren, da bist du krank geworden. Nach dir die anderen. Alle! Dann begann das Sterben!“, erklärte die Mutter mit schwacher Stimme.
Langsam senkte sich die Dämmerung über das Dorf. Die Vögel sangen das letzte Lied des Tages. Die Mutter rutschte röchelnd neben Gundel zusammen. Das Mädchen zog den Kopf der Frau auf ihren Schoß. Das Röcheln wurde immer leiser und mit dem letzten Licht des Tages verstummte die Frau. Die Vögel verstummten ebenfalls.
„Mutter! Nicht! Nein!“, schrie Gundel in die Stille hinein, dann warf sie sich schluchzend über den toten Körper der Mutter auf ihrem Schoß. Ihr Weinen durchbrach die Ruhe des Todes.
2. Kapitel
Der bunte Wagen
B althasar ging die Gasse hinunter zum Marktplatz. Er war gerade 24 geworden und der Sohn eines der Ratsmitglieder der Stadt Mainz. Der Vater, ein reicher Tuchhändler, hatte in letzter Zeit immer wieder Andeutungen gemacht, dass er den Sohn verheiraten wollte. Bisher noch eher spaßig und auch die Drohung mit der Enterbung war ebenfalls lachend über seine Lippen gekommen, aber es würde wohl nicht mehr lange dauern, bis der Vater seinen Willen durchdrücken und ihn vermählen würde. Es war der Frühsommer des Jahres 1349 und alles blühte und grünte.
Der junge Mann sah zum Himmel hinauf. Ein paar dunkle Wolken zogen über ihm dahin, aber es hatte nur im Frühling geregnet. In diesem Jahr würde das Wetter hoffentlich besser sein, als in den letzten Jahren und eine gute Ernte bringen. Oft hatte der Regen das Korn kurz vor der Ernte doch noch vernichtete. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen jedes Jahr weiter. Doch er war gut versorgt, solange der Vater ihn nicht wirklich enterbte.
Noch nie in seinem Leben hatte er Hunger und Not verspürt. Da ging es ihm besser, als es so viele andere Menschen täglich erleiden mussten. Doch sein Mitgefühl für die Ärmsten hielt sich in Grenzen. Sein Blick ging nur oberflächlich über die zahlreichen Bettler, die vor der Kirche saßen und ihm ihre Schüsseln entgegen reckten.
Der junge Mann ignorierte die Hungernden, blieb an einem Rosenstrauch stehen und brach eine der Blüten ab. Er saugte den Duft der Blüte ein und steckte sie sich an den Kragen seiner Jacke. So ließ es sich leben! Pfeifend betrat er den Marktplatz und sah zum Rathaus hinüber. Immer noch dachte er an die Nachrichten vom letzten Jahr zurück. Dort drüben hatten die Stadtschreier immer ihre Neuigkeiten verbreitet. Der schwarze Tod hatte in den Häfen am Mittelmeer sowie in Südeuropa gewütet und war erst im Herbst zum Stillstand gekommen. Weit vor den Alpen, doch die Handelsrouten nach Italien waren trotzdem daraufhin zum Erliegen gekommen, weil niemand mehr in diese Gegend fahren wollte.
Der Tuchnachschub aus Genua und Venedig war fast vollständig versiegt. Und da die Reichen und Schönen der gehobenen Gesellschaft nicht auf das kostbare Tuch verzichten wollten, hatte ihnen dies einen beträchtlichen Gewinn gebracht, da das Lager bis zum letzten Stofffetzen leergekauft worden war. Nun war es Zeit, dass die Bestände mit frischer Ware aufgefüllt werden konnten. In den nächsten Tagen mussten die Wagen eintreffen und sicher würden die Fuhrleute auch Nachrichten aus dem Süden bringen.
Zu gern wäre er wieder mit nach Venedig gezogen, doch der Vater hatte ihn aus Angst nicht mitgelassen. Er war der einzige Sohn und zu schrecklich waren die Beschreibungen über die Zustände im letzten Jahr gewesen. Tausende waren gestorben und die Seuche war nur durch die Gebirgspässe aufgehalten worden. Doch das war nun weit weg. Der junge Mann wollte feiern und da kam ihm die geöffnete Schänke am Markt ganz recht.
Seine Freunde waren sicher auch schon dort und wenn nicht, so konnte er unter den Anwesenden sicher schnell neue Freunde finden. So früh am Tage war aber noch nicht viel los. Er gönnte sich ein starkes Bier. Damit wollte er sich irgendwie von seinem Vater abgrenzen, der nur Wein trank. Bier wäre dem alten Kaufmann sicher nicht mehr über die Lippen gekommen.
Nach dem zweiten Bier warf er eine Münze auf den Tisch und brach wieder auf. Vielleicht würde er später wieder zurückkommen. Langsam ging er durch die Gassen zu seinem Elternhaus, dabei grübelte er, was er an diesem Tage noch unternehmen konnte? Als er in die Straße einbog, sah er eine Gruppe von Menschen vor dem Haus stehen.
Im näher kommen erkannte er, dass sie einen nicht bespannten Wagen verdeckt hatten. Die Plane war abgenommen. Das konnten nur die lang erwarteten Händler sein, die sicher auch wieder neue Nachrichten aus dem Süden hatten. Schnell ging er zu der Gruppe hinüber. Vielleicht konnte er von ihnen etwas Neues aufschnappen. Manche Nachricht war bare Münze wert. Die Gruppe lichtete sich und Balthasar konnte das Fahrzeug erkennen.
Der Wagen stand direkt vor dem Tor zum Haus des Vaters. Einige Diener trugen schon Stoffballen durch das Tor. Einer der Fuhrleute versorgte abseits die beiden Pferde und Balthasar trat zu ihm. Sie kannten sich beide gut, vor Jahren war der junge Mann mit dem älteren nach Venedig gefahren. Freudig begrüßte er ihn mit einem Handschlag. „Mathias, wie geht es dir?“, frage Balthasar.
Die Augen des älteren Mannes glänzten, als er den Jüngeren begrüßte. „Das Leben geht seinen Weg. Es normalisiert sich auch wieder in Venedig, nach diesen grausamen Zeiten des letzten Jahres. Im Winter gab es keine Toten mehr.“ Er hustete und sah zur Seite, wo der bunt bemalte Wagen langsam entladen wurde. „Wenn das stimmt, dann kann ich euch ja vielleicht auf der nächsten Fahrt begleiten!“, rief Balthasar erfreut und Mathias zeigte auf den Kutschbock.
„Immer wieder gern. Mit dir macht es mehr Spaß als mit Kuntz, diesem Langweiler!“, sagte der Fuhrmann lachend. Balthasar sah zum Wagen und erkannte den Gehilfen von Mathias, der sich trotz der Wärme, eine Decke umgehängt hatte.
Balthasar klopfte dem Pferd auf den Hals und erwiderte „Ist der immer noch so? Dann lade ich dich heute Abend in die Schänke ein.“ Der ältere Mann nickte dankbar. Sie vertieften sich in ein Gespräch über Venedig und ihre Zeit in der Lagunenstadt und so konnten sie nicht sehen, dass ein paar Ratten aus einer Kiste auf dem Wagen sprangen. Erst das Geschrei von einem der Diener machte sie aufmerksam.
Sie lachten beide über den Mann, der vergeblich versuchte, die Ratten mit einem Stock zu schlagen. Die beiden grauen Tiere waren einfach viel zu schnell für den Mann. Mit ein paar schnellen Sätzen verschwanden die Tiere im Dunkel einer Seitengasse. „Dann bis heute Abend!“, sagte Mathias und Balthasar nickte ihm zu.
Der Wind des Abends brachte frische Luft vom Fluss herüber und vertrieb die Wolken. Mathias führte die Pferde in den Stall und die Diener schoben den Wagen in den Innenhof des Hauses. Bald würde er wieder beladen werden und sich auf den Rückweg machen und Balthasar beeilte sich, in das Haus zu gehen, um den Vater um seine Erlaubnis zu bitten, dass er diese Fahrt begleiten durfte.
Er stürmte die Treppe hinauf und warf einem der Diener seine Kappe zu, dann betrat er das Kontor des Vaters, der über die Bücher gebeugt war und vermutlich gerade den Wareneingang vermerkte. Zufrieden nickte der alte Mann und sah Balthasar fragend an. Sicher hatte er gemerkt, wie er in das Zimmer gelaufen war.
„Werter Herr Vater. Kann ich den Wagen nach Venedig begleiten? Ich könnte für euch ein paar gute Abschlüsse dort tätigen“, fragte er schnell und sah die Falten auf der Stirn des Vaters, darum setzte er sofort hinzu, „Mathias hat mir berichtet, dass die Seuche zu Ende ist. Dort ist alles unter Kontrolle.“ „Ja. Wenn dem wirklich so ist!“, sagte der alte Mann und klappte das Kontorbuch zu.
Balthasar war mit dieser Aussage erst einmal zufrieden, verbeugte sich und eilte hinaus. Er hatte ja Mathias versprochen, mit ihm zur Schänke zu gehen. „Hut und Schwert!“, rief er und ein Diener brachte ihm seine Sachen. Unten im Hofdurchgang wartete er auf dem Fuhrmann und klopfte ihm auf die Schulter, als der endlich erschien.
3. Kapitel
Ein verlorener Schleier
D er Vater strich die Münzen ein, legte sie in das Säckchen, das er sorgsam mit der Kordel zuzog, und hängte es sich an den Gürtel. Er fuhr sich mit der Hand über den Bart und nickte. „Das war wieder ein gutes Geschäft“, sagte er und gab dem Kaufmann die Hand. Das Mädchen blickte zu ihm hinüber. Sie trug die typische Kleidung ihres Volkes. Der blau gestreifte Schleier fiel über ihr kunstvoll geflochtenes Haar weit in ihren Rücken. Sie mochte es zwar, in ihrem Viertel zu sein, da waren sie unter sich und unter dem Schutz des Kaisers, doch viel lieber war sie mit ihrem Vater unterwegs.
In ihrem Stadtviertel kannte sie jeden und jeder kannte sie. Aber die anderen Menschen hier in Mainz gingen ihnen immer aus dem Weg. Dafür sorgte dann auch die Kleidung, die viel zu auffällig war. Der gelbe, spitze Hut des Vaters war eine eindeutige Warnung an alle „Christenmenschen“, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Doch Geschäfte machten sie trotzdem gern mit ihnen. Es ging gar nicht anders!
Sie durften keine Zinsen nehmen und daher lohnte es sich für sie auch nicht, Geld zu verleihen. Und seit die Juden keinen Handel mehr treiben durften, da blieb ihnen nur das Verleihen der Münzen übrig. Als Sarah noch klein gewesen war, da waren sie aus dem sonnigen Toledo in diese triste Stadt des Nordens gekommen. Hier regnete es fast die Hälfte des Jahres. Doch mittlerweile war eben Mainz ihre Heimat geworden.
Erneut sah sie zu ihrem Vater, der dem Händler nochmals die Hand gab und sich zum Verlassen des Ladens zur Tür umdrehte. Er war sehr schlau und sprach acht Sprachen. Ein paar davon hatte er ihr beigebracht, doch sie würde sie nie brauchen können. Frauen blieben im Haus. Nur Mädchen durften noch nach draußen, daher genoss sie jeden Ausflug.
Staunend stand Sarah an einem Regal, betrachtete eine Rolle mit schönem Stoff und strich mit den Fingern über das Muster. „Ich hätte gern ein Kleid von diesem Stoff“, sagte sie träumend und leise, doch dieses Tuch war viel zu kostbar. Es würde irgendwann mal eine Königin oder Fürstin zieren, aber nicht ein kleines Mädchen. Nicht sie, die Tochter eines jüdischen Geldverleihers.
Der Vater hatte den leisen Wunsch dennoch gehört, kam zu ihr herüber und betrachtete den Stoff. „Ja Sarah. Der ist wirklich schön. Vielleicht als dein Hochzeitskleid?“, fragte er und lächelte sie an. „Hochzeit?“, fragte sie erschrocken zurück. War es denn wirklich schon so weit? Natürlich war sie gerade sechzehn geworden und damit im besten Alter um zu heiraten, aber musste das nun wirklich schon so bald sein?
Der Händler kam zu ihnen herüber und zog die Rolle heraus. „Ich kann euch ein paar Ellen von dem Stoff lassen. Ich mache euch einen guten Preis und beim nächsten Mal, wenn ich wieder mal Geld brauche, kommt ihr mir etwas mit den Zinsen entgegen“, erklärte er und legte die Rolle auf den Tisch. Dann rollte er sie ein Stück auf. So ausgebreitet funkelte der Stoff noch viel mehr.
„Das ist erstklassige Ware aus Venedig!“, sagte er weiter und strich mit der Hand darüber. Sarah war im Moment hin- und hergerissen. Einerseits hätte sie gern solch ein Kleid, aber andererseits als Hochzeitskleid? Ihre Freiheit dafür aufgeben? Die beiden Männer begannen zu feilschen und beachteten das Mädchen gar nicht mehr. Wenig später trennte der Händler ein großes Stück von der Rolle und schlug es ein. Sarah übernahm es und drückte es an ihr Herz. Vielleicht würde es ja auch ein ganz normales Kleid sein und der Vater hatte sicher auch noch keinen Ehekandidaten für sie erwählt.
Gemeinsam verließen sie das Geschäft und der Händler blieb in der offenen Tür seines Geschäftes stehen. Dort verabschiedete er die beiden und war sichtbar froh, über das gute Geschäft und die Aussicht, beim nächsten Mal ein paar Münzen zu sparen. Freudig tanzte das Mädchen durch die Straßen und drückte das Päckchen mit dem kostbaren Stoff weiterhin fest an ihr Herz. Sie hätte vor Freude singen können.
Sie waren noch nicht sehr weit gekommen, als aus einer Seitengasse eine Gruppe von Männern der Stadtwache trat und Sarah unvorsichtigerweise in einen der Männer hineinlief. Die junge Jüdin schreckte zurück und verbeugte sich schnell vor den Männern, aber bevor sie noch etwas zu ihrer Entschuldigung sagen konnte, da hatte einer der Männer den Saum ihres Schleiers ergriffen und ihr diesem vom Kopf gezogen. Da er fest mit dem Haar verbunden war, riss er Sarah dabei auch ein paar Haare aus. Mit schmerzverzogenem Gesicht wich sie einen weiteren Schritt zurück.
Die Männer lachten und der eine, welcher den Schleier in der Hand hatte, sagte „Wen haben wir den hier? Eine kleine Jüdin ohne ihren Schleier!“ Dabei hielt er das abgerissene Kleidungsstück triumphierend hoch. „Du weißt schon, dass du dafür bestraft werden musst!“ Der Vater schob sich nach vorn und fragte „Ehrwürdige Herren. Wie hoch ist die Strafe?“ Dabei stellte er sich schützend direkt vor seine Tochter. Der Mann nannte eine Summe und der Vater zog die gewünschten Münzen aus dem Beutel. Der Wachmann nahm die Münzen und schob sich an dem alten Mann vorbei.
Er hielt Sarah den Schleier hin und als sie danach greifen wollte, da zog er die Hand wieder fort. Die Männer lachten und dann warf er ihr den Schleier zu. Sarah wollte ihn fangen, doch sie wollte ihren neuen Stoff nicht loslassen. Mit einer Hand versuchte sie das dünne Gewebe zu erreichen und griff daneben.
Der dicke Wachmann holte kurz aus und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Sarah stürzte und die Männer gingen lachend davon. Schnell half der Vater ihr auf und befestigte den Schleier neu. Nun liefen sie schneller in ihr Viertel.
Sarahs Wange brannte von dem Schlag. „Die gehen jetzt sicher mit den Münzen in die Schänke!“, erklärte der Vater, als sie endlich den schützenden Bereich ihres Stadtviertels wieder erreicht hatten. Erst hier waren sie wirklich sicher. Sarah hatte erst jetzt Tränen in den Augen, aber keine des Schmerzes, sondern welche des Zorns auf die Männer der Wache. Der wunderschöne Stoff würde sie allerdings sicherlich darüber hinwegtrösten.
4. Kapitel
Neue Wege
D ie ganze Nacht hatte sie bei der toten Mutter ausgeharrt. Im silbernen Licht des Mondes hatte sie eine Flut von Tränen vergossen und sich immer wieder gefragt, warum sie als einzige überlebt hatte. Warum hatte Gott sie nicht auch zu sich geholt? Hatte er noch eine Aufgabe für Gundel? Sie wusste es nicht und sie erhielt auch keine Antwort. Als der rötliche Schein der Sonne wieder am Horizont erschien, da zog sie den toten Körper hinter die Hütte, hob mit einem Spaten eine flache Grube aus und legte die Mutter hinein. Sie sprach ein schnelles Gebet und bedeckte den Leichnam mit Erde.
Dann suchte sie alles zusammen, was sie für den Weg brauchen würde. Einen Weg, von dem sie das Ziel noch nicht kannte. Sie nahm dem Bauern seinen Gürtel ab, den er ja sowieso nicht mehr brauchen würde, und legte ihn sich um die Hüften. Nun hatte Gundel dem reich verzierten Dolch auf der einen Seite und einem Beutel mit Münzen auf der anderen. Schwer ruhte beides auf ihrer Hüfte und zog nach unten.
Ihre Finger umklammerten den Griff des Dolches, den sie am Tage zuvor schon für den Schinken benutzt hatte. Diese Waffe war immer der ganze Stolz des eitlen Bauern gewesen. Sie zog die Waffe aus der Scheide und prüfte die Schärfe des Dolches. Es war ein geschnitzter Griff mit Fischen daran und die Waffe lag gut in der Hand. Entschlossen schob sie die Waffe zurück. Damit konnte ihr nichts mehr passieren!
Schnell schob sie ihre Sachen auf dem Tisch zusammen und packte alles in ein Tuch. Auch den Rest des Schinkens legte sie dazu, dann band sie die Ecken über Kreuz zusammen, warf noch einen Blick in die dämmrige Hütte, in welcher sich nun schon der süßliche Geruch der Verwesung ausbreitete, dann brach sie auf. Mit eiligen Schritten durchlief sie die kleine Siedlung.
Immer noch war das Ziel ihrer Reise unklar und erst als sie das letzte Haus des Dorfes passiert hatte, war ihr wirklich klargeworden, dass sie als einzige überlebt hatte. Fünfzig Menschen waren tot, nur Gundel lebte! Das konnte kein Zufall sein. Sie sah den Kirchturm der Nachbargemeinde, zu dem sie immer sonntags zum Gottesdienst gingen und fragte sich, ob dort noch Menschen lebten?
Eine Stunde später war sie an dem Gotteshaus angekommen und sah, dass viele der Nachbarn lebten, aber schon einige krank waren. Sie traf gerade zu einer Beerdigung ein. Gundel wartete, bis der Pfarrer mit seiner Predigt fertig war, dann trat sie an den Mann heran, den sie von den Gottesdiensten her gut kannte. Er sah sie fragend an, schließlich war ja nicht Sonntag und da verließ keiner das Dorf. Wusste er wirklich noch nichts? Sie musste doch sicher ein paar Tage gelegen haben.
„Alle sind tot!“, sagte sie als Erstes und diese leise gesprochenen Worte wurden sofort durch das Dorf getragen. Wenig später jagte eine aufgebrachte Menschenmenge sie aus der Siedlung. Gundel rannte, so schnell sie konnte und hatte Glück, dass die Menschen sie nicht weit verfolgten. Das hätte sonst ihr Ende bedeutet. Erschöpft und zornig setzte sie sich wenig später an den Wegesrand. Was konnte sie denn dafür? Warum waren die Menschen so auf sie losgegangen? Gundel beschloss, ab sofort nichts mehr davon zu erzählen.
Das Glitzern eines kleinen Weihers ließ sich durch das Schilfgras sehen und Gundel dachte daran, sich erst einmal ausgiebig zu waschen. Sie hatte das Gefühl zu stinken und schnupperte vorsichtig an ihren Sachen. Warum stellte sie das eigentlich erst jetzt fest? Vielleicht hatte der Geruch der Toten ihre Nase verschlossen. Und wirklich war der Geruch nicht sehr angenehm. Die Mutter hatte immer sehr auf Reinlichkeit geachtet. Eine Träne stieg in ihr Auge.
Doch zuerst kam der Hunger, der ihren Bauch zuschnürte. Sie wickelte ihr Bündel auf, zog den Dolch und schnitt sich erst einmal ein großes Stück Schinken ab. Dabei fiel ihr Blick auf ein Stück Kräuterseife, dass sie von zu Hause mitgenommen hatte. Die Mutter hatte diese selbst gemacht. Kauend roch sie an dem kleinen Würfel. Der Wunsch nach einem Bad wurde übermächtig, auch wenn sie dann nicht weglaufen konnte, falls die Männer aus dem Dorf doch noch nach ihr suchen würden. Sie schnürte das Paket zusammen und ging zu dem kleinen Teich hinüber.
Die Frau suchte sich eine versteckte Stelle im Schilf, an der sie in das Wasser steigen konnte, dann legte sie das Päckchen ab, löste den Gürtel und zog sich das Kleid über den Kopf. Mit der Seife in der Hand stieg sie im Unterkleid langsam in den Weiher. Das Wasser hatte eine angenehme Temperatur und sie ging ein Stück, bis ihr das Wasser zur Hüfte stand, dann setzte sie sich hin und bemerkte, dass auch das Unterkleid unangenehm roch. Sie hatte sicher einige Tage darin geschlafen und es damit verunreinigt. Aber sie hatte keine Wechselwäsche mitgenommen und sich einfach so auszuziehen, das ging nicht. Öffentliche Nacktheit war eine Sünde! Das hatte ihr der Bauer und der Pfarrer von klein auf beigebracht.
Sie sah sich um. Niemand war hier, der sie sehen konnte, aber dennoch ging sie in das dickste Schilfdickicht hinein, wo sie sich schnell des Unterkleides entledigte. So setzte sie sich in das Wasser, das ihr zum Glück bis zum Hals reichte. Mit der Seife begann sie sich zu waschen. Der Duft war herrlich und brachte damit die schmerzliche Erinnerung an die Mutter zurück.
Beim Waschen spürte sie am Hals eine Erhebung und darum tastete sie erschrocken den Rest ihres Körpers ab. Unter den Armen und an beiden Seiten des Halses hatte sie Beulen, sonst nirgendwo. Gundel betrachtete aufmerksam ihr Spiegelbild im Wasser. Die Schwellungen waren nicht schwarz und auch nicht so groß wie die, welche sie an den Leichen gesehen hatte.
Dann hörte sie ein Pferd und erschrak. Noch tiefer versteckte sie sich im Schilf und sah einen Wagen durch die Halme hindurch.
Hatten die Fuhrleute sie gesehen? Der Wagen hielt an und die Männer stiegen ab. Einer von ihnen kam mit dem Eimer zum Weiher und schöpfte Wasser. Eigentlich hätte er dabei ihr Kleid dort liegen sehen müssen. Gundel dachte an das weiße Unterkleid, das sie noch in der Hand hatte. Sollte sie es schnell waschen und danach wieder überziehen? Das würde sicher zu viel Lärm machen. Mit einer schnellen Handbewegung zog sie das verräterische Stück Stoff unter Wasser und setzte sich darauf.
Ihren Blick auf die Männer gerichtet, versuchte sie kein Geräusch zu machen. Langsam wurde es kühl und sie begann zu zittern, doch sie durfte sich ja nicht bewegen. Schließlich war sie ja nackt! Es wäre eine Schande, wenn die Männer sie so sehen würden! Die beiden begannen ein Gespräch, während sie die Pferde aus dem Eimer tränkten. Sie hörte das Wort „Mainz“ und hatte sofort das Ziel ihrer Reise vor Augen.
Oft war der Bauer dorthin gefahren, um auf dem Markt seine Waren zu verkaufen. Er hatte immer in den höchsten Tönen davon geschwärmt. Da wollte sie hin! Auch, wenn sie noch nie dort gewesen war. Die Männer brachen auf und Gundel wusch schnell ihr Unterkleid, zog es sich nass wieder über und wusch danach kniend ihr Kleid. Auch dieses zog sie sich feucht wieder an.
Nun duftete sie nach der Kräuterseife und fühlte sich gleich viel besser. Mit all ihren Sachen machte sie sich auf den Weg. Wie weit war das wohl bis in die Stadt?
5. Kapitel
Ferne Weiten
I saak sah durch das Fenster auf die Straße, doch er sah weder die Straße noch die Häuser. Sein Blick ging durch alles hindurch und wanderte weit in den Süden. Er dachte an die Weiten Andalusiens, von wo er vor zehn Jahren hier her gekommen war. Im fernen Toledo, der Hauptstadt Spaniens, hatte er alte Schriften der griechischen Philosophen vom Arabischen ins Lateinische übersetzt. So wie sein Vater vor ihm und dessen Vater zuvor. Doch nun gab es da nicht mehr viel zu übersetzen. Darum hatte er vorgehabt, den Menschen hier im Norden die alten Schriften näherzubringen. Auf dem Weg zu einer Universität war er mit seiner Frau und den vier Töchtern in dieser Stadt geblieben, mehr seiner Frau und den Töchtern zuliebe.
Nach und nach hatten die Töchter geheiratet, bis nur noch seine jüngste Tochter, Sarah, bei ihm geblieben war. Nun würde es aber auch bald für seine jüngste so weit sein, dass sie die elterliche Behausung verlassen würde. Gedankenverloren strich er sich über den grauen Bart. Er war nun fast sechzig und hatte spät im Leben über den Bücherrand hinweg gesehen. Erst mit Mitte dreißig hatte er seine Frau geheiratet, damals mehr auf Drängen seines Vaters.
Nun waren bald alle aus dem Hause. Sollte er danach in dieser Stadt bleiben? Schnell hatte er damals gemerkt, dass die Menschen hier nichts von ihm lernen wollten. Sie lasen die Bücher von Heraklit, Ptolemäus und Euklid selbst, die er und sein Vater übersetzt hatten. In Spanien hatten sie seine Fähigkeiten geschätzt. Und hier?
Er durfte nicht Lehren, nicht Arbeiten und auch nicht Handel treiben. Das einzige, was er durfte, war Geld verleihen und Zinsen nehmen. Nicht wirklich das, was er wollte, doch die mathematischen Schriften hatten ihn auch schnell und genau rechnen lassen. So hatte er mit seiner Reisekasse damals angefangen, Geld zu verleihen und war über die Jahre ein reicher Mann geworden. Aber dieser Reichtum hatte auch seine Schattenseite: Die Menschen sahen ihn zunehmend feindselig an. Wer nichts hatte, der neidete dem anderen vieles. Dazu kam auch noch, dass die Kirchen gegen sie hetzten. Die Geistlichen prangerten das Geldverleihen als Wucher an, dabei hätte er liebend gern etwas anderes gemacht. Nur was? Seine Frau legte ihm die Hand auf die Schulter und holte ihn wieder zurück nach Mainz.
„Das ist ein schöner Stoff, den Sarah sich ausgesucht hat“, sagte sie und er stand vom Stuhl auf. „Für unsere Jüngste wird es auch bald Zeit zu heiraten“, entgegnete er und sah zur Tür hinüber. Still war es im Haus geworden und es war für drei Menschen viel zu groß. „Du hast wieder an Spanien gedacht?“, fragte sie ihn und Isaak nickte mit einem Seufzen. „Sollen wir dann wieder dorthin gehen? Dieses Land hier ist nicht nur nach dem Wetter ein Kaltes!“, sagte er schließlich und sah seine Frau durchdringend an. Doch sie kannte die Feindseligkeiten nicht, denen er sich fast jeden Tag ausgesetzt sah. Nur selten verließ sie das Haus.
Wieder musste Isaak an die drei anderen Töchter denken. Sie waren in Italien und Spanien. Da war es so anders, als hier und daher würde er auch gern Sarah in eines dieser Länder verheiraten. Er musste nur noch den richtigen Mann finden, aber angesichts der Mitgift sollte das eigentlich nicht so schwierig sein.
„Ich habe noch zu tun“, sagte er, ließ seine Frau stehen und ging in sein Scriptorium, das sich in dem angrenzenden Raum im Erdgeschoss befand. Er nannte es immer noch so, wie das, in welchem er und sein Vater in Spanien oft bis tief in die Nacht geschrieben hatten. Damals hatte er viele Freunde gehabt: seine Bücher. Mathematische Werke, philosophische Bücher und Abhandlungen über Medizin. Ein paar davon hatte er hierher mitgebracht und eines davon lag aufgeschlagen auf dem Stehpult.
Sorgfältig schloss er das Buch und stellte es in das Regal. Dann nahm er Papier, einen Griffel sowie Tinte und begann einen Brief an einen Rabbi in Cordoba zu schreiben, in welchem er den älteren Mann fragte, ob er nicht jemanden für Sarah als Ehemann kannte. Dieser Brief würde sicher zwei Wochen unterwegs sein. Sollte er noch einen ähnlichen nach Genua schreiben? Oder erst auf die Antwort aus Spanien warten?
Wieder sah er zum Fenster und seufzte erneut. Diese Gewalt in der letzten Zeit war nur schwer auszuhalten. Momentan war es nur eine Gewalt der Worte, doch sie konnte schnell in offene Gewalt umschlagen! In diesem Viertel waren sie unter dem Schutz des Kaisers. Ihm zahlten sie eine hohe Steuer für diesen „Schutz“. Aber würde ihnen das helfen?
Früher hatte er Seite an Seite mit christlichen Mönchen gearbeitet. Die Mönche hatten vervielfältigt, was er übersetzt hatte. Hier war alles so viel anders. Er war hier hergekommen, um Wissen zu bringen und nun wusste er, dass es Zeit war zu verschwinden. Nur noch ein paar Tage, ein oder zwei Monate, dann wäre er wieder in Andalusien. Im Land der Zitronen. Im Lande seiner Ahnen. So weit im Süden.
Pünktlich vor dem Beginn des Sabbats war der Brief auf dem Weg und mit ihm die Gedanken des alten Mannes. Den nächsten Winter würde er schon nicht mehr in diesem kalten Land sein. In ein paar Monaten würde er sich auf den Weg nach Süden machen. Den Weg entlang, den nun schon der Brief voranging.
6. Kapitel
Stadtluft
Z wei Tage hatte es gedauert, bis Gundel endlich vor der Stadt angekommen war. Sie war allen anderen Menschen aus dem Weg gegangen, doch nun würde das wohl kaum noch gehen. Gerade hatte sie das letzte Stück des Schinkens verspeist und nun freute sie sich auf die Stadt. Nach den Nächten im Wald sehnte sie sich nach einem Bett und die Münzen des Bauern würden ihr sicher für ein paar Tage eine Unterkunft sichern. Was danach passieren würde, darüber hatte sie sich noch keine Gedanken gemacht. Sie lebte noch und nur das war im Moment wichtig.
Die Schwellungen waren mittlerweile völlig verschwunden. Sie fühlte sich gut und hätte vor Freude vor dem Tor tanzen können. Die junge Frau sah zu der hohen Mauer hinauf und folgte dem Weg, den vor ihr ein paar Wagen entlang fuhren. Auf den Steinen des Weges schmerzten ihre nackten Füße. Vielleicht würde sie zuerst ein Paar Schuhe kaufen gehen. In der Stadt wären die sicher dringend notwendig. Auf dem Land eher nicht so sehr. Da trug sie nur im Winter die dicken Schnürschuhe, wenn sie die Hütte verlassen wollte.
Sie wich einem Pferd aus und dann stand sie direkt vor dem Tor. Ein Stadtsoldat hielt sie an und fragte „Wohin willst du?“ doch das wusste sie ja selbst noch nicht, also sagte sie „Ich kommen vom Dorf und suche eine Anstellung!“ Der Mann musterte sie, bemerkte die fehlenden Schuhe und betrachtete auch den prachtvollen Dolch, das schien ihm nicht zusammenzupassen, doch dann gab er ihr den Weg frei und ließ Gundel durch das Tor. Ein Gewimmel von Menschen empfing das staunende Mädchen vom Land.
Kleidung in allen Farben leuchtete ihr entgegen. Auch in ihrem Dorf hatten sie bunte Kleidung gehabt, aber die wurde nur zum Sonntag getragen. An allen anderen Tagen gab es höchstens mal ein buntes Tuch, das das grau und braun der Kleidung verschönerte. Erdtöne waren die bestimmende Farbe gewesen. Hier war alles anders und es war ein normaler Wochentag. Fast jeder war bewaffnet. Nur die ganz vornehmen Frauen trugen keinen Dolch. Dafür wurden sie meist von mehreren Bewaffneten begleitet und beschützt.
Weitere Menschen drängten hinter Gundel durch das Tor und einer schob sie zur Seite „Steh doch nicht so faul hier rum!“ schnauzte er sie an und bevor sie etwas erwidern konnte, war er schon in dem Menschengewimmel verschwunden. Um nicht weiter im Weg zu stehen, stellte Gundel sich an die Seite und beobachtete weiter. Die Straße war sauber, aber in den Seitengassen sah sie Unrat liegen. Eine Ratte rannte ihr über die Füße. Niemand schien hier etwas gegen diese Nagetiere zu unternehmen. In ihrem Dorf verfolgte man sie mit allen Mitteln, die Plagegeister taten sich sonst an den Vorräten gütlich. Sie stand dort und der Geruch der Seitengasse hinter ihr stieg ihr in die Nase. Der Misthaufen hinter ihrer Hütte roch so ähnlich. Ein Gemisch aus Schweinegülle und Stroh war es dort, was es hier war, das wollte sie lieber nicht wissen.
Warum reinigten die Menschen hier eigentlich nur die breite Straße? Die Gassen hätten es auch dringend nötig gehabt. Trotz des lästigen Geruchs blieb sie dort stehen. Zuerst wollte sie wissen, wie die Menschen hier lebten und das bekam man sicher am besten heraus, wenn man sie beobachtete. Der Blick ging hauptsächlich zu den Frauen. Sie sah die bunten Schleier und stellte fest, dass sie die einzige war, die ihr Haar offen und unverdeckt trug. Die langen braunen Haare fielen gelockt über ihre Schultern nach vorn. Gundel mochte ihr langes Haar, doch hier würde sie es bedecken müssen. Sie seufzte bei dem Gedanken daran.
Dann sah sie, dass es auch Menschen gab, denen die anderen offensichtlich aus dem Weg gingen. Die Männer hatten spitze gelbe Hüte auf und trugen einen gelben Ring aus Stoff an der Brust. Sie konnte sich diese Kleiderordnung nicht erklären, wollte aber auch nicht fragen. Schließlich beschloss sie, weiter in die Stadt zu gehen, drehte sich um und prallte mit einem vornehm gekleideten Mädchen zusammen, das etwa so alt war, wie sie selbst.
Wie aus einem Munde sagten beide „Entschuldige.“ dann lachten sie und das andere Mädchen verbeugte sich. Gundel war etwas verwirrt, dann sah sie auch den Kreis bei der Frau und fragte danach. Die andere Frau legte ihre Hand darauf und antwortete „Ich bin eine Jüdin.“ Gundel nickte verstehend. Sie hatte vom Pfarrer schon von den Juden gehört, aber diese Frau schien ihr ganz sympathisch zu sein. Sie entsprach so gar nicht den Schilderungen des Pfarrers, die dieser am Sonntag immer in der Kirche vorbrachte. „Und ich bin Gundel“, sagte sie und hielt der anderen Frau die Hand hin. Nun sah sie die Verwirrung bei der anderen. Nur zögerlich nahm diese die Hand und sagte „Mein Name ist Sarah.“
„Weißt du, wo ich hier eine Unterkunft bekomme, einen Schleier und Schuhe?“, fragte Gundel und Sarah sah an ihr herunter „So viele Fragen“, antwortete Sarah lachend und sagte dann „Komm mit!“ Gemeinsam gingen sie die Straße weiter, bis sie auf dem Markt angekommen waren. Dort zeigte Sarah auf die Stände und sagte „Hier wirst du alles finden. Ich muss weiter.“ „Ich danke dir“, sagte Gundel und verbeugte sich nun ihrerseits von dem anderen Mädchen, das daraufhin ziemlich verwirrt den Platz verließ.
Noch eine Weile sah sie Sarah nach, die sich auch noch zwei Mal umblickte, dann kaufte sich Gundel zuerst ein Paar Schuhe und einen schlichten Schleier. Von den Münzen blieb damit aber gerade noch etwas für ein ausgiebiges Mahl in einer Schänke am Markt. Und was nun?
Nach einem Krug guten Weins, etwas Fleisch und Brot stand sie satt wieder auf dem Marktplatz und sah dem Gewimmel der Leute zu. Sie brauchte eine Unterkunft für die Nacht! Was konnte sie? Tiere hüten und Feldarbeit würde in der Stadt nicht so oft gebraucht werden wie im Dorf. Was konnte sie noch? Gedankenverloren strich sie über den selbst gemachten Rock. Sie konnte nähen! Das war es!
Gundel sah sich um und bemerkte ein Haus an der Seite des Marktes, unter dessen Vordach eine Frau Kleider auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Schnell ging sie zu der Frau und fragte „Habt ihr für mich eine Anstellung?“ Die andere Frau war offensichtlich von der direkten Art, die ihr Gundel entgegenbrachte, völlig überrumpelt. „Was kannst du denn?“, fragte sie, anstatt einfach „Nein.“ zu sagen, wie sie es offenbar schon auf den Lippen hatte.
„Ich kann nähen! Schaut meinen Rock an: Selbst genäht!“, erklärte Gundel und hob den Rock an, damit die Frau die Nähte des Kleidungsstückes begutachten konnte. Die Frau beugte sich nach vorn und prüfte die Arbeit. Sie zog am Stoff, aber die Naht hielt. Dann nickte sie und sagte „Ich werde es mal mit dir probieren!“ Sie zeigte auf einen umgestülpten Eimer, der neben ihr stand. Schnell setzte sich Gundel und sah ihr zu, wie sie die Kleidungsstücke verkaufte. Die Unterkunft war erst mal sicher.
7. Kapitel
Neue Hilfe
W ie jeden Markttag stand Martha auch an diesem Tag an ihrem Tisch in dem Durchgang zum Markt. Sie war gerade 40 Jahre alt geworden und die letzte Nacht hatte sie wieder an dem Kleid für die Frau des Bürgermeisters genäht. Es ging praktisch nur in der Nacht, da sie ja auch noch für Knechte und Mägde im Hause des Kaufmannes zuständig war. Aber das Verkaufen wollte sie nicht lassen, da es ihr sehr wichtig war, mit den Menschen auf dem Markt zusammenzukommen. Diesen einen Tag in der Woche verließ sie das Haus, sonst nur noch am Sonntag zum Gottesdienst.
Der Herr hatte es ihr erlaubt, diesen kleinen Handel zu betreiben, aber er hatte darauf bestanden, dass sie seine Stoffe verwendet und immer darauf hinweisen sollte, woher sie diese hatte. Es war so etwas wie eine Werbung für den Kaufmann und so zogen sie beide aus diesem Geschäft ihren Gewinn. Auch diesen regengeschützten Platz hatte sie seiner Fürsprache zu verdanken. So brauchte sie immer nur den Tisch aufzubauen und die Kleider, sowie Stoffe darauf auszubreiten.
Ein frischer Wind zog vom Fluss herüber und vertrieb die schlechten Gerüche. Wie immer ließ sie ihren Blick über den Marktplatz gleiten. Wo waren ihre Kundinnen? Sie hatte einen guten Ruf als Schneiderin und den wollte sie auch behalten. Die reichen Frauen schmückten sich gern mit ihren Stickereien und so manche trug gerade im Moment ein Kleid von Martha. Bei einem erneuten Blick über den Markt fiel ihr eine junge Frau auf, die barfuß und ohne Schleier von Stand zu Stand ging. Mit einem Mal war sie wieder an sich erinnert und dachte daran, wie sie einst nach Mainz gekommen war.
Mehr als zwanzig Jahre war das nun schon her. Jung, dumm und beinahe mittellos war sie aus ihrem Dorf aufgebrochen. Nicht wissend, was sie hier erwarten würde. Und es war einfach nur fürchterlich gewesen! Sie war hier in der Stadt einer Räuberbande in die Hände gefallen, die sie ausraubten und sich an ihr vergingen. Davon war sie schwanger geworden und hatte nicht gewusst, wie es weiter gehen sollte. Mehr als einmal hatte sie auf den Treppen am Ufer gestanden und überlegt, in den Fluss hineinzuspringen und damit alles zu beenden. Doch die Angst vor dem Fegefeuer und der ewigen Verdammnis hatte sie immer zurückschrecken lassen. Martha war damals zu einem armseligen Leben verdammt gewesen.
Mit betteln hatte sie sich am Leben gehalten. Im Sommer war das ganz gut gegangen, aber im Winter war es dann besonders schlimm geworden, da hatte sie nachts immer einen Platz im Dom gesucht, wo sie im Gebet die Wärme gesucht hatte, die ihr die Stadt nicht geben konnte. Dann hatte sie unter Schmerzen alleine in einer dunklen Frühlingsnacht ihr Kind bekommen. Ein Mädchen! Doch was sollte sie mit dem Kind? Sie konnte ja sich selbst kaum am Leben halten und so hatte sie es auf die Stufen des Domes gelegt und war zum Beten hineingegangen. Als sie das Gotteshaus dann später wieder verlassen hatte, war das Mädchen verschwunden gewesen.
Sie konnte nur hoffen, dass es ihr besser ging, als es ihr bei ihr ergangen wäre. Fast neunzehn Jahre musste ihre Tochter nun sein, von der sie nie wieder etwas gehört hatte. Tränen stiegen ihr kurz bei der Erinnerung in die Augen und sie sah zum Dom hinüber, von dem sie die Spitze sehen konnte. Beinahe hätte sie von ihrem Platz aus auch die Stelle sehen können, an der sie die Tochter ihrem Schicksal überlassen hatte. Es musste ihr einfach gut gehen!
Viel später hatte sie den Kaufmann getroffen. Seine Frau war gestorben und er suchte für seinen Sohn, der noch keine vier Jahre alt gewesen war, eine Amme. Warum er gerade sie, als Bettlerin, gefragt hatte, das wusste sie nicht, aber sie war ihm so unendlich dankbar für Dach und Brot gewesen, dass sie fast alles für ihn tun würde. Da er nicht wieder geheiratet hatte, was für einen reichen Kaufmann eher unüblich war, war Martha, nachdem Balthasar ihrer Hilfe nicht mehr bedurft hatte, in die Rolle der Hausherrin aufgestiegen.
Martha würde auch weiterhin das Haus führen, denn so wie es aussah, würde der Herr wohl nun auch nicht mehr heiraten. Zwar waren ihr die Gerüchte auch schon an ihr Ohr gekommen, dass sie bei einem unverheirateten Mann in Diensten stand, doch es war nun mal so, wie es war und gegen Gerüchte konnte man sich nicht wehren. Tat man, oder besser Frau, es doch, so verstärkte das nur das Gerücht, denn dann musste ja etwas Wahres dran sein. Die Frau vom Nachbarstand gab ihr einen Apfel. Oft standen sie hier nebeneinander und redeten, oder halfen sich. In den Jahren waren sie fast so etwas wie Freundinnen geworden.
Elisabeth, die Tochter der Frau, war nun bei Martha in Stellung und arbeitete als Magd. Sie war fleißig und sehr schön geworden. Wenn Marthas Tochter noch irgendwo war, dann hoffte sie, dass es ihr so ging, wie Elisabeth im Moment und sie hatte die Tochter der Freundin wie ihre eigene Tochter unter ihren Schutz genommen. Leider war sie nicht so geschickt mit Nadel und Faden, wodurch diese ihr nicht beim Nähen helfen konnte, aber die junge Frau war auch so froh, unter Marthas Schutz in dem großen Haus arbeiten zu dürfen.
Wieder fing die fremde, junge Frau Marthas Blick ein. Sie hatte an einem Stand einen Schleier gekauft und auch Schuhe hatte sie nun offenbar an. Kurz darauf verschwand sie im Menschengewimmel und Martha wünschte ihr im Gedanken viel Glück. Eine wohlhabende Frau trat an ihren Tisch und kaufte ein reich besticktes Kleid, welches Martha so manche Nacht den Schlaf geraubt hatte. Schnell wurden sie sich handelseinig und ein paar Münzen waren der Lohn für schlaflose Nächte.
Dann sah sie die junge Frau am anderen Ende des Marktes wieder. Da schien etwas Besonderes zwischen ihnen zu sein, dass sie dieses Mädchen nun schon zum dritten Male sah und ihr diese auch noch unter den vielen hundert Menschen hier sofort in ihr Auge stach.
Offensichtlich ging es dem Mädchen ähnlich, denn sie kam direkt auf sie zu und fragte einfach „Habt ihr für mich eine Anstellung?“ Für einen Moment war Martha verdutzt, doch dann dachte sie, dass sie hier wohl eine Hilfe für das Nähen bekam, unsicher fragte sie „Was kannst du denn?“ und hoffte, dass das Mädchen „Nähen!“ antworten würde. Und wirklich sagte sie „Ich kann nähen! Schaut meinen Rock an! Selbst genäht!“
Dann zeigte sie das Kleidungsstück und Martha prüfte die Arbeit. Wenn sie das wirklich selbst genäht hatte, dann hatte Gott ihr dieses Mädchen geschickt und sie würde sie nicht wieder gehen lassen. „Ich werde es mal mit dir probieren!“, sagte Martha, dann zeigte sie auf einen umgestülpten Eimer, der neben ihr stand. Schnell setzte sich das Mädchen und Martha fragte „Wie heißt du denn eigentlich?“ „Gundel“ kam die schnelle Antwort. Sie mochte gerade erst mal sechzehn Jahre alt sein. Das war die erhoffte Hilfe für sie. Ihr konnte sie noch etwas von ihrem Wissen beibringen und vielleicht war es so etwas wie ein Ersatz für die verlorene Tochter. Martha bedankte sich still bei Gott.
8. Kapitel
Dunkle Wolken
E