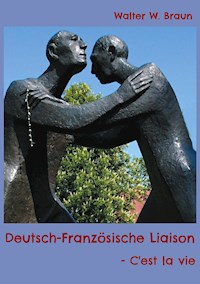Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die fiktive Geschichte rund um den Michaelishof, im Kontext der Historie des Nordrachtals und politischen Umfeld im Dritten Reich, soll eine Hommage sein, einerseits an die bäuerliche Kultur im Schwarzwald, andererseits an den Ort meiner Kindheit, wo ich zur Schule ging und rund zwanzig Jahre meines Lebens verbrachte. Es ist ein Bilderbuchtal im Mittleren Schwarzwald, wo mein Vater und Großvaters ihre Wurzeln hatten. Die reizvolle Mittelgebirgslandschaft mit seinen vielen Facetten habe ich in allen Richtungen bewandert. Heinrich Hansjakob, Bestsellerautor, oder "Rebell im Priester-rock", wie er auch genannt wurde, setzte mit dem Buch: "Der Vogt auf Mühlstein", den bodenständigen Menschen auf den Höhen über dem Nordrachtal ein Denkmal. In "Westwärts, Wellenreiter: Schwarzwälder Flößer von der Kinzig zum Ohio", von Gottfried Zurbrügg, wird die tragische Verarmung großer Teile der Bevölkerung in der Kolonie beschrieben, nachdem die Produktion der Glashütte zum Erliegen gekommen war. Die in der Handlung beschriebenen Plätze und Orte, die geschichtlichen Hintergründe sind real, ohne Anspruch auf Vollständigkeit im Detail.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Delikate Aufgabe
Auf geschichtsträchtigen Wegen
Ernsthafte Probleme
Es eskaliert
Ein ärgerliches Malheur
Unerwartetes Umdenken
Das Geschäft geht weiter
Die Einigung
Die Weichen werden gestellt
Denkwürdiges Bauerntreffen
Hohe Investitionen
Politische Umwälzungen
Es ist Erntezeit
Neues Jahr, neues Glück
Der Michaelishof wird mobil
Hannes steigt ein
Rauschende Bauernhochzeit
Der Krieg hat begonnen
Kriegsgetöse im Westen
Das letzte Aufgebot
Wie geht es weiter?
Ein neuer Bauer zieht ein
Späte Reue
Epilog
1
Delikate Aufgabe
Der nahende Herbst des Jahres 1931 machte sich spätnachmittags schon unangenehm bemerkbar. Nach dem Sonnenuntergang wurde es spürbar kühler im engen Schwarzwaldtal Nordrach, weit hinten im Hintertal und in der Kolonie, und die Luft fühlte sich dabei frisch und klamm an. Mit festem Schritt, doch leicht flauem Gefühl im Magen, schritt der Bildstein-Frieder vis-à-vis am Gasthaus „Adler“ vorbei und zügig bergan, den Weg zum Bärhag hoch und weiter in Richtung Stollengrund. Der anfangs etwas steile Weg störte ihn weniger, er war im Beruf täglich in Feld und Flur und über Berg und Tal unterwegs, daher verfügte er über eine gute Kondition, war bestens trainiert, zäh und ausdauernd. So schnell brachte den Mann nichts außer Puste. Was ihm mehr Sorgen bereitete, war der heikle und unangenehme Auftrag, den er hatte in seiner Eigenschaft als Förster erledigen musste. Stattdessen würde er lieber 20 Rosenkränze in der katholischen Kapelle St. Nepomuk in der Kolonie oder in der Kirche im Dorf beten und dessen Patron St. Ulrich huldigen. Doch was sein musste, das musste sein, denn sein Credo war: „Was ich nicht ändern kann, tue ich gern.“ So hatte er sich bisher stets die Freude an seinem an sich beneidenswerten Beruf bewahrt. Warum war sein Auftrag so heikel, was machte dem Mann denn solche Sorgen? Das lag daran, dass er wieder von mehreren Seiten massiv Klagen hören musste. Die Bauern der umliegenden Höhenhöfe auf den Flacken, dem Mühlstein und drüben in den Schottenhöfen waren aufgebracht und beschwerten sich wieder und wieder über massive, durch Wild verursachte Schäden. Vornehmlich die Wildschweine wüteten und waren den Bauern eine arge Plage. Und sie geben dem steinreichen Waldbesitzer und Jagdpächter Seppe-Michel vom Michaelishof die Schuld, der bisher alle Ansprüche rigoros abbürstete. Bei seinen Kollegen hatte er den üblen Ruf, hochnäsig zu sein, herablassend, mit protzigem Gehabe den kleinen Bauern gegenüber, ein Despot in seiner Familie und im Umgang mit seinem Gesinde.
Die Betroffenen zeigten sich erbost und verärgert: „Der jagt zu wenig, der hält die Sauen nicht in Schach, die uns die Felder umgraben, die Schälschäden durchs s’Rotwild, das uns die frischen Triebe der Jungpflanzen abknabbert und das Stammholz schädigt. Do muesch ebbis dogegen moche, Förschter, dess goht so nit. Auch wenn er ein übler Geizkragen ist, muss er uns entschädigen. Kümmere dich darum“, wurde ihm nachdrücklich aufgetragen, wenn er wieder auf Geschädigte traf. Sicher, es gehörte zu seinen Aufgaben, für Recht und Ordnung im Wald zu sorgen, trotzdem störte ihn, wenn man sich hinter seinem Rücken versteckte und aus der Deckung heraus Angriffe startete, so nach dem Motto: „Feigling geh weg, lass mich hinter den Baum.“
Während er beim letzten Besuch im ehrwürdigen „Adler“ in der Kolonie in der Wirtschaft saß, sind gleich drei Bauern wütend auf ihn eingestürmt und regelrecht über ihn hergefallen. Dabei wussten sie selber genau, wie eigensinnig und stur der Seppe-Michel sich geben konnte, und wer fürchtete nicht seine cholerischen Wutanfälle? „Du kannsch‘mer e‘mol de Buggl runder rudsche“, war einer seiner Standardsprüche, wenn ein anderer etwas von ihm wollte, was ihm nicht passte und das war noch die harmloseste Reaktion. Manchmal verwendete er ganz andere Kraftausdrücke. Zog sich der Kontrahent nicht schnell zurück, konnte es schon passieren, dass ihn der bärenstarke Mann am „Schlafittchen“ (Kragen) fasste, wie einen Hampelmann hochhob und plotzen (fallen) ließ, zur Gaudi der Zuschauer natürlich.
Dabei spielte zum Ärger auch immer die permanente Angst um die eigene Existenz hinein, denn der Seppe-Michel war schnell dabei, wenn irgendwo ein Stückchen Acker oder Wald vakant wurde, weil der Besitzer die Steuern nicht bezahlen konnte oder sonst das Geld ausging. Dann riss er sich das Gelände für ein Butterbrot unter den Nagel. „Der kann den Hals nie voll genug kriegen“, erregten sich manche. Dabei wusste jeder, so hielten es schon die Vorfahren auf dem Michaelishof, sie sind keinesfalls mit Samthandschuhen zum vorhandenen Reichtum gekommen.
Solch einem Grobian wollte man lieber nicht in greifbare Nähe oder in die Quere kommen. Wenn möglich gingen ihm alle weit aus dem Weg und schickten dafür andere ins Gefecht. Aus diesem Grunde traute sich keiner, direkten Kontakt mit dem Seppe-Michel aufzunehmen. Stattdessen wandten sie sich an ihn, den zuständigen Revierförster. Nun sollte er kraft seines Amtes für sie „die Kastanien aus dem Feuer holen“, die Beschwerden der betroffenen Anrainer überbringen und am Ende deren Forderungen durchsetzen. So sehr ihn die Sorge umtrieb, umso zielsicherer näherte er sich dem am Hang stehenden, wuchtig wirkenden und im traditionellen Schwarzwälder Stil erbauten, stattlichen Bauernhof. Das langgezogene Gebäude war einer der größten Höfe im Tal, und es war unverkennbar: Hier ist Geld vorhanden – „und Geld regiert die Welt“, sagt schon der Volksmund. Der Seppe-Michel gehörte eindeutig zu den reichen Bauern im Tal, wenn er nicht gar der Reichste war, und das stellte er gerne zur Schau, das gab ihm Macht, die er bisher rücksichtslos über andere ausübte.
Grundlage seines Reichtums waren weniger die Erträge der Felder und Wiesen auf der Höhe und an den Hängen des Tals, auch nicht die zwei Dutzend Schweine, die Kühe, Rinder und Ochsen im Stall sowie vier stramme Pferde. Der Reichtum kam und kommt aus dem riesigen Waldbesitz, den schon seine Vorfahren erworben und zusammengerafft haben. Unterschwellig geht immer schon die Vermutung im Tal um: „Schon damals ist nicht immer alles mit rechten Dingen zugegangen.“ Die Behauptungen waren nicht annähernd belegt, vielleicht auch nur im puren Neid geboren, aber Gerüchte halten sich in den abgeschiedenen Regionen, in einer benachteiligten Bevölkerung hartnäckig. „Wo viel ist, kommt viel dazu“, sagt man landläufig, oder: „Der Teufel scheißt immer auf die größeren Haufen.“ Das Gespenst der Gerüchte waberte schon immer durchs Tal und flüsterte: „Wenn einem armen Schlucker das Geld ausgegangen war, er die Pacht für Felder und Wiesen nicht mehr bezahlen konnte, ein Kälteeinbruch, langanhaltender Regen die Ernte verdorben hatten oder andere Naturgewalten sie vernichteten, dann nahmen oder „fuggerten“ (feilschen) die Michels dem Betroffenen den Wald schnell mit geringem Geld ab.
Tatsache ist, die Vorfahren des Seppe-Michels hatten eine glückliche Hand, was sowohl die Bewirtschaftung des Hofes, wie die Vermarktung und Erträge aus dem riesigen Waldbesitzes betraf. Das ermöglichte ihnen, nach und nach mehr Grund und Boden zu erwerben, und besonders dann, wenn er günstig zu haben war. Schon der Urgroßvater und Großvater hatten es gezielt darauf angelegt, möglichst zusammenhängende Waldstücke in ihre Hand, in ihren Besitz zu bekommen, und da war ihnen jedes Mittel recht. In den Wäldern der Berghänge und auf der Höhe stehen hochgewachsene, teils uralte und kerzengerade Tannen und Fichten, viele hunderte Jahre alte stämmige Eichen und weit ausladende Buchen. Im geringeren Umfang finden sich dazu Kastanien und weiter unten im Tal etliche Nussbäume. Sie sicherten schon seit Generationen dem Hof gute Erträge aus der Waldwirtschaft. Der riesige Waldbesitz erstreckt sich oberhalb der Rautsch und vom Süden her ab dem Gebiet der Flacken, rund um den Täschenkopf, über Heidekirche, Rautschkopf bis zur Lindenbach-Höhe und dem Schäfersfeld im Norden. Der Bergrücken auf rund 600 bis 800 Meter über Meereshöhe ist der Übergang zwischen Nordrach und Oberharmersbach, sowie der Höhenrücken an der Grenze hinüber ins Renchtal. Große zusammenhängende Flächen gehören seit jeher in den Besitz des Michaelishofs.
Der Hof ist umgeben von kräuterreichen Weidewiesen und fruchtbaren Äckern. Überall steht ein alter Baumbestand mit Kirschen, Äpfeln, Birnen, Zwetschgen und Mirabellen sowie einigen Bäumen der uralten Sorte Zibarte (Zibärtle). Die Bäume auf den Streuobstwiesen und an Wegrainen tragen Jahr für Jahr ansehnliche Mengen Griesen (Kirschen) und andere Obstsorten. Deren Erträge dienen dem Bauer vorwiegend als Grundlage für seine seit Generationen leidenschaftlich betriebene Schnapsbrennerei im eigenen Brennhäusle. Das ist bei den Einnahmen das zweite wichtige Standbein, neben dem Wald.
Schon der Urgroßvater ließ großflächig ausgewachsene und erntereife, bis zu 60 Meter hohe Tannen einschlagen, neben Mengen anderer Baumarten. Die Stämme wurden mit kräftigen Kaltblüter-Pferden aus dem Wald gezogen, auf gefährlichen Wegen ins Tal transportiert und dort in der aufgestauten Nordrach, dem Flüsschen, das dem Tal den Namen gibt, hinaus geflößt und über den Harmersbach, die Kinzig, schließlich auf dem Rhein bis nach Holland transportiert. Für die Flößer, einem damals noch eigenständigen Beruf, war das eine schwere und gefährliche Knochenarbeit. Wenn sie es überlebt haben, dann war es für sie ein einträgliches Geschäft, aber nichts ging eben ohne Risiko. Den Waldbesitzern und den Bauern füllte es jedenfalls die Schatulle mit zehntausenden Gulden. So wurden sie unermesslich reich und angesehen, verliehen manchmal sogar Geld an die Landesfürsten und bekamen dafür horrende Zinsen. Da waren die Vorfahren des Seppe-Michel keine Ausnahme.
Der Wald wird seit eh und je im Schwarzwald allgemein als die Sparkasse des Bauern betrachtet. Nicht jeder Waldbesitzer kann aber auf so einen uralten, gepflegten Waldbestand blicken, der über Generationen gewachsen ist und schon den Vorfahren des Seppe-Michels überdurchschnittliche Einnahmen bescherte. Nur das Kloster Gengenbach verfügte anfangs des 19. Jahrhunderts über größere Flächen. Es wurde aber 1803 im Rahmen der Säkularisation enteignet und der Grund und Boden dem Großherzogtum Baden zugeschlagen. Davon hat wiederum der Großvater des Seppe-Michel beachtliche Bestände zukaufen können, weil der Großherzog gerade mal wieder knapp bei Kasse war.
Weitsichtig kaufte der Urgroßvater peu à peu neue Waldflächen auf den Höhen hinzu, ließ sie wachsen und nicht nur abholzen. Vorrausschauend, wo es nötig war und es an der natürlichen Besamung fehlte, ließ er freie Flächen aufforsten. Sein Sohn, der Großvater des Seppe-Michels, wirtschaftete nicht weniger gut und vermehrte weiterhin das Vermögen. Nur beim Vater gab es zwischendurch leichte Turbulenzen. Schuld daran war die Währungsreform der Jahre 1923/1924. Das glich er aber schnell durch verstärkten Holzeinschlag wieder aus, nachdem die Nachfrage nach Bauholz mit neuem Geld angezogen hatte. Kurz danach übergab der Vater 1926 den Hof an seinen Sohn. Nur leider hatte er nicht mehr viel vom Ruhestand, er ist schon ein Jahr später bei einem tragischen Unglücksfall – und wo? natürlich im Wald – ums Leben gekommen.
Somit sind von Anfang an nicht nur stattliche Bäume gefällt worden, sondern es sind regelmäßige Aufforstungen erfolgt und auch die zusätzliche natürliche Aussaat zeigte Früchte. So hat sich, bei allen Unwägbarkeiten und naturbedingten oder hausgemachten Unbilden, immer eine stabile Grundlage erhalten, die von Generation zu Generation gewachsen ist. Die Tannen, die der Urgroßvater und Großvater vor Jahrzenten anpflanzen ließ, sind inzwischen gut gewachsen und stehen jetzt zum Einschlag bereit.
Die uralten mächtigen Tannenriesen sind auf dem Markt wegen ihres kerzengeraden Wuchses und dem widerstandsfähigen Holz sehr begehrt und gefragt. Das Holz wurde bisher dem Seppe-Michel sozusagen „aus den Händen gerissen“, wie auch das von uralten Eichen und riesiger Buchen mit meterdickem Stammumfang, die zahlreich im Revier zu finden sind. Die Sägewerke im Tal und die aufkommende Möbelindustrie, wie auch die zahlreichen Schreinereien im weiten Umkreis, konkurrierten geradezu um das begehrte Stammholz. Das nebenbei anfallende Astholz wie auch das minderwertige Holz lieferte jährlich beachtliche Mengen Brennholz. Da Herde und Öfen noch weitgehend mit Holz und Kohle beheizt wurden, konnte er eigentlich nie ausreichende Mengen liefern. Wenn er dann noch das im Wald liegengebliebene Restholz als „Schlagraum“ für wenig Geld abgab, wurde jedes Ästchen aufsammelt und aus dem Wald geschafft, und nebenbei noch der eine und andere Dürrständer (dürrer Stamm) mit bis zehn Zentimeter Durchmesser – oder ein bisschen mehr – umgesägt und mitgenommen, was erlaubt war oder geduldet wurde.
Zu den umfangreichen Liegenschaften des Michaelishofs gehörten weitläufige Wiesen- und Ackerflächen ums Haus, oberhalb und hinab bis zum Bachlauf im Tal. Insgesamt berechnete sich der Besitz des Hofs anfangs der 1930er-Jahre auf über 1000 Morgen. Ein Morgen entspricht etwas mehr als einem Viertel Hektar, oder war ursprünglich die Fläche, die mit einem Einscharpflug von Pferden oder Ochsen gezogen, an einem Vormittag umgepflügt, „gezackert“, wie man hier sagt, werden konnte.
Was im Dorf in der Bevölkerung nicht überall gut ankam, war der rigorose Umgang, den seit alters her der jeweilige Michaelishofbesitzer mit den Anrainern pflegte. Viele sahen das als „Gutsherrenart“. Konnte einer die überhöhten Pachten nicht bezahlen oder ging ihm auf andere Weise das Geld aus, sei es wegen einem Unglück oder ungünstigen Natureinflüssen, dann machten schon die Vorfahren des Seppe-Michels kurzen Prozess. Und das ist bis heute so geblieben. Schnell riss man sich das Gelände für einen „Appel und ein Ei“ unter den Nagel. Das schuf Ängste und Ärger, aber mehr noch viel Neid. „Das Hemd ist mir näher wie der Kittel“, pflegte er herablassend zu sagen und meinte damit, seine eigenen Interessen gehen ihm allem anderen vor. „Was soll mich Hans und Franz interessieren, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.“
Den Händlern und Aufkäufern erging es nicht viel besser. Wegen der Größe des Hofes und dem umfangreichen Besitztum, konnte der Bauer bei den Verkaufs-Verhandlungen kräftig um die Preise feilschen und pokern. Das spielte er „bockelhart“ aus und ließ damit seinem Gegenüber kaum noch Luft zum Atmen. Solches Gebaren machte ihn nicht beliebt, die meisten waren jedoch auf ihn, oder die Geschäfte mit ihm, dringend angewiesen. Sie sahen sich nicht auf Augenhöhe und somit im Seppe-Michel eher einen gnadenlosen Fürsten, der nach Gutdünken rücksichtslos mit ihnen umsprang.
Auf den weitläufigen Äckern wurden überwiegend Getreide, Rüben und Kartoffeln für den eigenen Bedarf angebaut und geerntet. Die ausgedehnten Weideflächen sicherten den Kühen ausreichend Futter. Sie weideten vom Frühjahr bis weit in den Herbst hinein auf den Wiesen und wurden von Hütebuben bewacht. Die langen Winter über verbrachten sie im Stall, wo sie Heu als Futter bekamen und dazu täglich eine Handvoll Rübenschnitzel als spezielle Leckerei. Nach dem ersten Grünfutterschnitt folgte meistens schon im Juni die Heuernte. Später war noch die Öhmd, der zweite Schnitt dran. War das Heu auf der Wiese trocken, wurde es auf Haufen geschichtet und dann mit Gabeln in Bündeln auf Heuwagen geladen, gut verteilt und hoch aufgeschichtet, zuletzt mit hölzernem Spanner und Seilen gesichert. Anschließend wurden die schweren Fuhren mit vorgespannten Ochsen in die, vom Hang aus eben einfahrbare Tenne gekarrt. Dort wurde es vom Wagen mit Gabeln aufgenommen und auf die oberhalb befindliche Heubühne geschafft, wo sie Hütebuben oder die Mägde es gleichmäßig mit der Hand verteilten und mit den Füßen verdichteten, damit eine gehörige Menge Platz fand.
Das seit Generationen bestehende Brennrecht sicherte dem Hof zusätzlich ergiebige Einnahmen, selbst in schwierigen Zeiten, denn getrunken wird immer, und wenn es schlecht läuft eher noch mehr. Aus vielen Zentnern Äpfeln und Birnen wurde Saft gepresst und Most hergestellt. Den überwiegenden Teil an Kirschen, Äpfeln und Birnen, zudem ein großes Quantum Maische aus Steinobst, wie Zwetschgen, Mirabellen und Zibärtle, brannte der Seppe-Michel zu Schnaps und edlen Obstbränden. Das war das ureigene Geschäft des Bauern, das überließ er keinem, nicht einmal seinem altgedienten und erfahrenen Knecht Hermann.
Abnehmer für die edlen Schwarzwälder Spezialitäten fanden sich immer. Ein gewisser Teil kaufte der Händler im Dorf, außerdem kamen Aufkäufer aus der Rheinebene von Freiburg bis Karlsruhe. Die fruchtigen Brände der Schwarzwälder Bauernhöfe sind seit alters her begehrt, und was die Qualität und Mengen betraf, zählte der Michaelishof zu den Besten.
Der Most für den Eigenbedarf wurde aus etwa 80 Prozent Äpfeln und 20 Prozent Birnen gepresst und dann in drei große 3000-Liter-Fässer gefüllt, wo er über Monate gärte. Den eigenen Most hielt man seit alters her für den besten weit und breit. Davon haben täglich alle getrunken, es gab ihn zum Essen, wie bei den Arbeiten auf dem Feld oder im Wald, und erst recht nach Feierabend. Für unterwegs wurde er in eine 5- oder 10-Liter-Gutter gefüllt und mitgenommen. Guttern sind Hohlglasgefäße, die mit unterschiedlichem Fassungsvermögen zur Verfügung standen. Von außen sind sie durch ein Korbgeflecht geschützt, die größeren auch noch mit zwei Henkeln versehen, um sie besser tragen zu können. Im Haus genügte dagegen ein 2-Liter-Steinkrug, der bei Bedarf schnell nachgefüllt war, wenn sie ihn leergetrunken hatten.
Wenn irgendwo möglich, wurde die mitbrachte Gutter draußen auf dem Feld in eines der vielen vom Berg fließenden Gewässer gestellt, so blieb der Inhalt bis zum Trinken kühl und erfrischend. Die Frauen verdünnten ihn gerne mit Wasser, dann stieg er nicht so schnell zu Kopf, denn der Alkoholgehalt ist vergleichbar mit Bier und liegt meist über 5 Prozent. Most war und ist ein ideales Getränk zu jeder Jahreszeit und durfte bei keinem Essen fehlen. Er war sozusagen ein Grundnahrungsmittel. Pures Brunnenwasser aus der Leitung wurde selten getrunken oder nur im Notfall. Das hatte vorrangig hygienische Gründe, denn regelmäßige Trinkwasseruntersuchungen waren noch unbekannt, und Mineralwasser in Flaschen zu teuer, das schenkten üblicherweise nur die Wirtschaften aus. Um also sicher zu gehen, trank die bäuerliche Bevölkerung lieber Most. Böse Zungen behaupten bisweilen, „die Kinder der Schwarzwälder Bauern saugen Most schon mit der Muttermilch.“ Ein bisschen Wahrheit beinhaltete ein hartnäckiges Gerücht: „Die Bäuerinnen gaben den Schnuller in Schnaps und ihn dann den Kleinkindern in den Mund, damit sie schnell und fest einschliefen, und sie dann ihrer Arbeit auf dem Hof und in der Küche in Ruhe nachgehen konnten.“
Bei allen Betrachtungen des Besitzes an beweglicher Habe und unbeweglichen Gütern, Ländereien und Wald, wundert es nicht, dass der Seppe-Michel stolz war auf die gute wirtschaftliche Grundlage seines Hofes, und diese Macht spielte er gerne bei passenden Gelegenheiten aus.
Zu den festen Kräften des Hofes zählen seit Jahren der Knecht Hermann, ein Mann alten Schlages, sehr geduldig, leidensfähig, widersprach nie und verfügte über Bärenkräfte. Sein Credo war: „Ein rechtschaffener Bauernknecht geht bei Tag seiner Arbeit nach und ist abends müde wie ein Jagdhund, damit er auf keine dummen Bossen (Gedanken) kommt.“ Auf der anderen Seite war er witzig und den Freuden des Lebens nicht abgeneigt, war ein Filou, schnell zum Scherzen aufgelegt. Da kam vor, dass er während dem Schlachten einer der Mägde oder anderen die einer Sau entnommene Galle nachwarf – und wenn die platzte, na dann „gute Nacht“, es gibt bestimmt nichts Ekligeres. Oder er verfolgte einen der Hütebuben mit der „Saubloder“ und schlug ihm die getrocknete, luftgefüllte Blase eines Schweins, die mit einer Kordel an einem Stock befestigt war, auf den Kopf oder um die Ohren. Solche „Saublodern“ wurden gerne auch bei der Fasent von den Narren zu Streichen verwendet und als ungefährliche Schlaginstrumente zweckentfremdet. Genau besehen gehörte der Hermann zu einer Spezies Mensch, die von Kindheit an vom harten bäuerlichen Leben geprägt, nun aber vom Aussterben bedroht ist.
Dann waren da noch die fesche Magd Amalie, und die brünette, etwas burschikos wirkende Maria, die es schon länger auf dem Hof aushielten und tüchtig mitarbeiteten. Für Ernten wurden, je nach Arbeitsanfall, zusätzlich mehrere Tagelöhner und Helferinnen – üblich tageweise – eingestellt sowie zwei oder drei zwölf- bis vierzehnjährige Hütebuben, die auf den Weiden nach den Kühen sahen und aufpassten, damit sich keines verlief oder ausbüxte. Wurden im Spätherbst Weihnachtsbäume und im Winter hochstämmiges Holz eingeschlagen, beauftragte der Bauer erfahrene kräftige Männer aus dem Dorf oder aus dem Umland. Diese Spezialisten verdienten ein gutes Geld, denn sie arbeiteten im Akkord. Manchmal bewarb sich auch eine feste Waldarbeiter-Kolonne, die von Hof zu Hof zog. Über Wochen erledigten sie den festgelegten Holzeinschlag, wobei eine große Menge gutes Stammholz zusammenkam. Standen in der Gemeinde saisonal wenig Arbeiten an und sie konnten nicht anderweitig beschäftigt werden, stellte sie unter der Federführung des Försters auch hin und wieder ihre Beschäftigten den privaten Waldbesitzern für Holzfällungen ab.
Beim Michaelishof handelt es sich um ein markant-dominantes Gebäude im traditionellen Schwarzwälder Stil, gebaut aus massivem Mauerwerk mit dem harten Granitgestein der Region. Der langgezogene große Gebäudekomplex mit seitlich rechtwinkligem Anbau trug ein tief hinunter gezogenes Walmdach. Das Gebälk wurde einst mit Tannenholz aus dem eigenen Wald gezimmert. Ebenerdig befinden sich die umfangreichen Stallungen für Kühe, Rinder und ein paar Ochsen. Diese Anordnung war klug durchdacht und hat sich in Jahrhunderten bewährt. Die Tiere geben im Winter Wärme ab, was in den darüber liegenden Räumen wie eine Fußbodenheizung wirkte.
Im anderen Teil der Stallungen standen vier Pferde, davon waren zwei von der robusten Kaltblüter-Rasse, das sind stämmige, kräftige, aber gutmütige Tiere für die schwere Arbeit in Feld und Wald. Im hinteren, hangseitig gelegen Bereich befand sich der Schuppen, in dem Brennholz gesägt und gespalten wurde. Über den Stallungen lagen im vorderen Teil die großräumige Bauernstube, auf einer Ebene mit der Küche und den Vorratsräumen. Im schummrigen Flur hingen links und rechts Rehgeweih-Trophäen an den Wänden, und an der Stirnwand das Geweih eines Sechzehnenders, eines kapitalen Hirschs, der dem Bauern vor Jahren vor die Flinte lief. Dann gab es noch das extra rundum holzgetäfelte Jägerzimmer, in dem ebenfalls Geweihe die Wände zierten. Die ausgestopfte Trophäen eines präparierten Auerhahns, eines Fuchses und ein riesiger Wildscheineberkopf mit furchterregenden elfenbeinfarbenen Hauern vervollständigten das Ensemble. Im hinteren Bereich befand sich das Schlafgemach des Bauern und seiner Frau. Ging man die steile Stiege nach oben, gelangte man zu den dunkel und düster wirkenden Kammern, in die nur spärlich Licht eindrang. Es gab dort noch drei Räume für die Kinder und drei weitere für Knecht und Mägde. Zwei zusätzlich vorhandene Kammern im Seitentrakt standen allgemein leer oder die Bäuerin erledigte darin ihre Bügelarbeiten. Hier hing sie im Winter auch die Wäsche zum Trocknen auf. Und wenn der Schneider oder der Schuhmacher jeder einmal für ein paar Tage auf den Hof kamen, arbeiten und schliefen sie auch in diesen Räumen. Die Kammern auf der oberen Ebene wurden nicht beheizt, waren im Winter kalt, ungemütlich und ziemlich spärlich möbliert. Ein Bett, eine kleine Kommode mit Waschschüssel und ein Hocker oder Stuhl mussten genügen. Ein Haken am Balken einer Wand ersetzte den Kleiderschrank. Die Räume dienten somit fast ausschließlich nur zum Schlafen. Tagsüber oder bis man ins Bett ging, hielten sich alle entweder in der Küche auf oder in der großen Bauernstube, jenen Bereichen, die im Winter beheizt wurden.
Ein Bad gab es nicht im großen Gebäude, und im hinteren Bereich befand sich nur ein Plumpsklo als Toilette. Mehr Komfort wäre reiner Luxus gewesen und wurde auch von niemanden vermisst. Wer tagsüber mal „musste“ und im Stall war, hockte sich dort hin, und während der Arbeit auf dem Feld, suchte man einen Busch oder ging hinter einen Baum. Dabei taten sich nur die Männer leichter. Die Frauen trugen noch lange Röcke, allerdings keine Unterwäsche. Wenn sie Erleichterung suchten, gingen sie in die Hocke und breiteten kurzerhand den Rock aus. Wer in der Nacht einen Drang verspürte, der benützte den Botschamber (Nachttopf), der sich unter jedem Bett befand. Morgens wurde der Inhalt dann im Hof auf dem Misthaufen am Haus entleert.
Für die tägliche kleine Wäsche stand in jeder Kammer eine Waschgarnitur mit großem Sanitärkrug in einer Schüssel, dabei noch ein Wasserglas zum Zähneputzen. Und sonst reinigte man sich in der wärmeren Zeit mit fließendem Wasser am Brunnen im Hof. Wer sich warm waschen wollte, setzte sich in der ebenerdig im Anbau befindlichen Waschküche in einen Zuber und benützte heißes Wasser vom Herdschiff und noch mit einer eventuell zusätzlichen Menge aus einem auf dem Herd erhitzten großen Kessel. Mehr brauchte es nicht. So reinlich war man in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts nicht. Wer mehr wollte, ging in die Schulgebäude im Dorf und in der Kolonie, wo sich öffentliche Volksbäder befanden, was aber für die Leute des Michaelishofes viel zu weit entfernt lag.
Der zweiten Ebene schließt sich unter dem großen Dach die Tenne an, auf der gearbeitet wurde, wo man Heu vom Wagen entladen hat und auf den Heuboden schaffte. Vom Heuboden aus führte ein Wurfschacht direkt hinunter in den Stall, sodass von der „Bühne“, wie man im Schwarzwald sagt, das Heu fürs Vieh direkt bis in den Stall hinunter fiel. Auf der Tenne standen drei hölzernen Leiterwagen mit eisenbeschlagenen Rädern, wenn sie nicht im Einsatz waren. Dazu gab es diverse Gerätschaften wie ein Heuhäcksler, Strohschneider, Rübenschnitzler und mehr. Auf diese Weise war sichergestellt, dass auch bei Regen trocken abgeladen und die Arbeiten verrichtet werden konnte. Hier wurde nach der Ernte das Stroh gedroschen und gehäckselt (kurz geschnitten).
In Distanz zum stattlichen Hofgebäude lag die sogenannte Brunnenstube, ein aus Stein gemauert Häuschen mit Ziegeldach, passend zum Stil der Umgebung. Das hatte im Innern einen gemauerten Wassertrog, der aus dem eigenen Brunnen von der oberhalb sprudelten Quelle gespeist wurde. Das ständig fließende kühle Bergwasser ermöglichte es der Bäuerin, ihren Vorrat an Butter und Bibbeleskäs (Quark mit Zwiebeln und Schnittlauch) sowie diversen anderen Lebensmitteln frisch zu halten. Im Wasser standen meistens auch zwei oder drei Milchkannen. So wurden die Lebensmittel auf natürliche Weise lange kühl und haltbar aufbewahrt.
Ein massives Backhäusle aus Stein mit großer gusseiserner Ofenklappe, ergänzte das Gebäudeensemble. Dies wiederum gehörte zum ureigenen Reich der Bäuerin. Hier backte sie vierzehntäglich nach alter Tradition und überlieferten Rezepten den Bedarf an Holzofenbrot. Das Mehl dafür stammte wiederum aus dem eigenem Anbau. Gemahlen wurde es in einer der Mühlen im Dorf und ein Teil in Vögele´s Mühle in Steinach. Hinter dem Backhaus befand sich der eingezäunte Hühnerstall mit zwei Hähnen und im Schnitt fünfundzwanzig Hennen, die den Eierbedarf des Hofs decken. Was davon erübrigt werden konnte, wie auch Butter aus eigener Herstellung, lieferte die Bäuerin der Heilstätte in der Kolonie an. Die Menagerie des Hofes komplettierten mehrere Katzen und der, die meiste Zeit an einer Kette gehaltene Hofhund.
Auf der Südwestseite des Hofes schloss sich der im bäuerlichen Stil angelegte große Garten an, in dem vom Frühjahr bis in den Herbst die Bäuerin mit Töchtern oder den Mägden werkelte. In den gepflegten Blumenbeeten fanden sich die gängigen Kräuterlein, wie Peterle (Petersilie), Schnittlauch, Sellerie und mehr sowie allerlei Gemüse. Alles was das Jahr über in der Küche benötigt oder verarbeitet wurde, pflanzten sie selber an. Dazu zählten Gelbe Rüben (Karotten), Kohlrabi, Sellerie und Pastinaken. Die Erbsen wuchsen kletternd am dürren Reißig empor und die Schoten wurden teils grün gezupft, der andere Teil trocknete in den Schäfen (Hülsen) und wurden später ausgepult. Bei den Bohnen, landläufig „Saubohnen“ genannt, war es ähnlich. In Zweierreihen standen lange Stangen, an denen die Bohnenranken emporwuchsen. Etwa ein Drittel wurde grün gepflückt, der Rest der Hülsenfrüchte reifte in den Schoten, bis die Bohnen entnommen werden konnten und in einem Schüttgutsieb weiter trockneten. Verschiedene Salatsorten wurden den Sommer über gezogen, bis hin zu den unterschiedlichsten Krautsorten. Gemüse wurde so gut wie nie zugekauft. Die Kraut- und Salatköpfe entwickelten sich stets prächtig und den Sommer über auch Radieschen, Kohlrabi, Blumenkohl, Gurken und vieles andere Gemüse. Was gepflanzt wurde, das gedieh prächtig. Sogar im Winter gab es ausreichend winterhartes Gemüse zu ernten, wozu Rüben, Grünkohl, Wirsing, Lauch und Rosenkohl zählte. Die Bäuerin schien wohl einen „grünen Daumen“ zu haben. Der gute Ertrag hing sicher aber auch mit der speziellen Düngung zusammen, denn sie verwendete Pferdeäpfel und Steinmehl als Mineraldünger.
Ergänzt wurden die Vorräte mit im Herbst eingestampftem Sauerkraut, das lange haltbar war und überwiegend im Winter auf den Tisch kam, wenn es an anderem Gemüse mangelte. Dafür kaufte die Bäuerin zwei oder drei Zentner Spitzkraut, das ein Händler von den Fildern bei Stuttgart im Herbst auf den Hof anlieferte und gleich hobelte. Es musste nur noch in einem Holzfass eingelegt werden, wo es mit Steinen beschwert reifte. Die Bäuerin servierte das vitaminreiche Sauerkraut gerne mit Kartoffelschnitz oder Kartoffelbrei (Püree). In den Wochen nach der Hausschlachtung wurde es mit frischen Blut- und Leberwürsten, Rauchwurst und Kesselfleisch auf den Tisch gebracht. So ein Essen war delikat, deftig, sättigend und es schmeckte ausnahmslos allen am Tisch.
Das Ehepaar Josef Michel – Sepp genannt – 56 Jahre alt, und seine Frau Affra, eine geborene Bruder, hatten drei Kinder. Die Bäuerin war fünf Jahre jünger als ihr Mann, von Statur war sie eher klein und ein wenig rundlich, mit gutmütigem Wesen, dazu blitzgescheit, geduldig und sehr belastbar – um es nicht „leidensfähig“ zu nennen. Das war bei ihrem Mann auch bitter nötig, wenn es nicht jeden Tag Streit und Zwistigkeiten geben sollte, denn er war ein echter Schwarzwälder Dickschädel und Sturkopf. „Die Klügere gibt nach“, sagte sie gerne, ohne dabei devot zu wirken. Nein, unterwürfig war sie nicht, sie setzte nur gerne ihren Willen auf unspektakuläre Weise durch. Sie entstammte einem Hof im Ernsbach, einem Seitental draußen im Dorf. Die Eltern der Affra waren aber beide schon vor Jahren verstorben, ihr jüngerer Bruder hatte den Hof bekommen und bewirtschaftete ihn. Vier weitere Geschwister, zwei Brüder und zwei Schwestern haben in andere Höfe eingeheiratet oder waren Handwerker geworden. Beide Brüder und die Schwester waren Getti und Gotte (Paten) der Kinder vom Michaelishof.
Von den drei Kindern war der Sohn Johann – „Hannes“ – mit 16 Jahren der ältere. Knapp zwei Jahre war er nun schon bei Albert Ritter in Zell am Harmersbach in der Schlosserlehre. Die kleine Firma, 1924 gegründet, war ein junges aufstrebendes Unternehmen. Es betrieb eine mechanische Werkstätte, fertigte landwirtschaftliche Maschinen und Geräte und verkaufte sie selbst oder vertrieb sie über Händler. Damit Hannes nicht täglich den weiten Weg mit dem Fahrrad zum Arbeitsplatz hin und zurückfahren musste, wohnt er die Woche über bei Kost und Logis im Betrieb. Erst samstags nach Feierabend fuhr er heim, denn am Samstag war damals bis Mittag noch ein normaler Arbeitstag. Demzufolge konnte er normalerweise nur samstagnachmittags und am Sonntag zu Hause bei den Eltern und seinen Schwestern weilen. Im Winter, wenn es zu kalt war, die Straße gar schneebedeckt und glatt, fuhr er nicht mit dem Fahrrad zur Arbeitsstelle sondern mit dem Linienbus nach Zell.
Dass er wochentags auswärts wohnte, war ganz gut so, denn der Hannes befand sich als junger Bursche in einer schwierigen Phase, war aufmüpfig und störrisch, genauso dickköpfig und stur wie sein Vater. Und wenn ständig zwei solche Querköpfe aufeinander treffen, geht das nie gut. So wie es nun war, kam man sich seltener ins Gehege und der Sohn konnte charakterlich reifen. Die Wochenenden erwiesen sich da weniger problematisch, sie gingen sonntagmorgens erst in die Kirche und der Vater anschließend ins Gasthaus „Adler“ unten im Tal, oder in eine der Wirtschaften draußen im Dorf. Saß dann der Bauer am Stammtisch, wurde es in der Regel spät, bis er sich auf den Heimweg bemühte. Die restliche Zeit brachte man gut und ohne Dissonanzen rum. Im Gegenteil, oft konnte der Vater einen guten Rat geben und redete auf Augenhöhe mit seinem Sohn. Dem tat dies gut, er fühlte sich erwachsen und ernst genommen. Und selber hatte er zu Gerätschaften und Neuanschaffungen auch manch eine nützliche Idee.
Zur Familie gehörten außer Hannes zwei Mädchen, die Cecilia war gerade 13 und Margarete, das Küken, zählte 12 Lenze. Beide gingen in die Volksschule im Hintertal, gegenüber dem Gasthaus „Adler“. Schule und Gasthaus trennt die Nordrach, das rauschige Flüsschen das talwärts fließt und die Fahrstraße in die Kolonie. Die kleinere von zwei Nordracher Schulen diente allen Kindern, die ab der Grenze Rühlsbach von weiter draußen kamen, sowie denen aus der Kolonie. Wer weiter vorne im Tal wohnte, besucht die größere Schule im Dorf, nahe der Kirche und dem Friedhof. Die Mädchen hatten täglich hin und zurück gut eine Stunde Fußweg. Eine besondere Herausforderung bedeutete dies allerdings nicht, denn wer es von Kindesbeinen an gewohnt ist, steil bergauf und bergab laufen zu müssen, ist naturbedingt bei guter Kondition. Dazu gab es, je nach Jahreszeit, allerhand Abwechslungen links und rechts des Weges. Sie begegneten Tieren, erfreuten sich an bunten Blumen und flochten sich davon Kränze ins Haar. Wenn der Löwenzahn blühte, ließen sie die Pusteblumen im Wind fliegen und vergaßen fast die Zeit. Blödsinn machen, Streiche aushecken, gehörte mit dazu und machte den Schulweg kurzweilig.
Der Hofbauer pflegte nebenbei leidenschaftlich sein Hobby, die Jägerei. Im Licht besehen war das längst mehr als ein Hobby, denn die Erlöse aus den Treibjagden ergaben, übers Jahr gerechnet, ansehnliche Einnahmen durch verkauftes Wildbret. Wenn es seine Zeit zuließ, dann saß er nächtelang auf einem der Hochsitze seines Reviers und hielt nach jagdbarem Wild Ausschau. Mehrmals im Jahr wurden Kollegen aus dem weiten Umkreis zu Treib- und Drückjagden eingeladen, bei denen stets eine beachtliche Strecke anfiel. Leider wirkte sich aber sein negativer Ruf aus, und es kamen nie so viele, wie er es gerne gehabt hätte. Trotzdem erzielte der Verkauf von Hasen, Rotwild und Wildschweinen hohe Summen, und sie füllten ihm zudem die eigene Vorratskammer.
Wer objektiv die Größe des Hofes, dessen Bedeutung und die vielseitigen Erträge betrachtete, konnte durchaus der Meinung sein, der Seppe-Michel könne es sich locker leisten, die vom Wild seines Reviers verursachten Schäden ohne zu lamentieren großzügig auszugleichen. Nur war er leider nicht nur krankhaft stur und eigenwillig, sondern auch ausgesprochen geizig. Zudem spielte noch etwas anderes eine entscheidende Rolle, es ging ihm einfach gegen den Strich nachzugeben. Wenn er sich tatsächlich einmal darüber äußerte, dann begründete er seine Verweigerungshaltung lapidar so: „Aus Prinzip nicht“. Sämtliche Ansprüche empfand er als Angriff auf seine Ehre, seine Person, und sowas konnte er „ums Verrecke“ nicht leiden. Sich direkt mit ihm anlegen, das getraute sich keiner, denn mit 1,96 Meter war er ein Hüne im Vergleich zur damals durchschnittlichen Männergröße von allgemein um die 1,60 Meter. Und es war nicht nur die Körperlänge, auch seine massige Statur flößte Ängste ein. Er zeigte sich schwergewichtig, wo er auftrat wirkte er kraftvoll, beherrschend und dominierend, das verschaffte ihm Respekt. Nur eine staatliche Autorität getraute sich ihm Paroli zu bieten. Doch selbst von dieser Seite ließ sich der Bauer ungerne etwas sagen, und er konnte unangenehm aufbrausend reagieren. Wenn ihm etwas nicht passte, wurde er cholerisch, wütend und schäumte wie ein Stier.
Dieses Bild zog dem Förster durch den Kopf, während er sich mit seinem an der Leine laufenden Dalmatiner-Hund immer mehr dem Hof näherte. Beim Betreten des Hofgrundstücks war er sehr darauf bedacht, dem an der Kette zerrenden, giftig bellenden Hofhund nicht zu nahe zu kommen. Schnell wischte er sich noch den Schweiß von der Stirn und befahl seinem Hund, „sitz, gib Ruh“. Dann machte er sich lautstark bemerkbar. Der Haustüre nähern, das getraute er sich nicht, denn bis dorthin bewegte sich zähnefletschend der Mischlingsrüde, der ihn verbellte und eindeutig zeigte: „Hier ist mein Revier“, da wollte der Förster lieber weder sich noch seinen Hund gefährden.
Die Bäuerin, die ihr Haar traditionell mit einem Sammetbändel (Schlaufe aus Seide) gebunden trug, sowie eine Schürze um den rundlichen Bauch gebunden hatte, öffnete die Türe. Der Förster verkniff sich das Lachen, denn die Frau war „türfüllend“. „Ja, Bildstein-Frieder, du kummsch widder emol uns z‘bsuche. Was hesch uff’m Herz?“ „Ist der Bauer zuhause, Affra?“ „Nei, nei, der isch mit’em Knecht un d‘Magd Maria im Holz, obe’am Heidebühl. Sie moche Wellen (gebündeltes Brennholz) un welle späder noch‘ d‘Bäum gugge, die im Winter g‘schlage wäre solle.“
„Der Kuttelrainer-Xaveri, der Heiner-Bur und Schwarze-Wilhelm wie ein weiteres halbes Dutzend Bauern haben sich wiederholt massiv bei mir beschwert, weil Wildschweine aus eurem Revier ihre Felder verwüsteten. Im Sommer ist schon hoher Schaden beim Getreide entstanden und nun auch bei den Rossherdepfeln (Topinambur). Sie wollen vom Bauer dafür entschädigt werden, und der stellte sich bisher stur, beschimpfte alle stattdessen und verweigerte die Anerkennung sämtlicher Forderungen. Richte deinem Mann bitte von mir aus, das geht so nicht, er soll sich entweder direkt mit seinen Nachbarn in Verbindung setzen und die Sache gütlich klären, oder mit mir reden, damit wir eine akzeptable Lösung finden. Den Geschädigten steht ein Schadensausgleich zu.“ „Ja, Frieder, du weißt ja wie der Sepp ist, wenn‘s an seinen Geldsack geht, da kennt er nix, da dreht er hohl, da benimmt er sich wie ein sturer Esel.“ „Ich kenne ihn, aber wenn die Sache vors Amtsgericht in Gengenbach kommt, dann wird es für ihn viel teurer, und ich muss Meldung machen, wenn sich nichts in Richtung Einigung tut. Dann steht er vor dem Richter. Also nochmals, es ist fünf vor Zwölf, er soll sich bei mir melden oder gleich im Forsthaus vorbeikommen und die Sache nicht auf die lange Bank schieben. Das meine ich ernst.“ „Isch gued, Bildstein-Frieder, i’sag’ims un hoff, er kummt nit arg’schlecht g’launt heim.“ Sie wusste genau, um ihrem Mann eine unangenehme Botschaft zu übermitteln, musste sie den rechten Zeitpunkt abwarten, sonst drohte ihr, der Blitzableiter zu sein.
Schon länger lebten sie mehr schlecht als recht zusammen. Sie war von der harten Arbeit abgeschafft, und noch eine andere Sache spielte eine Rolle, die Bäuerin war wegen ihrer Körperfülle nicht mehr beweglich genug und konnte vielfach nicht mehr mithalten. Deshalb kam sie nur noch wenig aus dem Haus. Ihr Reich war die Küche, die Backstube und ihr sehr gepflegter Bauerngarten beim Hof und da waren noch ihre Hühner. Nur sonntags fuhren sie gemeinsam mit der Kutsche in die Kolonie zur Messe in der kleinen St. Nepomuk-Kapelle bei der Heilstätte, oder gleich hinaus ins Tal und gingen dort in die Dorfkirche.
Ursprünglich wurde die Kapelle in der Kolonie für die weit vom Dorf lebenden Bauern und Arbeiter der Glasfabrik errichtet und dem heiligen Nepomuk geweiht. Eine Besonderheit ist, während der Grundstein die Jahreszahl 1904 trägt, weist der über dem Eingang der neuen Kapelle angebrachte Türsturz die Jahreszahl 1776 aus. Das alleine weckt schon Interesse und macht sie sehenswert. Hintergrund ist, die Glaserkirche am früheren Standort soll einst aus den Resten der ehemaligen Mühlsteinkapelle errichtet worden sein. Nach Umsiedlung der Glasfabrik ins Tal wurde auch diese Kapelle 1776 neu aufgebaut, und auf deren Fundamenten wiederum entstand im Jahre 1904 der Neubau der heutigen Kapelle. Somit darf man annehmen, das Gotteshaus hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Die Kapelle ziert ein kleiner Glockenturm, und eine weitere Glocke befindet sich im Glockenturm auf dem Schulhaus, draußen im Tal. Das helle Läuten beider Glöcklein war weithin hörbar und diente der Bevölkerung zur Zeitorientierung. Geläutet wurde morgens um elf Uhr. Arbeiteten die Bäuerinnen auf dem Feld oder im Garten, gingen sie spätestens dann ins Haus und bereiten das Mittagessen vor. Später läutete die Betzeit-Glocke abends um sieben (19 Uhr), das war ein Signal für den Feierabend auf den Feldern. Sonst läutete die Glocke der St. Nepomuk-Kapelle zur anstehenden Messe, ebenso als Toten-Glöcklein, wenn ein Bürger im Hintertal gestorben war.
Waren der Bauer und seine Familie vom Tal auf dem Nachhauseweg, trennten sich meistens schon unten ihre Wege. Während die Affra mit den Kindern die Pferde direkt dem Hof zu lenkte, besuchte der Seppe-Michel das am Weg liegende Gasthaus „Adler“, wo er am Honoratioren-Stammtisch Platz nahm. Lautstark und gestenreich wurde hier hohe Weltpolitik betrieben. Dauerthema war die schlechte wirtschaftliche Lage Deutschlands und insbesondere im Nordrachtal, wo es – außer der Heilstätte und drei Lungensanatorien draußen im Tal – nur Bauern, sechs Sägewerke und einige Handwerker gab, aber keine Industrie, die Arbeitsplätze bieten konnte. Wer nicht in der Landwirtschaft arbeitete, hatte weite Wege zu den Prototyp-Werken in Zell am Harmersbach, zur Zeller Keramik, in die Zeller Papierfabrik oder zur Polstermöbelfabrik Hukla nach Gengenbach.
Nur wenige Nordracher fuhren schon ein Motorrad, und Autos fanden sich noch spärlicher. Zwar verkehrte morgens und abends der Linienbus, den Arbeitern passten aber kaum dessen Fahrzeiten. Die Mehrheit war stattdessen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Für die Radfahrer war es mühevoll und beschwerlich, denn wer weiter oben an den Talhängen oder auf der Höhe wohnte, musste bei den Steigungen schieben und konnte allenfalls bergab fahren. Die Situation in den Wintermonaten erwies sich durch Schnee und Eis noch um einiges schwerer.
Der Bauer nahm eines Sonntags am Stammtisch Platz und klopfte zuvor, zur Begrüßung, dreimal mit den Fingerknöchel auf den Tisch. Der Echtle-Säger und andere saßen schon da, die Buren von der Haberitti und dem Stollengrund kamen später hinzu. Der Echtle-Säger betrieb hundert Meter talwärts ein Sägewerk. Als eines der ersten schaffte er ein Vollgatter an, und nützte damals schon die Wasserkraft der Nordrach, wie viele Sägemühlen oder andere Mühlen an den Gewässern des Schwarzwaldes. Seit zwei Jahrzehnten hatten sich kleine Wasserkraftwerke durchgesetzt, weil die Mühlen unmittelbar an Wasserläufen angesiedelt sind. Die Wasserkraft konnte diverse Aggregate treiben und lieferte einigen Häusern in der Nachbarschaft elektrischen Strom.
„Ja Seppe-Michel, was ziehsch widder für‘e Lätsch (Mund – Grimasse) no?", wurde er empfangen. „Losst‘mi in Ruh, d’Kirch isch‘mer widder z’long gonge und mini Aldi hett mi au‘no uffgregt un het’mi gnervt“, gab er missmutig zur Antwort (lass mir meine Ruhe, die Kirche ging zu lange und meine Frau ging mir auf die Nerven). „Kumm Kreszenz“, bring’mer schnell e‘Glas Bier un’e Schnaps, damit mini Launi sich bessert“, wandte er sich mit befehlendem Unterton an die Bedienung. „Jo, jo, d’Bure henns scho saumäßig schwer, vor allem, we’mer so viel Geld im Sack het wie du.“ (Ja, die Bauern haben es schon schwer, besonders, wenn man so viel Geld besitzt wie du) „Kumm go‘weg mit dinem Gwätz, Säger, du nagsch au nit am Hungerduch, du jommer’sch doch nur, dass nägschdens widder bim Holzkauf richtig fuggere konnsch.“ (Komm hör auf mit deinem Gerede, Säger, du nagst auch nicht am Hungertuch und jammerst doch nur, damit du demnächst beim Holzeinkauf wieder feilschen kannst). „I‘sag jo nix, un sell wärr‘i no sage derfe“. (Ich sage ja nichts, und das werde ich noch sagen dürfen), gab der zurück. Die Sitzungen im „Adler“ konnten sich manchmal sehr in die Länge ziehen. Dann fiel das Mittagessen zu Hause flach, stattdessen ließ sich der Bauer im „Adler“ eine Portion saure Nierle oder Kutteln mit Bratkartoffeln bringen. Bis er sich aufraffte und bergwärts heim schritt, konnte das Stunden dauern. Natürlich hat ihn seine Affra dann entsprechend „freundlich“ empfangen und giftete: „Hesch widder eine pfetze (trinken) muese, hesch widder richtig Sitzfleisch gho, was Alder?“ „Loss‘mi in Ruh, i‘leg mi jetzed e‘Stündli no un donn kümmer i‘mi um min Sach“, gab er meist mürrisch zurück. Wenn er sich dann Stunden später wieder blicken ließ, war das kein Thema mehr. Er setzte sich in die Stube, während manchmal seine Töchter oder Hannes reinschauten, und es etwas zu bereden gab. Kam dann noch der Knecht hinzu und eine oder beide Mägde, wurden bei Most und diversen Schnäpsen, die Arbeiten der kommenden Woche besprochen. Hinterher zogen sich alle in ihre Kammer zurück. Früh um vier oder fünf, war die Nacht vorbei und vor allen lag eine arbeitsintensive Woche.
Gasthaus „Adler“ – früher mit Nebensaal, da wo jetzt der Garagenanbau ist – weiter oben sieht man eines der Gehöfte im Bärhag
Forsthaus Kolonie
2
Auf geschichtsträchtigen Wegen
Der Förster verließ unzufrieden doch entschlossen das Hofgelände. Lieber wäre es ihm gewesen, er hätte den Bauern direkt angetroffen, die Sache gleich positiv klären können, seinem Wunsch entsprechend und möglichst im Sinne seiner Auftraggeber, das heißt dem Gesetz und allgemeinen Brauch nach auf den rechten Weg gebracht. So musste er sich mit der halbfertigen Sache weiterhin beschäftigen, wie wenn er nichts anderes zu tun hätte. Aber alles Grübeln nützte nichts, er musste weiter ziehen, wobei er hundert Meter vom Hof seinen Hund frei laufen ließ.
Während er zügig bergwärts schritt, kam er kurz darauf zu einem Bildstock am Waldrand, der an den einstigen Vogtsbauern Anton Muser vom Mühlstein erinnert. Der stolze Bauer verlor genau an diesem Platz auf tragische Weise sein Leben. Wie Heinrich Hansjakob, der Heimatschriftsteller und „Rebell im Priesterrock“ – wie der Pfarrer von Haslach im Kinzigtal auch genannt wurde – im Buch „Der Vogt auf Mühlstein“ anschaulich schildert, hatte der Vogt seine bildschöne Tochter Magdalena dem reichen und einflussreichen Hermesbur versprochen, obwohl das Mädchen innig einen anderen liebte. Die Magdalena verweigerte sich ihrem angetrauten Mann, trotz Schlägen des Vaters und ihres Mannes. Nur wenige Wochen nach der erzwungenen Hochzeit und noch bevor die Ehe im Bett vollzogen war, soll sie an gebrochenem Herzen gestorben sein, weil sie den „armen Schlucker“ Hans Öler, den sie seit langem innig liebte, und mit ihm von Jugend an beim Gesang im Duett auftrat, nicht hatte heiraten dürfen.
„Die Magdalena war – der Schilderung nach – die einzige Tochter des Vogts und mächtigen Bauern auf dem Mühlstein. Sie soll das schönste Mädchen weit und breit im Tal gewesen sein. Noch schöner klang ihre Stimme, einer Nachtigall gleich, und wenn Magdalena zusammen mit ihrem Hans im Duett sang, war das wie der Himmel auf Erden.“
(Die ganze Geschichte unter: www.vogt-auf-mühlstein.de)
Erst nach dem Tod seiner geliebten Tochter sah der Vogt seinen gravierenden Fehler ein, den er begangen hatte und trauerte unendlich. Ehrliche Reue und Selbstvorwürfe trieben ihn danach rastlos umher. Um Trost und Ablenkung in seinem Leid zu finden, wollte er eines Abends seinen Sohn im Bärhag besuchen und war auf dem Weg in den Stollengrund. Es war in der Winterzeit, und etwa einen Kilometer oberhalb des Hofes rutschte der Vogt unglücklich auf einer vereisten Platte aus. Hinterher gelang es ihm nicht mehr aufzustehen und niemand hörte seine verzweifelten Hilferufe. So ist der Arme in der eisigen Nacht erfroren und erst morgens fanden sie ihn tot vor. Nun berichtet ein Kruzifix an dieser Stelle von dem tragisch-traurigen Ereignis und mahnt den Wanderer, niemals das Glück anderer zu zerstören.
Nachdenklich hielt der Förster kurz an dieser Stelle inne. Diese Geschichte war ihm gut geläufig, dann besann er sich, denn er musste weiter. Er rief seinen Hund zu sich her und ging am bewaldeten Täschenkopf vorbei zu den Flacken. Das war sein nächstes Ziel, dann wollte er weiter zum Mühlstein. Er beeilte sich, denn bis zum Gewann Flacken lag noch gut eine Stunde Wegstrecke vor ihm. Der Mühlstein liegt von dort aus einen Kilometer etwas unterhalb der Flacken und dem Haldeneck. Die Hochfläche ist der waldfreie Übergang in die Schottenhöfen, und von dort gelangt man talwärts nach Zell ins Harmersbachtal. Die freie Landschaft offenbart sich dem Betrachter wie im Bilderbuch. Inmitten von Obstbaumwiesen, Feldern und Weiden finden sich verstreut stattliche Höhenhöfe, die geschichtlich schon im Jahre 712 nach Christus erwähnt wurden. Die bewaldeten Bergkuppen ringsum schienen dem Betrachter von hier aus zum Greifen nahe zu sein.