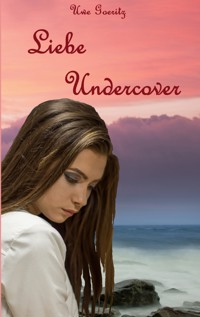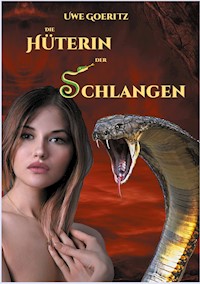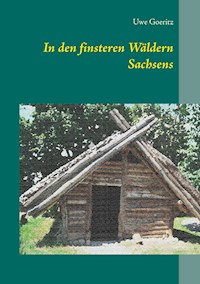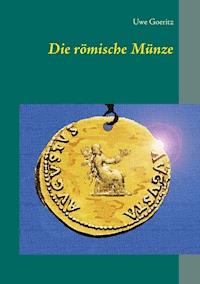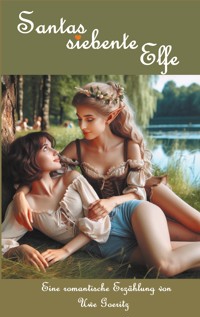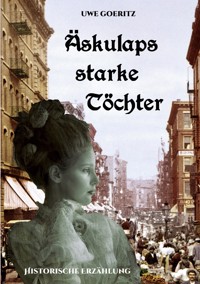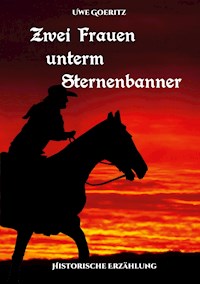2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Eine sächsische Revolution" Altersempfehlung: ab 16 Jahre In den Jahren 1848 und 1849 ist auch in Sachsen Revolution! Für jeden der Beteiligten dieser Geschichte ist diese Revolution aber etwas anderes. Für Maria, die Magd, ist es das freundschaftliche Verhalten ihrer Herrin Clara ihr gegenüber. Clara hingegen rebelliert gegen die Unterdrückung durch die Obrigkeit und ihren strengen Mann. Und für Heinrich, den Schmied, ist es die Industrialisierung Sachsens. Dampfmaschinen und Lokomotiven bestimmen zunehmend den Alltag. Alle drei stehen an einem Wendepunkt und bemerken es erst, als es für sie fast zu spät ist. In den Wirren der Kampfhandlungen zwischen die Fronten geraten, müssen sie um ihr Überleben kämpfen. Gleichzeitig kämpfen sie für den Fortschritt, für Menschenrechte und für Frauenrechte. In einer Zeit, in der Frauen nichts zu sagen haben, engagiert sich Gräfin Clara zunehmend für die rechtlosen Arbeiterinnen und stellt sich damit gegen Familie und Öffentlichkeit. Die weiteren Bücher in dieser Reihe, erschienen im Verlag BoD, finden Sie unter www.buch.goeritz-netz.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Eine sächsische Revolution
Der glühende Atem
Teuer erkaufte Zukunft
Kaffee und Gespenster
Die Chance einer Möglichkeit
Menschenleben
Apfelkuchenträume
Hassliebe
Mägdezeit
Doppelschichten
Lohn des Schweißes
Michelangelos David
Drei Mädchen
Am Hungertuch
Unter Druck
Engelsgleich
Rosen aus Stahl
Ein Gefühl puren Glücks
Gefunden ohne zu suchen
Frauenseelen
Zwei Bräute
Das Schicksal eines Rappen
Die Lüge einer Dienstmagd
Ordnung im Chaos
Trotzkopf und Raufbold
Ohne Rücksicht auf Verluste!
Angst und Mut
Glückauf!
Schwarzer Schnee
Dampffahnen
Frauendinge
Eine verhängnisvolle Bitte
Dem Tode so nah!
Verkaufte Seelen, verkaufte Körper
Frauenschicksale
Im Zorn
Mit vertauschten Rollen
Tumult im März
Männer und Frauen
Sommerwind
Ängste und Gewalt
Hilfe in der Not
Freundinnen?
Bankgeschäfte
Die treue Zofe
Fünfundzwanzig Silberlinge
Rache oder Liebe?
In letzter Minute
Wilde Flucht
Entwischt?
Liebesnot und Freiheitsdrang
Wilde Pferde
Noch eine Revolution?
Schaufelräder und Dampfsäulen
Ein schneller Ritt
Barrikadenkämpfe
Im Pulverdampf
Segen und Fluch
Ängste und Träume
Die Nadel im Heuhaufen
Im Rausch der Geschwindigkeit
Bittersüße Schokolade
Neue Träume
Das leidige Geld
Neue Hoffnung, neue Furcht
Mausetage
Männergespräche
Ein Wald auf dem Wasser
Große und kleine Schiffe
Rattenwege
Weite Wasser
Kind oder Geld
Goldene Zukunft
Zeitliche Einordnung der Handlung:
Eine sächsische Revolution
In den Jahren 1848 und 1849 ist auch in Sachsen Revolution! Für jeden der Beteiligten dieser Geschichte ist diese Revolution aber etwas anderes. Für Maria, die Magd, ist es das freundschaftliche Verhalten ihrer Herrin Clara ihr gegenüber. Clara hingegen rebelliert gegen die Unterdrückung durch die Obrigkeit und ihren strengen Mann. Und für Heinrich, den Schmied, ist es die Industrialisierung Sachsens. Dampfmaschinen und Lokomotiven bestimmen zunehmend den Alltag.
Alle drei stehen an einem Wendepunkt und bemerken es erst, als es für sie fast zu spät ist. In den Wirren der Kampfhandlungen zwischen die Fronten geraten, müssen sie um ihr Überleben kämpfen. Gleichzeitig kämpfen sie für den Fortschritt, für Menschenrechte und für Frauenrechte. In einer Zeit, in der Frauen nichts zu sagen haben, engagiert sich Gräfin Clara zunehmend für die rechtlosen Arbeiterinnen und stellt sich damit gegen Familie und Öffentlichkeit.
Die handelnden Figuren sind zu großen Teilen frei erfunden, aber die historischen Bezüge und Ereignisse sind durch Dokumente und Überlieferungen belegt.
1. Kapitel
Der glühende Atem
Mit einem Krachen schlug der schwere Dampfhammer zu. Der Hallenboden bebte und Heinrich hatte alle Mühe, das Eisenstück mit der langen Zange festzuhalten. Immer und immer wieder schlug der Hammer von oben herab und dabei dachte der Mann daran, wie sein Großvater noch mit Hammer und Amboss kleine Eisenstücken zu Hufeisen geschmiedet hatte. Damals, im heimatlichen Dorf, war alles noch Handarbeit gewesen, hier übernahm die Maschine fast die ganze Tätigkeit. Nur festhalten, kontrollieren und herausnehmen des glühenden Eisenstückes waren noch Handarbeit.
Er arbeitete nun schon einige Jahre in der Firma „Götze & Hartmann“ in Chemnitz. Heinrich war fünfundzwanzig und der beste Arbeiter des Werkes. Selbst der Meister und die Ingenieure suchten seinen Rat, denn mit Eisen kannte sich keiner so gut aus, wie er. Friedrich vielleicht noch, der kleine Schmied, der neben ihm an einem kleineren Hammer stand. Es war das Jahr 1847 und der Direktor, der Herr Hartmann, plante, aus dieser Schmiede ein Maschinenbauunternehmen zu machen. Dafür entstanden gerade einige neue Hallen auf dem Firmengelände, diese waren viel geräumiger, als diese ersten zwei Häuser. Der Direktor wohnte auch direkt nebenan in einem Haus, das durch einen kleinen Garten von den Hallen getrennt war. Nicht so, wie die vielen anderen reichen Familien, die am anderen, besseren Ende von Chemnitz wohnten.
Durch den dröhnenden Lärm der Hämmer hörte er Fritz aufgeregt etwas rufen. Es klang nach dessen breitem Dresdner Dialekt, das hier kaum einer verstand, weswegen sich Fritz angewöhnt hatte, das beste hochdeutsch zu sprechen, das Heinrich jemals gehört hatte. „Gugge hier!“, hörte er wieder und stoppte seinen Hammer, indem er den Auslöser losließ. „Was ist?“, brüllte er die zwei Schritte hinüber und Fritz sah zu ihm herüber. „Dieser Junge macht mich noch verrückt!“, brüllte er zurück und zeigte auf einen sicher erst vierzehnjährigen Hilfsarbeiter. „Der hat seine Hände immer da, wo er sie nicht haben sollte!“, brüllte Fritz weiter und Heinrich zog wieder den Auslöser. Ein Dampfstrahl schoss aus dem Hammer, der sich wieder dröhnend in Bewegung setzte.
Erneut wackelte der ganze Fußboden und Heinrich konnte sich kaum vorstellen, wie das die Familie des Direktors wohl aushielt. Jeden Tag diese Erschütterungen zu erleben, das war nicht mal für ihn etwas. Wie sollten da Frauen und Kinder damit umgehen? Ein Schrei ertönte und Heinrich zuckte zurück. Der Hammer stand und die meisten anderen auch. Schlagartig war Stille in der Halle, bis auf das Schreien. Der Junge hing mit einem Arm in der Führungsbahn des kleinen Hammers. „Jetzt haben wir die Bescherung!“, brüllte Fritz und fing den umkippenden Jungen auf. Ein blutiger Stumpf war das, was noch vor ein paar Augenblicken eine Hand gewesen war. Zu zweit banden sie den blutenden Arm ab.
Einer der Ingenieure und der Meister kamen gelaufen, um zu sehen, was wohl passiert war. Der Ingenieur wurde kreidebleich und musste sich übergeben. Heinrich nahm den Jungen auf die Arme, trug ihn aus der Halle und legte ihn auf die schmutzige Wiese vor der Hallentür. Ein Arzt kam gelaufen, besah sich den Stumpf und schüttelte den Kopf. Da war nichts mehr zu retten, aber dafür brauchte man ja auch kein Arzt zu sein. Der Mann säuberte die Wunde und begann sie zu nähen. Der Junge war kreidebleich geworden. Wimmernd sah er auf die Arbeit des Arztes. „Dein erster Tag heute?“, fragte Heinrich ihn, um den Jungen davon abzulenken und er nickte. Der Meister beugte sich herab und sagte, „Und vermutlich dein letzter. Zumindest hier. Ohne rechte Hand bist du hier nicht mehr zu gebrauchen.“ Dann drückte er dem Jungen den Lohn für den Tag in die noch verbliebene Hand und legte noch zwei Münzen, vermutlich aus der eigenen Tasche, dazu.
Erst jetzt begann der Schmerz zurückzukommen und der Junge brüllte los. Heinrich musste ihn festhalten, damit der Arzt sein Werk fortsetzen konnte. Schließlich taumelte der Junge zum Ausgang der Firma und Heinrich ging wieder zurück zu seinem Hammer. Ein anderer Junge arbeitete nun bei Fritz. Heinrich nahm sein nun schon erkaltetes Werkstück und schob es in den Schmiedeofen. Ein glutheißer Atem schlug ihm durch die offene Feuertür entgegen. Der Blasebalg dieses Ofens wurde ebenfalls von einer Dampfmaschine angetrieben. Eine Ähnliche wie die, für die dieses Teil irgendwann mal die Schubstange eines Kolbens sein würde. Immer wieder drehte Heinrich das Eisenstück, bis es die richtige Farbe hatte. Er konnte den Stahl lesen. An der Farbe, dem Geruch, ja selbst am Geräusch beim Schmieden konnte er erkennen, was in dem Eisenstück vor sich ging.
Nicht auszudenken, was wohl passieren würde, wenn das Eisen eine Schwachstelle hatte. Er hatte vor einem Jahr erlebt, wie ein Dampfhammer buchstäblich in tausend Teile zerplatzt war. Ein Teil davon hatte seinen Kopf nur um Haaresbreite verfehlt. Das sollte mit seinem Geschöpf nicht passieren. Er dachte wirklich „Geschöpf“, denn das war es für ihn ja auch. Das Eisen hatte eine Seele und das später daraus zusammengesetzte Objekt, die Maschine, hatte damit natürlich auch eine Seele. Genau so, wie sein Dampfhammer. Er bewegte sich und atmete heißen Dampf aus, der in der Maschinenhalle erzeugt und mit Druckrohren bis hierher geleitet wurde.
Am liebsten würde Heinrich aber mal an einer Lokomotive arbeiten. Er hatte schon viel von diesen Wunderwerken der Technik gehört. Nur direkt vor sich gesehen hatte er noch keine. In Gerüchten hatte er gehört, dass Direktor Hartmann plante, in einer der neuen Hallen Lokomotiven zu fertigen. Seit einigen Jahren fuhren sie schon zwischen Dresden und Leipzig, aber meist waren das Lokomotiven aus England. Wie die „Adler“, deren Bild er in einer Zeitung gesehen hatte. Wenn dann diese faszinierenden Maschinen auch hier in Chemnitz gebaut wurden, dann wollte er unbedingt dabei sein. Vielleicht konnte er auch mal mit einer fahren. Auch, wenn viele Menschen Angst vor ihnen hatten. Fahren ohne Pferd! Was kam wohl als Nächstes? Fliegen wie ein Vogel?
Die Farbe des Werkstückes änderte sich in ein dunkles Kirschrot und damit wurde es Zeit für eine neue Wärmebehandlung. Der Gluthauch schlug ihm wieder entgegen. Zeit zum Träumen von großen Dampfmaschinen, die sich selbst bewegen konnten. Und weiter ging es, Zeit für den Hammer und für höchste Konzentration. Sonst konnte man hier schnell ein Körperteil oder sogar das Leben verlieren. Unerbittlich schlug der Hammer zu und vollendete den Kolben. Dann fiel das Stück glühendes Eisen zum Abschluss der Schmiedearbeiten in ein Wasserbad. Der Gluthauch entließ ein neues Stück Eisen für Heinrich.
2. Kapitel
Teuer erkaufte Zukunft
Ein paar Mal drehte sich die junge Frau um, ob ihr auch niemand folgte, dann verschwand Maria in der Abstellkammer und setzte sich erleichtert auf den dort befindlichen Hocker. „Geschafft!“, dachte sie und zog die erbeutete Zeitung unter ihrer Schürze hervor. Vorsichtig legte sie das Zeitungspapier auf den kleinen Tisch, an dem sie die Näharbeiten für die Herrschaft verrichten musste. Zeit für eine kleine Pause! Maria war vor wenigen Tagen sechzehn geworden und seit mehr als einem Jahr in dieser Villa beschäftigt. Eigentlich gefiel es ihr hier ganz gut, aber es war nicht das, weswegen sie ihr Dorf im Norden Sachsens verlassen hatte. Von früh bis spät rutschte sie auf Knien durch die Räume. Schrubbte Fußböden, wischte Staub und machte auch sonst alle Arbeiten, die ihr aufgetragen wurden.
Allerdings wollte sie Köchin werden! Das war ihre wirkliche Liebe. Etwas in einen Topf werfen und dann etwas anderes, wohlschmeckendes daraus hervorzaubern. Das hatte ihr die Großmutter beigebracht und auch ein kleines Heft mit Rezepten hatte die Großmutter ihr zum Abschied mitgegeben. Maria hatte schon ein paar eigene Rezepte hineingeschrieben. Diese hatte sie von Helga, der Köchin des Hauses, erhalten, mit der sie sich ganz gut verstand. Ihre beiden Zimmer befanden sich im Dachgeschoss, unmittelbar nebeneinander und manchmal redeten sie bis tief in die Nacht miteinander. Allerdings wollte Helga die Arbeit nicht aufgeben und eine zweite Köchin würde die Herrin niemals beschäftigen. Daher diese Verzweiflungstat mit der Zeitung.
Maria hatte sie beim Aufräumen im Rauchersalon gefunden. Der Herr hatte sie gelesen und beim Verlassen des Raumes achtlos auf dem niedrigen Tisch liegen lassen. Schnell hatte Maria den kostbaren Schatz aus Inseraten unter ihrer Schürze verschwinden lassen und nun saß sie hier und horchte nach draußen. Mittag war es und Ruhe im Haus. Noch vor dem Ende der Pause musste das Papier zurück! Marias Blick glitt über die Einrichtung der Kammer. Viel war hier nicht drin. Der große Ankleidespiegel für die Herrschaft, Tisch, Stuhl und ein bisschen Stoff für Reparaturen. Auf dem Tisch lag die Schere und daneben stand die Kiste mit dem Nähzeug.
Und jetzt lag da auch diese Zeitung. Sie zog das Papier vorsichtig zu sich und schlug behutsam die erste Seite auf. Nur dieses kostbare Stück bedrucktes Papier nicht beschädigen! Schließlich würde sie es ja wieder zurückbringen müssen, damit das Verschwinden der Tageszeitung nicht auffiel. Das Rascheln der Papierseiten beim Umblättern war erschreckend laut in ihren Ohren und es dauerte eine Weile, bis Maria endlich die Seite mit den Stellenangeboten gefunden hatte. Jeder, der hier in Chemnitz eine Köchin suchte, der würde hier inserieren. Mit dem Finger glitt sie über die Anzeigen und sie war vollkommen in ihre Lektüre vertieft, als sich die Tür öffnete.
„Habe ich dich!“, sagte der Herr und Maria sprang von ihrem Stuhl auf. Dabei fiel das Papier zu Boden. Leugnen war vollkommen unnütz, sie hatte ihm den Beweis ja direkt vor die Nase gelegt. Würde eine Entschuldigung etwas bringen? Zumindest musste sie es versuchen! „Ich wollte nur ...“, begann Maria und der Herr unterbrach sie sofort mit den Worten „Meine Zeitung stehlen! Ja. Ich sehe es!“ Schuldbewusst senkte die junge Magd den Blick zu Boden und der Herr schloss hinter sich die Tür.
„Was mache ich bloß mit einer Diebin?“, fragte er drohend und kam einen Schritt auf sie zu. Erschrocken zuckte sie zusammen. Alle Zukunftsaussichten von Maria lösten sich gerade in Luft auf, denn wenn der Herr in ihre Papiere schrieb, dass sie stehlen würde, dann erhielt sie nirgendwo mehr eine Anstellung. Einen weiteren Schritt kam der Herr näher, dann stand er direkt vor ihr und sie konnte den Zigarrenrauch in seinem Atem riechen.
Was würde nun kommen? Der Herr schob sie Rückwärts gegen den Tisch und sagte „Strafe muss sein!“ Mit einer Hand griff er sich einen ihrer Arme, drehte sie herum und drückte sie mit dem Oberkörper auf den Tisch. Ihren Arm hatte er dabei so verdreht, dass dieser auf ihrem Rücken lag und der Herr sie mit der linken Hand damit gegen den Tisch drückte. Mit der anderen Hand raffte er ihren Rock und den Unterrock nach oben und schon erhielt sie den ersten klatschenden Schlag mit der flachen Hand auf den nackten Hintern. Es brannte wie verrückt und Maria schrie „Aua!“ „Halt still!“, sagte der Herr und der zweite Schlag traf die lädierte Hinterbacke. Tränen schossen Maria in die Augen. Dann ein dritter Schlag. Ein vierter, ein fünfter! Es klatschte in einer Tour.
Im großen Spiegel konnte sie sehen, wie der Herr zum nächsten Schlag die Hand erhob und sie schloss die Augen, doch nichts passierte. Worauf wartete der Herr? Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie, wie der Herr sich seine Hose öffnete. Er wollte doch nicht etwa? „Nein Herr! Bitte! Bitte nicht!“, flehte Maria und versuchte ihren Hintern zur Seite zu bewegen, um ihm auszuweichen, doch er sagte wieder nur „Halte still!“ Die nun freie Hand schob sie wieder zur Mitte zurück und sie wagte nicht mehr, sich ihm zu widersetzen. Zu nahe war sie nun schon an einem Rauswurf.
Sie spürte, wie er stochernd den Weg in ihr Inneres suchte, dann schob er mit den Knien ihre Beine auseinander und nun fand er den Zugang zur noch jungfräulichen Enge. Mit der Gewalt eines seiner Dampfhämmer brach er ihren Widerstand und rammte sich mit dem ersten Stoß tief in sie. Sie spürte, wie in ihrem Schoß etwas zerriss und ein Schmerz durchzuckte sie. Maria schrie auf, jammerte, klagte und flehte, doch der Herr machte mit unverminderter Kraft immer weiter. So, als ob er ihr das Becken brechen wollte.
Marias von Tränen verschleierter Blick fiel auf die glänzende Schere vor ihr. Ihre Hand krampfte sich um das kalte Metall, doch wenn sie das wirklich tat, was sie im Moment tun wollte, so wäre wirklich alles aus. Dann würde sie als Mörderin im Gefängnis landen oder am Galgen ihr Leben beenden. Weinend schob sie die Schere vom Tisch. Das Klirren des Metallteiles, als es auf den Boden fiel, vermischte sich mit dem Stöhnen des Mannes, der zuckend in ihr kam und sich aus ihrem Schoß zurückzog.
Schnaufend schloss er sich die Hose und sagte „Lass dir das eine Lehre sein! Niemand bestiehlt mich!“ Nach einem letzten schallenden Schlag mit der flachen Hand auf ihren Hintern verließ der Mann das Zimmer und Maria richtete sich wieder auf. Die Röcke rutschten herab und sie rieb sich das schmerzende Hinterteil. Maria blickte zur Tür und fragte sich, ob das die ganze Bestrafung war? Würde der Herr den Diebstahl in ihren Papieren vermerken? Sie betete, dass dies nicht geschehen würde. Dann fiel Marias Blick auf den Boden zu ihren Füßen. Der Herr hatte die Zeitung vergessen! Schnell hob sie diese auf und wischte sich die Tränen ab.
Im Stehen blätterte sie schnell durch die Anzeigen und stieß auch wirklich auf etwas Vielversprechendes. Sollte die teuer erkaufte Zeitung also doch von Nutzen sein? Noch ein Blick zur Tür, dann schrieb sich Maria die Adresse mit einem Bleistift ab, säuberte den Raum und brachte dann die Zeitung, fein säuberlich gefaltet, zurück in den Salon.
Mit einem Knicks legte sie das Papier vor den Herrn auf den Tisch zurück. Der Herr winkte nur mit der Hand und Maria verschwand. Nun musste sie schnell weiter arbeiten. Mit Wischlappen und Eimer kniete sie kurz darauf im Esszimmer und säuberte das kostbare Mosaik auf dem Boden. An ihrem nächsten freien Tag würde sie die Adresse aufsuchen und sich dort vorstellen. Die junge Magd betete darum, dass diese Stelle dann noch frei sein würde und sie den begehrten Platz als Köchin erhielt. Langsam klangen auch die Schmerzen ab.
3. Kapitel
Kaffee und Gespenster
Sie saß in einem kleinen Café und rührte gelangweilt in ihrer Tasse. Ihre Freundin hatte sie versetzt. Schon wieder! Clara nahm einen Schluck des Getränkes und stellte die Tasse zurück. Sie war die Tochter eines Stofffabrikanten und würde in ein paar Monaten achtzehn werden. Dann würde der Vater sie sicherlich verheiraten, denn das hatte er ihr schon mehrmals angedroht. Manchmal im Scherz und manchmal im Ernst. Und wenn dem so war, dann wäre dies also ihr letzter Sommer in „Freiheit“. Sie ließ ihren Blick über den kleinen Park schweifen, an dessen Rand die Tische unter Sonnenschirmen standen. Es war ein schöner Tag und sie genoss die Wärme der Sonne auf ihrem Gesicht. Ein Kellner kam und brachte ihr ein Stück Torte. Nun würde es doch noch ein schöner Tag werden. Genüsslich verspeiste sie das köstliche Backwerk. „Die war sehr gut!“, sagte sie, als der junge Mann das nun leere Geschirr holte und die Rechnung brachte.
Clara zahlte und gab ihm eine Münze extra, was der Kellner ihr mit einer tiefen Verbeugung und einem breiten Lächeln dankte. Sie erhob sich, richtete mit einem kontrollierten Griff ihre Kleidung und wollte gerade aufbrechen, als sie ihren Bruder Gregor auf dem Gehweg in der Nähe sah. Sie winkte und er kam zu ihr herüber. Einen Augenblick später machten sie sich gemeinsam auf den Weg und folgten der Straße. In ein Gespräch vertieft merkte sie erst nach einigen Dutzend Schritten, dass sie den falschen Weg einschlugen, doch sie hatte ja Zeit und begleitete den Bruder.
Gregor erzählte von der Firma des Vaters, von der er, nach seinen Worten, gerade gekommen war und ihre Gedanken flogen zu diesem düsteren Ort. Nur ein einziges Mal war sie in der Halle gewesen und hatte die Frauen gesehen, die dort für Vaters Reichtum schuften mussten. Wie Gespenster hatten sie ausgesehen. Leere Augen, zerlumpte Kleidung und mit müden Bewegungen. Auch Kinder waren dort für Hilfsarbeiten gewesen und die sahen nicht viel besser aus, als ihre Mütter.
Eigentlich wollte Clara nicht daran denken, doch jede Bemerkung von Gregor oder jede ausgegebene Münze, wie die vorhin für die Torte, lenkten ihre Gedanken wieder zur väterlichen Stoffmanufaktur zurück. Es war eine von wenigen Spinnereien hier in Chemnitz. Die anderen Betriebe verarbeiteten Erz aus dem nahen Erzgebirge, wie ihr Gregor immer wieder erzählte. Vermutlich hätte der Bruder auch gern eine Schmiede geführt, aber er würde die Weberei in ein paar Jahren vom Vater übernehmen.
Der Großvater hatte sie mit zehn Angestellten einst gegründet, nun waren es ein paar hundert und vielleicht schon bald einige tausend Arbeiterinnen, denn ihre Stoffe waren begehrt. Selbst ihr Kleid war aus diesem Stoff gemacht und seit sie vor ein paar Monaten in der Fabrik gewesen war, fühlte sich Clara irgendwie schuldig, wenn sie es anzog. Es war schon ein großer Unterschied zwischen ihr und der Frau, die diesen Stoff gewebt hatte. Aber so war es nun mal und sie hätte nicht gewusst, wie sie an deren Stelle hätte leben können.
Gregor hatte sie untergehakt und so gingen sie den Weg entlang, bis sie begriff, dass sie zum Werk gingen, wo sie ja eigentlich gar nicht hinwollte. Der Bruder bemerkte ihr Stocken und sagte schnell „Ich habe dort was vergessen. Lass es mich nur schnell holen!“ Missmutig ließ sie sich von ihm weiterziehen. Schritt für Schritt näherten sie sich dem Platz, den sie nie wiedersehen wollte. Fast sträubten sich ihr die Haare im Nacken bei diesem Gedanken und dem Anblick, der noch in ihrem Kopf war.
Die besseren Häuser lagen schon bald hinter ihnen und vor ihnen stieg der dunkle Rauch der Schornsteine in einen grauen Himmel. Vor diesen qualmenden Schloten, sozusagen zwischen den Wohnblöcken der Arbeiter und den Toren der Gießereien, lag die große Halle. „Ich will da nicht rein!“, sagte Clara. „Und ich kann dich hier nicht alleine stehen lassen! Zu gefährlich!“, entgegnete Gregor. Clara setzte in Gedanken hinzu „Zu gefährlich für eine Frau!“ Doch sie wusste, dass hier hunderte Frauen beschäftigt waren, die an den Webstühlen arbeiteten. Sie waren geschickter als die Männer und darum hatte der Vater immer mehr von ihnen eingestellt.
Gregor schob das Tor vor ihr auf und der Lärm der rüttelnden Gestelle durchstieß ihre Ohren. Clara zuckte zusammen, riss ihre Hände nach oben, versuchte sich die Ohren zuzuhalten und wurde gleichzeitig von Gregor ohne Rücksicht hinter ihm her in den Raum gezogen. Sie stolperte mehr an den Webstühlen entlang, als dass sie ging. Dann waren sie endlich in der Meisterstube und Gregor nahm seinen Hut vom Tisch.
Entgeistert sah sie den Bruder an. „Wegen deines Hutes sind wir hier?“, brüllte Clara erzürnt gegen den Lärm an und der Bruder setzte ihn sich auf. Das durfte doch nicht wahr sein! Er hatte dutzende Hüte zu Hause. Sie warf noch einen kurzen Blick in den Raum und folgte dann ihrem Bruder schnell wieder hinaus. Als sie endlich wieder auf der Straße waren, zeigte er mit dem Daumen hinter sich, dann sagte er „Da kommt dein Geld her.“ Doch das wusste sie selbst und brauchte nicht auch noch von ihm daran erinnert zu werden.
Wütend hakte sie sich bei ihm unter und endlich führte sie der Weg wirklich nach Hause. Allerdings waren ihre Gedanken noch in dem Lärm der Halle geblieben. Wie hielt das jemand den ganzen Tag nur aus? Die Frauen waren zwar sicher froh, dass sie mit den verdienten Münzen ihre Kinder durchbringen konnten, aber immer mehr setzte sich die Erkenntnis bei Clara durch, dass dies nur ein Hungerlohn für eine schwere Plackerei war, denn sie kannte den Vater nur zu gut und er war sparsam, fast schon geizig. Fragend sah Clara ihren Bruder von der Seite an. War er anders als der Vater? Gregor blickte streng nach vor. War er zuvor noch sehr gesprächig gewesen, so kam nun kein Wort mehr über seine schmalen Lippen und sie versuchte in den Gesichtszügen des jungen Mannes zu lesen. Waren vielleicht alle Männer so?
Was würde da erst nach der Hochzeit auf sie zukommen? Der Bruder war drei Jahre älter und der Vater hatte am gestrigen Tag wieder einmal so eine Bemerkung gemacht, die sie aufhorchen lassen hatte. Dabei hatte er von Hochzeiten geredet! So, als ob sie beide heiraten würden.
Mit Erleichterung stellte sie fest, dass die Gegend endlich wieder besser wurde. Schneller setzte sie ihre Füße auf die Platten des Gehweges. Nur fort von dieser schmutzigen Fabrik. Sie folgten dem Fußweg neben der stark befahrenen Straße und es war schon bald nicht mehr weit bis zum elterlichen Haus, welches sie nach der Hochzeit für immer verlassen würde. Gregor würde es in ein paar Jahren, zusammen mit seiner Frau, übernehmen.
Schon war das Haus zu sehen. Eine Gruppe von Mädchen und Frauen stand am Dienstboteneingang. Sicher wollten sie alle die Stelle der Köchin haben. Gedankenverloren glitt ihr Blick über die jungen Frauen, als sich eine davon aus der Gruppe löste und auf sie zugelaufen kam. Noch bevor Clara wusste, was geschah, stieß die junge Frau sie zur Seite in den Straßenstaub. „Eine Verrückte!“, dachte Clara, da erfasste eine Kutsche, die von hinten kam und halb auf dem Gehweg fuhr, die junge Frau, die nun vor ihr gestanden hatte, und schleuderte diese zur Seite. Im Flug krachte sie mit der Seite gegen den Mast der Straßenbeleuchtung. Das konnte die Frau unmöglich überlebt haben! Gregor lief zu der Frau und drehte sie um, während Clara sich langsam vom Gehweg erhob.
„Das hätte mein Ende sein können!“, dachte sie und klopfte sich verwirrt den Staub von der Kleidung. Einen Moment später schritt sie zu ihrem Bruder, der immer noch neben der jungen Magd kniete. Die Frau schien nicht schwer verletzt, was einem Wunder glich.
„Trage sie hinein“, bat sie Gregor, als die Frau dann vor ihren Füßen zusammenbrach. Schnell schickte sie nach einem Arzt und folgte dann ihrem Bruder in das Haus. Dieser hatte die Frau auf eines der Sofas in der Eingangshalle abgelegt. „Bringe sie bitte in das Gästezimmer!“, sagte Clara, wobei sie sah, dass Gregor ihr ihren Wunsch eher widerwillig erfüllte. Die verletzte Frau war bleich und hatte die Augen geschlossen. Ausgestreckt lag sie in dem Bett.
Clara stand neben ihr und blickte zur Zimmertür. Nach endlosem Warten traf endlich der Arzt ein.
4. Kapitel
Die Chance einer Möglichkeit
Maria hatte extra noch einmal nachgefragt, wie sie die Adresse finden würde und nun war sie auf dem Weg. Der Herr hatte darauf verzichtet, den Diebstahl der Zeitung zu vermerkten und so waren ihre Papiere makellos. Nur eben nicht die einer Küchenhilfe, sondern einer Putzmagd. Darum hatte Maria auch ihr Rezeptbuch mitgenommen, um es eventuell vorzeigen zu können. Alles, was sie hatte, würde sie für diese Chance brauchen, denn noch einmal konnte sie keine Zeitung stehlen. Selbst jetzt noch, fünf Tage später, brannte ihr Hinterteil von den Schlägen. Zusätzlich bangte und hoffte sie, dass der Übergriff des Herrn folgenlos bleiben würde. Sonst würde sie in ein paar Wochen viel Geld für die Kurpfuscherin brauchen. Ein bisschen mulmig war Maria da schon alleine bei dem Gedanken daran, denn zu viele Schauergeschichten hatte sie davon schon gehört. Aber nun verscheuchte sie erst einmal diese dunklen Vorstellungen, denn dieser Termin hier war wichtiger.
Sie trug ihr schönstes Kleid, was bei zweien auch keine schwere Wahl gewesen war. Normalerweise zog sie es nur am Sonntag zum Gottesdienst an. Mit schnellen Schritten eilte sie an der Straße entlang. Sorgsam strich sie sich dabei immer wieder den Rock glatt und zupfte alle paar Schritte am Hutband. Alles saß! Der erste Eindruck sollte doch schließlich stimmen!
Mit dem kleinen Korb unter dem Arm, in welchem das Rezeptbuch der Großmutter lag, folgte sie der Wegbeschreibung ihrer Freundin. Für einen Tag mitten in der Woche war hier ganz schön viel los. Es war ein Viertel der Reichen und so sah sie hier auch nur wenige Arbeiter. Die wohnten alle am anderen Ende der Stadt, in schmutzigen Mietskasernen. Vor einem Jahr war sie bei ihrer Ankunft in Chemnitz durch dieses Viertel gelaufen und erschrocken, über die Zustände dort. Auch die Manufakturen befanden sich da und gerade sah Maria den Rauch dort aufsteigen. Bedrohlich wie eine schwarze Wand zog er über den Horizont.
Von diesem Viertel hier war er aber weit entfernt. Nicht einmal, wenn der Wind ungünstig stand, konnte man hier den Kohlenrauch der Fabriken riechen. Höchstens den der herrschaftlichen Kamine. Im Moment heizte aber niemand, da der Sommer gerade begonnen hatte. Immer größer wurden die Villen am Straßenrand und immer wieder sah Maria auf den Zettel. Dann hatte sie endlich die Nummer gefunden. Am Hintereingang, den das Personal zu nehmen hatte, stand eine Gruppe von etwa fünfzig Frauen. Marias Herz krampfte sich zusammen. Alles aus! Da wäre sicher mehr wie eine Frau dabei, die bessere Referenzen hatte, als eine ungelernte Putzmagd. Zweifelnd überlegte sie sich, ob sie sich dennoch anstellen sollte?
Eine ganze Weile lang stand sie unentschlossen einfach dort herum. Abseits der Gruppe grübelte sie über Sinn und Unsinn nach, denn hier hatte sie die Chance eines Stückes Butter auf der heißen Herdplatte. Eine gegen fünfzig!
Überlegend und zweifelnd beobachtete sie die Straße und sah die Kutschen, die der Straße folgten. Immer wieder blieb eine davon in der Nähe stehen und entließ ihre Fahrgäste. Andere Herrschaften stiegen ein. Sie erblickte vornehme Kleider und elegante Anzüge der Herren. Hier in der Stadt lagen die Villen direkt an der Straße. Auf dem Weg von ihrem Dorf hatte sie die vornehmen Anwesen auf dem Lande gesehen. Dort waren sie von kleinen Parks umgeben gewesen.
Staunend sah sich Maria die schönen Kleider der wohlhabenden Frauen an, die manchmal nur zwei Schritte neben ihr liefen. Die Damen sahen die Magd vermutlich nicht einmal, aber das war Maria gewöhnt. Auch beim Putzen in der Villa war sie mehr ein Möbelstück, als ein Mensch.
Ihr Blick ging zu den anderen Mägden zurück. Die Gruppe verkleinerte sich Zusehens. Immer mehr Frauen aus der langen Schlange betraten das Gebäude und kamen schon kurz darauf wieder zurück.
Irgendwann waren nur noch zehn Frauen übrig und Maria beschloss, sich nun doch noch zu bewerben. Was hatte sie schon zu verlieren? Die junge Magd wendete sich der Gruppe wieder zu und ging zur erlösenden Haustür hinüber.
Zehn Schritte vor dieser Tür sah sie eine junge, vornehm gekleidete Frau auf dem Gehweg auf sich zukommen. Hinter der Frau raste eine Kutsche heran, auf deren Bock kein Kutscher mehr saß. Bestimmt waren die Pferde durchgegangen und würden die Dame schon in wenigen Augenblicken streifen. Der Gedanke, den ihr die Herrin immer wieder eingebläut hatte, sauste durch ihren Kopf. „Schütze die Herrschaft!“
Maria ließ den Korb fallen und stürzte sich auf die Frau, die sie ziemlich entsetzt ansah, als sie die feine Dame in den Staub des Gehweges warf. Zum selbst zur Seite springen reichte aber die Zeit nicht mehr. Die Kutsche streifte Maria und die junge Magd flog durch die Luft. Aus dem Augenwinkel sah sie den Laternenpfahl auf sich zurasen, neben dem sie die ganze Zeit gewartet hatte.
Es waren sicher nur drei Schritte Entfernung, doch sie schien unendlich lang zu fliegen, dann prallte sie mit der Seite gegen das Hindernis und hörte ihre Knochen krachen. Mit einem Schmerzensschrei fiel sie zu Boden und blieb liegen. Das Gesicht zum Boden gedreht hielt sie sich im Liegen die schmerzenden Rippen. Sie bekam kaum Luft, aber nun tat wenigstens der Hintern nicht mehr weh.
Sie erhob sich mühsam auf alle viere. Keuchend versuchte sie zu Atem zu kommen und sah den Boden des Gehweges unter sich, dann drehte sie jemand an der Schulter um. Sie sah das Gesicht eines jungen Mannes, der sich über sie beugte. Hinter ihm zogen weiße Wolken über den blauen Himmel. War es schon so weit, aufzubrechen? Nun beugte sich die junge Frau über Maria. Sie schien besorgt zu sein.
Erst jetzt merkte Maria, dass sie nichts mehr hören konnte, sondern nur sah, wie sich die Münder öffneten. Mit der Hand zeigte auf ihre Ohren und schüttelte verzweifelt den Kopf. Das Leben kam zu ihr zurück, die Stille blieb! Mühsam setzte sie sich auf und der Mann zog sie auf die Füße.
Schwankend stand sie dort und sah das zerfetzte Kleid an. Verwirrt versuchte Maria, den Staub davon zu bekommen, doch es war sicherlich nur noch als Putzlappen zu verwenden. Das weiße Unterkleid war durch den Rock hindurch zu sehen. „Ist dir was passiert?“, hörte sie leise eine Männerstimme, die lauter wurde. „Alles gut. Nur das Kleid“, sagte sie laut und hielt sich dabei die schmerzenden Rippen. Die Geräusche der Welt kamen immer mehr zu ihr zurück.
„Danke dir“, sagte nun die vornehme Dame und klopfte sich den Straßenstaub vom Kleid. Maria hielt sich an dem Mast der Gaslaterne senkrecht. Der junge Mann hatte ihren Korb geholt und hielt ihn ihr hin, doch sie hätte den stützenden Pfahl loslassen müssen, um ihn zu ergreifen. Wenigstens eine Hand? Doch noch bevor sie eine Entscheidung getroffen hatte, gaben ihre Beine nach. Maria rutschte in sich zusammen und die junge Dame fing sie geistesgegenwärtig mit beiden Händen auf.
„Entschuldigung“, stammelte Maria und wurde von den Zweien zu einer Bank geführt. Erst jetzt bemerkte sie, dass sich eine große Menschenmenge um sie herum gebildet hatte. Maria wischte sich über den Mund und der noch am Morgen weiße Handschuh bekam eine rote Spur. Blut! Also war sie doch schwerer verletzt worden.
Nun begann auch ihr ganzer Brustkorb zu brennen, als ob er ihn Flammen stand. Jeder Atemzug tat weh. Sie hörte das Rasseln ihres Atems und spürte, wie alles um sie herum verschwamm. Kraftlos rutschte sie, auf der Bank sitzend, in sich zusammen. Vor Angst zitternd begann die junge Magd ein Gebet, welches die vornehme Dame sofort unterbrach.
„Wir bringen dich schnell von hier fort!“, sagte sie und der junge Mann schob seine Arme unter ihre wackeligen Beine. Dann hob er Maria an und trug sie auf seinen Armen zum Vordereingang des Hauses, an dessen anderen Eingang sie die ganze Zeit gewartet hatte. Kurz vor dem Hause wurde es Schwarz um Maria herum. Ruhe und Dunkelheit hüllten sie ein. Der Schmerz war fort! War das das Ende?
5. Kapitel
Menschenleben
Sie hatte daneben gestanden, als der Doktor die bewusstlose Magd zuerst entkleidete, das machte er zusammen mit Cornelia, der Zofe, und danach die junge Frau sorgfältig untersucht hatte. Sie sah die dunkelblaue Seite der Frau und sagte sich immer wieder in Gedanken „Das hätte ich sein können, die jetzt dort liegt!“ Clara hätte den Kopf über ihren Bruder schütteln können. Diese Frau hatte ihr vermutlich gerade das Leben gerettet und er wollte sie nicht in dieses Bett legen, nur weil sie zum Personal gehörte. Trotzdem war sie doch aber ein Mensch! Clara sah die junge Frau an. In all den Jahren war sie hier mit den Mägden aufgewachsen und sie kannte es nicht anders, als das ständig jemand in der Nähe war, um ihr jeden Wunsch zu erfüllen oder hinter ihr her zu putzen.
Doch nach den beiden Besuchen in der Fabrik hatte sie schon erkannt, dass dies nicht selbstverständlich gewesen war. Ihre Gedanken flogen zu ihrer Kindheit zurück. Als Kind war das schon schön gewesen, denn man sagte nur „Kuchen!“ und die einzige Antwort war „Wie viele Stück und welcher?“ Und nun hatte sie, wie als wenn es ein zusätzliches Zeichen gewesen wäre, eine Magd gerettet. Vielleicht sollte sie an dieser Frau all das wieder gut machen, was sie in all den Jahren Gutes von ihrem Personal erfahren hatte.
Der Arzt sagte ihr, dass die Magd noch länger schlafen würde, aber dass es der Frau, den schmerzhaften Umständen entsprechend, gut ging. Clara begleitete den Mann hinaus und sah Cornelia in dem Zimmer verschwinden, wo sie nun sicher schnell aufräumte. Insgeheim mochte Clara dieses flinke Mädchen und hätte sie gern als Freundin gehabt, auch wenn sie zum Dienstpersonal gehörte.
Gregor sah das alles natürlich ganz anders. Immer wieder hatte sie aus den Worten des Bruders geschlossen, dass es für ihn nur drei Sorten von Menschen gab: Männer, Frauen und Personal. Oder: Männer, Personal und Frauen. Die Reihenfolge wechselte oft, nur die Männer waren für ihn immer oben. Und je mehr einer besaß, desto höher war seine Position.
Bei den Frauen sah er das ganz anders und so behandelte er sie auch. Sie und Mutter mal ausgenommen. Meist zumindest! Aber war denn ein Frauenleben weniger Wert als ein Männerleben? Beides waren Menschenleben! Zumindest in Claras Augen. Und nun hatte Gregor wieder einmal gezeigt, was er von Frauen hielt. Grübelnd sah sie zur Treppe hoch, über die Gregor gerade nach oben stieg. Ihr Blick ruhte auf seinen Schultern und sicherlich hatte er die Magd schon längst wieder vergessen.
Clara wendete sich zurück und ging langsam in das Zimmer hinein. Cornelia hatte die fremde Frau, oder besser, das fremde Mädchen, sorgfältig zugedeckt. Im Korb, der neben dem Bett auf dem Boden stand, lagen ihre Papiere und Clara sah hinein. „Informiere die Herrschaft der Frau, dass sie noch etwas bei uns bleiben wird“, sagte sie zu Cornelia und hielt ihr den Ausweis hin. Doch noch bevor die Magd zugreifen konnte, sagte sie „Nein. Ich mache es selbst“ und steckte den Ausweis ein.
Sie ließ sich ihre Jacke bringen und brach auf. Der Weg war etwas weiter, aber es war ja ein schöner Tag. Am Eingang der Villa öffnete ein Diener mit einer Verbeugung und sie schilderte ihr Anliegen. Schnell saß sie auf einem Sofa im Empfangssaal und nach einer Weile erschien eine ältere Dame, die fein angezogen war. Offensichtlich die Hausherrin. Clara stand auf, ging auf sie zu und machte einen Knicks, den die Frau wohlwollend mit einem Nicken quittierte.
Wieder erzählte Clara von dem Mädchen und die andere Frau winkte ab. „Da suche ich mir eben eine Andere“, sagte sie schließlich und Clara wusste nicht, ob das wohl im Sinne des Mädchens war. Doch sie wollte sich ja vorstellen, also suchte sie schon eine neue Anstellung. Nach einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen war sie dann auch wieder auf dem Heimweg. Das Mitgefühl der fremden Frau für die verletzte Magd hatte sich in Grenzen gehalten. Was sagte das wohl über deren Umgang mit dem Personal aus? Sicher waren deren Vorstellungen mit denen der Mutter identisch. Personal, das sich nicht bewegt, war nutzlos. Und krankes Dienstpersonal wurde eben ersetzt.
Langsam folgte sie der Straße, die sie wieder zurück zu ihrem Elternhaus führen würde. Sie ging dabei betont weit von der Kante der Straße entfernt, denn das Erlebnis mit der Kutsche steckte ihr noch in den Gliedern. Mit zunehmender Wegstrecke merkte Clara, dass sie hungrig wurde und das trotz des Kuchens, den sie gerade eben erst gegessen hatte. „Hoffentlich haben wir nun wieder eine gute Köchin“, dachte sie und betrat die Eingangshalle. Verlockender Bratenduft schlug ihr schon entgegen, doch vor dem Essen wollte sie noch einen Blick auf das Mädchen werfen.
Immer noch ziemlich bleich lag sie dort, fast so weiß, wie das Laken des Bettes. Cornelia erklärte ihr, dass sie noch nicht wieder erwacht war, dann eilten sie beide hinaus. Das Essen stand an. Clara wechselte ihre Sachen, dann wartete sie gespannt im Esszimmer auf die kulinarischen Künste der neuen Köchin.
Nach dem Essen sagte Gregor „Nicht schlecht!“ und das war das beste Lob, dass eine Frau vom Personal überhaupt von ihm bekommen konnte. „Es war hervorragend!“, setzte Clara dagegen und tupfte sich mit der Serviette den Mund ab. Vermutlich würde dies die einzige Anerkennung für die Köchin bleiben. Anschließend erhoben sie sich und während Gregor und der Vater im Raucherzimmer verschwanden, ging Clara noch einmal zu dem Mädchen, aber an deren Zustand hatte sich noch nichts geändert.
Vorsichtig richtete sie das Kopfkissen und zog die Decke zurecht. Fast liebevoll und voller Dankbarkeit streichelte sie das Gesicht der fremden Frau. Maria, wie sie aus den Papieren entnommen hatte. Wie konnte sie ihr weiter helfen? Bestimmt mit einer Anstellung und da würde sich sicherlich etwas finden lassen.
Ein paar Augenblicke später lief sie in die Bibliothek, holte sich ihren liebsten Gedichtband und setzte sich damit zu der schlafenden Magd. Leise las sie die Zeilen vor. Irgendwann wurde es zu dunkel zum Lesen und Cornelia kam in den Raum, um die Fensterläden zu schließen. Noch einmal strich sie über die Wange der jungen Frau, dann nickte sie Cornelia zu und verließ die Stube.
Langsam stieg Clara die Treppe hinauf und ging auf ihr Zimmer. Eine der Mägde half ihr aus dem Kleid und schließlich legte sich Clara in ihr Bett. In der Ruhe der beginnenden Nacht kamen jetzt die Bilder der Kutsche in aller Deutlichkeit zu ihr zurück. Erneut dachte sie daran, was hätte passieren können und dadurch konnte sie nicht einschlafen. Ihre Gedanken gingen auf die Reise zu dem Mädchen, welches sie gerettet hatte. Grübelnd dachte sie über diesen Tag nach.
In der Stille der Nacht hörte sie ihren Bruder herauf kommen. Seine schweren Schritte waren unüberhörbar auf der Treppe, dann fiel die Tür des Nachbarzimmers laut ins Schloss. Wenig später vernahm sie die trippelnden Schritte einer Frau, dann schloss sich leise die Nebentür. Den Schritten nach war es sicher Cornelia gewesen, die zu Gregor in das Zimmer geschlüpfte war.
Nun gingen Claras Gedanken in das Nachbarzimmer hinüber. Gregor war schon ein schöner Mann und manchmal hörte sie, wie er Cornelia erlaubte, dass sie ihn nachts besuchte. Eine neue Gedankenreise setzte ein. Die anstehende Hochzeit schob das Bild des Unglücks davon. Wie würde wohl ihr Ehemann sein? Und wie Gregors Frau? Vielleicht würde die Hochzeit an ihrem achtzehnten Geburtstag stattfinden. Nur wen würde der Vater für sie aussuchen? Kannte sie ihn vielleicht sogar schon?
Oft waren Bälle, wo man sich traf. Vor ihrem Auge rauschten die Bilder aller jungen, unverheirateten Männer vorbei. Wer würde es sein? Der Vater hatte noch nicht mal eine Andeutung gemacht. Sie hörte Geräusche aus dem Nachbarzimmer. Die Neugier packte sie! Zu gern hätte sie da mal Mäuschen gespielt und zugesehen. Angestrengt lauschte sie in die Nacht. Das Fenster stand einen Spalt weit offen und sicher auch das von Gregors Zimmer, aber außer Schnaufen war nichts zu hören und zu verstehen. Sie stellte fest, dass sie von dem, was da gerade im Nachbarzimmer passierte, noch gar keine Ahnung hatte. Niemand hatte mit ihr darüber gesprochen. Sie hatte noch nicht mal einen Mann nackt gesehen! Das war alles „Nichts für Mädchenohren!“ wie ihr die Mutter mal gesagt hatte. Vielleicht sollte sie Cornelia mal fragen. Clara schloss die Augen und begann von ihrem zukünftigen Mann zu träumen.
6. Kapitel
Apfelkuchenträume
Sie schlug die Augen auf und sah eine kunstvoll verzierte Stuckdecke über sich. Maria versuchte sich zu orientieren und stöhnte auf. Ein älterer Mann beugte sich über sie. „Hallo Fräulein, willkommen zurück!“, sagte er. Der Mann hatte eine Flasche mit einem übelriechenden Inhalt in der Hand, welche er gerade von ihrer Nase wegzog. Die junge Frau folgte der Flasche mit ihrem Blick und stellte fest, dass sie vollständig entkleidet in einem Bett lag. Der Mann begann ihre nackte Brust abzutasten und fragte „Tut ihnen hier etwas weh?“ „Nein“, antwortete Maria, denn das war im Moment die einzige Stelle, die ihr nicht wehtat. Irgendwie war ihr diese Behandlung peinlich. Ihre Seite drückte immer noch und sie griff sich dort hin. Unter ihren Fingerspitzen spürte sie einen dicken Verband an der anderen Brust.
„Ja. Sie haben großes Glück gehabt. Nur ein paar geprellte Rippen“, stellte der Mann fest und ließ von ihr ab. Viel zu lange, für ihren Geschmack, hatte er ihre Brust geknetet. „Wo bin ich hier?“, fragte Maria und der Mann antwortete, während er irgendwelche Dinge in eine Tasche packte, „In der Villa Gerfersheim. Mademoiselle Clara hat sie hier in diesem Hause aufgenommen.“ „Wer ist Mademoiselle Clara?“, fragte Maria nach.
„Die junge Frau, der sie wahrscheinlich das Leben gerettet haben“, antwortete der Mann und verschloss lautstark die Tasche. Erneut beugte er sich über sie und bedeckte Marias Körper bis zum Hals mit einer dünnen Decke. Der Mann, der offensichtlich ein Medicus war, nahm seine Tasche und im selben Moment öffnete sich die Tür. Die junge Frau kam in einem anderen Kleid herein und redete kurz mit dem Mann, der danach das Zimmer verließ. „Danke“, sagte Maria zu der jungen Frau. „Dasselbe wollte ich auch gerade sagen“, stellte Clara mit einem Lachen fest. „Willst du irgendetwas?“, fragte sie und Maria entgegnete, „Wie lange liege ich schon hier?“ „Zwei Tage.“ „Um Himmels willen! Zwei Tage!“, entfuhr es Maria und sie versuchte das Bett zu verlassen, doch Clara drückte sie zurück. „Aber meine Herrschaft!“, erwiderte Maria besorgt, denn so lange durfte sie ja nicht fehlen. „Die weiß Bescheid. Ruhe dich aus!“, sagte Clara und setzte sich auf einen Stuhl am Kopfende des Bettes, den sie sich geräuschvoll zu ihr zog.
„Du warst bestimmt wegen der Arbeit hier? Oder?“, fragte Clara und Maria musste gerade daran denken, dass sie die andere sicher durch ihr Fernbleiben schon verloren hatte. Sie stöhnte auf und nickte. „Also die Anstellung als Köchin ist schon vergeben, aber wenn du als Küchenhilfe hier arbeiten möchtest, dann rede ich mal mit der Hausdame“, sagte Clara und Maria entgegnete schnell „Ja! Wenn sie das für mich tun würden?“ „Gern“, sagte Clara und erhob sich. Wenig später war Maria alleine und versuchte sich aufzurichten, aber durch die Schmerzen in der Seite gelang ihr das nicht so richtig. Nach mehreren vergeblichen Versuchen fiel sie zurück auf das Bett.
Sie blickte zur Tür. Wer war nur diese Frau? Clara gehörte auf alle Fälle nicht zum Personal, wenn sie der Hausdame etwas sagen konnte, den diese stand ja dem Personal vor. Die Tür öffnete sich und eine Magd erschien. „Ich bin Cornelia. Du hast doch bestimmt Durst?“, fragte die Magd, die sicher auch erst in Marias Alter war. „Ja. Wenn du mir hilfst“, sagte Maria schnell, denn ihre Lippen fühlten sich ganz rau an. Geschickt hatte Cornelia sie hochgedrückt, ihr das Kissen in den Rücken geschoben und ihr den Becher an den Mund gehalten.
Gierig trank Maria zwei Becher leer, dann erschien Clara wieder und Cornelia machte einen tiefen Knicks. Also gehörte Clara zur Herrschaft! „Du kannst als Küchenhilfe anfangen“, sagte die junge Frau und Maria sagte „Danke, junge Herrin!“ Dann wollte sie das Bett verlassen, um zu ihrer Arbeit zu eilen, doch wieder drückte Clara sie zurück. „Nicht so schnell. Vielleicht morgen“, erklärte sie.
„Meine Sachen?“, fragte Maria. „Die holt Cornelia für dich“, sagte die junge Herrin und Cornelia machte einen erneuten Knicks. Sie sagte „Gern“ und war auch schon draußen. „Kann ich noch was für dich machen?“, fragte Clara, doch Maria war es irgendwie peinlich, sich von der Herrin bedienen zu lassen. „Nein. Danke“, sagte sie daher schnell. „Keinen Hunger?“, fragte Clara nach. „Ein bisschen schon“, entfuhr es Maria, denn das Essen würde ja sicher eine Magd holen und bringen, doch es war Clara, die wenig später mit etwas Suppe in einer Schüssel zurückkam und diese ihr hinhielt.
Löffel um Löffel verschwand eine kräftige Brühe in Marias knurrenden Magen. „Die ist gut“, sagte sie dann zum Schluss anerkennend. Das Haus hatte eine gute Köchin gefunden. Und auch eine gute Küchenhilfe? Das würde sich zeigen!
„Wo sind eigentlich meine Sachen, die ich getragen hatte?“ fragte Maria, da sie ja unbekleidet unter der Decke lag. „Also, dein Kleid und dein Unterkleid haben den Zusammenprall mit der Kutsche nicht überstanden. Und dein Mieder ...“, antwortete Clara, dann drehte sie sich um und holte etwas, was sie danach in Marias Blickfeld hielt. „Ich glaube, der hat dir dein Leben gerettet“, setzte die junge Herrin hinzu.
Maria sah die zerbrochenen Fischbeinstäbe auf der einen Seite aus dem Stoff herausragen. „Ich habe dafür ein paar Monate lang jede Münze gespart. An dem Tage, vorgestern, habe ich ihn das erste Mal getragen.“ „Und auch das letzte Mal. Ich schenke dir einen Neuen“, sagte Clara und ließ das zerbrochene Wäschestück achtlos zu Boden fallen. „Lust auf etwas Kuchen?“, fragte die Herrin, als sie die leere Schüssel aufnahm. „Herrin! Sie können mich doch nicht bedienen!“, sagte Maria entsetzt. „Doch. Das geht. Wenn du nicht gewesen wärst, dann läge ich jetzt dort, wo du liegst. Also? Etwas leckeren Apfelkuchen?“ „Gern“, gab Maria ihrem immer noch knurrenden Magen nach und die Herrin verschwand aus dem Raum.
Wenige Augenblicke später erschien die Herrin mit einem Teller. Der Kuchen war genauso lecker, wie die Suppe zuvor und Maria freute sich schon darauf, diese Frau kennenzulernen, die diesen Kuchen gezaubert hatte. Mit dem Geschmack von Äpfeln auf ihren Lippen schlief sie ein und träumte von dem Kuchen, den ihre Großmutter immer gebacken hatte. Der schmeckte diesem hier sehr ähnlich.
Aus diesem Apfeltraum riss Cornelia sie wieder heraus, die an Marias Bett stand. „Deine Sachen“, sagte sie und hielt ein Unterhemd hoch. „Hilfst du mir beim Anziehen?“, fragte Maria und Cornelia ging sofort an ihr Werk. „Dein Hintern hat auch was abbekommen“, stellte die Frau fest, doch Maria schüttelte den Kopf. „Das war meine alte Herrschaft“, erklärte sie nur und hob die Arme unter Schmerzen, damit Cornelia ihr das Hemd über den Kopf ziehen konnte. „Kann ich auf mein Zimmer?“, fragte Maria danach, denn sie wollte lieber im Mägdezimmer bleiben und nicht hier unten im Gästezimmer. Auf Cornelia gestützt wechselte sie danach, barfuß und im Unterhemd, die Etage und schlief wenig später im Dachgeschoss weiter.
7. Kapitel
Hassliebe
Er liebte und hasste diese Manufaktur. Er liebte sie, weil sie ihm die Möglichkeit für ein sorgenfreies Leben bot. Und er hasste sie, weil es eben nur eine „Tuchmanufaktur“ war. Nur Stoff, kein Eisen, Silber oder irgendetwas anderes männliches. Nur weiches Tuch und keine Waffen. An den ohrenbetäubenden Lärm hatte sich Gregor schon lange gewöhnt und nahm ihn kaum noch wahr. Wie jeden Tag saß er in der Meisterstube, die etwas erhöht lag und ein großes Fenster zur Produktionshalle hatte. Von hier aus hatte er alles im Blick. Der Saal war durch große Fenster beleuchtet, aber die waren nicht zum Wohl der Belegschaft da, sondern weil nur so die Muster korrekt in das Tuch hinein gewebt und kontrolliert werden konnten. Vier Webstühle standen nebeneinander und einige Dutzend jeweils hintereinander. Von oben trieben riesige Transmissionsriemen die Stühle an, die an der Seite auf einer Welle liefen, welche wiederum von der kleinen Dampfmaschine angetrieben wurde, die hinter der Halle im Maschinenraum stand. Die Männer konnte man hier an zwei Händen abzählen. Einige hundert Frauen waren fleißig in der Halle beschäftigt. Manchmal allerdings nicht fleißig genug, wie er gerade wieder feststellen musste.
Er sah, wie eine Frau in der zweiten Reihe sich aufrichtete und sich den Rücken hielt. Wer für so etwas Zeit hatte, der brauchte mal wieder eine Kontrolle. Geräuschvoll erhob er sich und verließ den Raum. Zielsicher ging er auf die Frau zu, dabei nahm er allerdings in Kauf, dass er die anderen Frauen nun nicht mehr kontrollieren konnte.
Nach ein paar schnellen Schritten war er neben ihr. „Mach dich wieder an dein Werk!“, blaffte er sie an und sah die erschrockenen Augen. „Was trödelst du hier so rum?“, fragte er so laut, dass es trotz des Lärms sicher noch zwei Reihen entfernt zu hören war. Die Frau zuckte zusammen, als hätte sie eine Peitsche getroffen. Sie machte eine schnelle Verbeugung und arbeitete weiter.
Aufmerksam beobachtete er sie. Sicherlich war sie noch nicht lange achtzehn und doch waren ihre Wangen eingefallen, der Blick leer. Wie bei den anderen auch. Nun begann er den Stoff der Frau ausführlich zu kontrollieren und wurde schnell fündig. Ein gerissener Faden hatte im Stoff ein falsches Muster erzeugt. Triumphierend zeigte er darauf und nun flackerte Angst in den leeren Augen der jungen Frau. „Dafür ziehe ich dir einen Tageslohn ab!“, sagte er und wendete sich zu der Tafel am Rande des Ganges. Er nahm die Kreide und machte hinter dem Namen der Frau einen Strich.
Jede hier wusste, was das bedeutete. Ein Strich, ein Tageslohn. Zwei Striche, ein Wochenlohn. Drei Striche, Entlassung! Gregor wusste, dass die Frauen auf diese Arbeit angewiesen waren und daher war die Angst vor diesem Kreidezeichen bei ihnen so groß. Größer, als wenn er ihr eine Ohrfeige gegeben hätte. Mit großen Schritten ging wieder zurück zur Meisterbude. Zwei kleine Mädchen schleppten einen Korb an ihm vorbei. Sie mochten noch keine zehn Jahre alt sein, aber arbeiteten als Hilfskräfte für die Mütter hier mit.
Die Kinder holten volle Garnspindeln im Lager und brachen die leeren Spindeln dorthin zurück. Ständig waren sie unterwegs, damit keiner der Webstühle pausieren musste. Direkt neben ihm fiel eine der Spindeln zu Boden und rollte vor seine Füße. Gregor trat dagegen, fuhr eines der Mädchen an „Hole es!“ und die Kleine rannte hinter dem davonrollenden Holzzylinder her.
Schließlich war er wieder in der Kammer und ließ vom Fenster aus seinen Blick aufmerksam durch die Reihen gehen. Sicherlich hatte mehr wie eine dieser Frauen den Moment seiner Abwesenheit zum Verschnaufen genutzt, aber vielleicht hatte diese Demonstration seiner Macht ja auch geholfen. Der Meister kam herein und brachte eine Stoffprobe, die sie sich zusammen ansahen.
Dies sollte ein neues Muster für den sächsischen Königshof werden und ein bisschen machte es ihn schon Stolz, dass der König Stoffe aus ihrer Manufaktur haben wollte. Zusammen verließen sie die Stube und gingen zur Seite, wo auf einem separaten Webstuhl nur dieser edle Stoff produziert wurde. Natürlich von einem Mann. Einer Frau würde er nie diese Verantwortung übergeben.