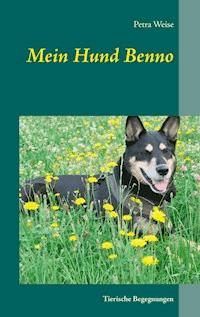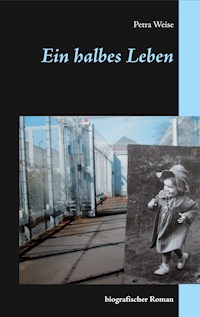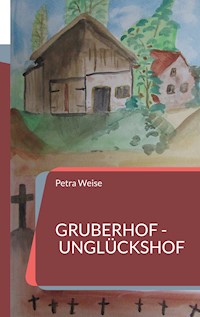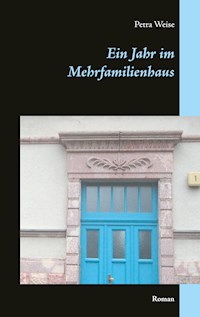Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zombie. So heißt die erste von 15 Kurzgeschichten. "Ein echter lebendiger Zombie mitten auf unserem Schulhof. Wir Kinder umringten das seltsame Wesen, das uns aus wasserblauen Augen stumm anstarrte, durch uns hindurch schaute, uns offenbar gar nicht wahrnahm." Zombie wird ein kleines Mädchen von ihren Mitschülern genannt und gehänselt. Der zehnjährige Erzähler lernt das Kind näher kennen und respektieren. Aber er wagt es nicht, Partei für das Mädchen zu ergreifen. In der Titelgeschichte erfährt ein junges Elternpaar, dass ihr vierjähriger Sohn krank ist, aber der Arzt nicht helfen kann. Damit beginnt ein dramatischer Kampf um die Gesundheit des Kindes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die wahre Lebenskunst
besteht darin,
im Alltäglichen
das Wunderbare zu sehen.
Pearl S. Buck
Inhalt
Zombie
Mein Fahrlehrer Heinrich
Die falsche Adresse
Rückflug in die Sackgasse
Disput um Mitternacht
Das Geburtstagsgeschenk
Denkanstoß
Der Irrtum
Unsere erste Radtour
Der Spaziergang
Die Sekretärin
Die Panne
Urlaub am Meer
Angela und Europa
Eine verhängnisvolle Diagnose
Zombie
„Zombie! Ein echter Zombie! Die erschreckt Tote mit ihrer Fresse.“
Die Kinder kreischten und sprangen johlend herum. Was war da los? Neugierig schlenderte ich quer über den Schulhof direkt auf die Gruppe zu. Normalerweise hielt ich mich lieber zurück, stand an den dicken Stamm der Kastanie gelehnt und schaute dem Treiben aus sicherer Entfernung zu. Ich mochte in keinen Händel hineingezogen werden. Zum Glück war ich für meine zehn Jahre recht groß und wurde von den anderen Jungen ohne jeden Kampf respektiert.
Neben der Schultreppe grölten mindestens zwanzig Kinder: „Zombie! Zombie!“
Sie schlugen sich gegenseitig brüllend auf die Schultern. Neugierig trat ich näher.
In der Mitte der Gruppe taumelte ein kleines Mädchen. Es musste aus der ersten Klasse sein, denn keiner von uns hatte es jemals vorher gesehen. Die Jungen stießen sich die Kleine wie einen Spielball zu riefen immer wieder: „Zombie!“
Ich schaute mir das Mädchen näher an. Die schmalen Schultern vermochten den riesigen Kopf kaum zu tragen. Mir schien, ihr Gesicht bestand nur aus einem schrecklich breiten Mund und vorstehenden, fleckigen Zähnen. Die stumpfen grauen Haare starrten wirr und strohig nach allen Seiten und verstärkten noch den Eindruck von einem Riesenschädel. Augen und Haut waren quittegelb. Spinnenhaft hingen dürre Ärmchen schlapp an den Seiten. Dazwischen blähte sich eine dicke Bauchtrommel wie ein aufgepusteter Luftballon. Entsetzt schaute ich weg. Zombie sah wirklich zu grässlich aus.
In diesem Moment bahnte sich Philipp aus der dritten Klasse einen Weg durch die Horde und stellte sich mit ausgebreiteten Armen schützend vor Zombie. Drohend schüttelte er seine Faust in jede Richtung und schrie: „Wer meine Schwester noch mal anrührt, der erlebt den nächsten Tag nicht mehr! Kapiert?!“
„Halts Maul, du Knirps!“ Frank grinste. „Du Zombiebruder.“
Langsam trat Philipp einen Schritt zurück. Er musterte sein Gegenüber, der sogar mich einen ganzen Kopf überragte. Frank hatte fast jedes Schuljahr wiederholt und war gut drei Jahre älter und gefürchteter als wir aus der Vierten.
Plötzlich duckte sich Philipp und hechtete Frank mit gesenktem Kopf mitten ins Gesicht. Der heulte auf und fasste sich an die Nase. Entsetzt starrte er auf seine blutverschmierte Hand.
Dann schlug er zurück. Philipp brüllte und warf sich rasend vor Zorn in die Menge. Er trat heftig mit den Beinen in jede Richtung und boxte sich mit Füßen und Fäusten eine Gasse. Langsam traten wir zurück, auch Frank machte Platz. Philipp drehte sich zu seiner Schwester um und strich ihr langsam und sanft über das Haar. Dann kramte er ein zerknülltes Taschentuch aus seiner Hose und wischte der Kleinen vorsichtig übers Gesicht. Sprachlos standen wir abseits und beobachteten, wie er die Hand seiner Schwester nahm und langsam und ohne sich umzuschauen mit ihr davonging.
Die meisten von uns waren Bauernkinder, die nach der Schule im Stall und auf dem Feld hart zupacken mussten. Für Zärtlichkeiten hatten wir keinen Sinn. Das war was für Mädchen. Und für Philipp. Der schämte sich nicht einmal, wenn er vor unseren Augen mit Mädchen Fangen spielte.
Wir spielten nie mit Mädchen. Und ganz selten mit Philipp. Manchmal setzten wir uns dazu, wenn er seine Geschichten erzählte. Er konnte fabelhaft erzählen. Keiner von uns wusste, ob er all die spannenden Abenteuer wirklich erlebt oder nur darüber gelesen oder sie sich einfach ausgedacht hatte.
Zur Schule kam er nun stets mit seiner Schwester. Er trug ihr den Ranzen, führte sie an der Hand und redete lachend auf sie ein. Zombie selbst sprach wenig. Manchmal dachte ich, sie nehme uns überhaupt nicht wahr. Nur, wenn einer von uns ganz nah an ihr vorbei ging, zuckte sie zusammen. Steif und mit geschlossenen Augen blieb sie dann stehen, als ob es dann keine möglichen Peiniger gäbe. Sie weinte nie, beklagte sich nicht, lief nicht einmal davon. Das konnten wir am allerwenigsten begreifen und verachteten sie wegen ihrer Ergebenheit aus tiefstem Herzen.
Täglich dachten wir uns neue Gemeinheiten aus. Oft schlugen wir ihr das Frühstück aus der Hand. Aber sie hob nur still das verschmutzte Brot auf und trug es in den Abfallkorb. In den Pausen stand sie abseits, dicht im Schatten der Schultreppe und spielte mit ihren Händen. Das war ein seltsames Schauspiel. Sie ließ ihre dünnen langen Finger durch die Luft laufen und schaute selbstvergessen dabei zu. Ihre dicken Lippen bewegten sich lautlos. Mal verzog sie bei ihrem Spiel den Mund, als ob sie weinte, dann wieder lachte sie. Mal streichelte sie beruhigend ihre Finger oder versuchte, mit der linken Hand den rechten Arm zu fangen.
Eines Tages sprach ich sie an: „Sag mal, was fuchtelst du dauernd mit deinen Fingern?“
„Ach, das sind meine Vögel.“ Sie lächelte. „Siehst du, wie schön sie sind?“ Fragend schaute sie mir direkt in die Augen. Dann sprach sie weiter: „Der linke ist böse, aber nur ein bisschen. Der rechte ist lieb, den mag ich besonders. Er hat so wunderschöne rote Federn.“
Wie zum Beweis streckte mir Zombie ihren rechten Arm vor die Nase.
„Du spinnst!“
Sie lachte. „Ach, ich spiele doch bloß. Sieh mal, wenn ich die Hand so halte“, sie formte ihre Finger wie einen Schnabel und ließ ihn auf- und zuschnappen, „dann reden meine Vögel. Genau wie die Menschen.“
Schelmisch blitzten ihre hellblauen Augen zu mir rauf. „Meine Vögel verstehen alles. Sie können sogar Gedanken lesen. Und wenn ich die Arme ausbreite, dann fliegen sie. Siehst du?“
Sie wippte mit den Armen und seufzte: „Ach, am liebsten würde ich mitfliegen, aber ich trau mich nicht. Willst du?“
Freundlich hielt sie mir ihre kleine rechte Hand entgegen und lachte. Ich war so überrascht, dass ich kein Wort hervorbrachte und einfach davonlief.
Zombies seltsame Vögel gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich betrachtete meine Finger von allen Seiten, aber wie schöne Vögel sahen sie nicht aus.
Am Nachmittag lief ich zur Halde. Von dort oben konnte man das ganze Dorf überblicken. In der Mitte stand die wuchtige Kirche, schräg dahinter unsere kleine Schule, ringsherum alte Kastanien. Links und rechts der Dorfstraße lagen nebeneinander die zwölf Höfe. Der kleinste gehörte dem Bäcker, in dem großen grauen am Ortsrand wohnte ich. Abseits vom Ort, direkt am Hang neben der Autobahn lag die Siedlung der Städter, die von Jahr zu Jahr größer wurde. Jetzt bauten sie schon zwischen unseren Höfen ihre Häuser.
Das schönste Grundstück lag am Waldrand. Das leuchtend gelb verputzte Haus inmitten einer großen Wiese war weithin zu sehen. Dort wohnte Zombie. Und genau dort wollte ich jetzt hin.
Schnell lief ich die Halde hinab, sprang mit einem Satz über den Saubach und quetschte mich zwischen den Sträuchern hindurch, die das Grundstück umsäumten. Weit und breit war kein Mensch zu sehen, nicht einmal ein Hund. Ich lehnte mich an einen Kirschbaum und sah mich um. Nicht weit von mir stand ein winziges knallrotes Holzhäuschen mit einer kleinen Tür, Gardinen an den Fenstern und einem Schornstein auf dem Dach. Eine Zwergenvilla. Die wollte ich mir näher ansehen.
Ich rannte quer über die Wiese direkt auf das kleine Häuschen zu und wäre fast über Zombie gestolpert. Sie lag im Gras und malte. Natürlich Vögel. Wunderschöne Vögel mit langen Federn und leuchtend bunten Flügeln. An die zehn Blätter lagen ringsum auf der Wiese verstreut, wo der Wind sie lebendig machte. Ein herrlicher Anblick. Wenn nur diese scheußliche Musik nicht gewesen wäre! Sie dröhnte ohrenbetäubend aus zwei Lautsprechern, die mitten im Gras aufgestellt waren. Ich wunderte mich, dass ich diesen Lärm auf dem ganzen Weg hierher nicht bemerkt hatte. Ein Männerchor sang seltsam abgehackte Melodien, begleitet von einem nervigen Getrommel.
„Magst du Santana? Nina hat alle Platten.“
Erschrocken fuhr ich herum.
Philipp grinste. „Ich guck dir schon ne ganze Weile zu. Da – mein Versteck.“ Er wies mit dem Kopf nach oben in den Kirschbaum.
Jetzt entdeckte ich den Brettersitz zwischen den Zweigen, auch eine gelb-schwarze Flagge. Philipp schwenkte eine Strickleiter in meine Richtung.
„Willst du mit rauf? Oder besuchst du Nina?“
„Wieso Nina?“
„Stell dich nicht so blöd! Hab doch gesehen, wie du auf ihre Bilder gestarrt hast.“
Jetzt begriff ich: Zombie hatte einen Namen - Nina.
„Komm nur! Die malt sowieso nur ihre Vögel.“ Philipp lachte und knuffte mich leicht in die Rippen. „Den Tick hat sie schon lange. Aber das ist noch nicht alles. Du musst sie mal beobachten, dauernd quatscht sie. Sie redet mit ihren Tieren. Musst dich nicht wundern, wenn du keine siehst. Die gibt´s nur in ihrer Fantasie. Sie kommandiert an die elf Hunde, eine Herde Gäule und ein paar Katzen.“ Wieder lachte Philipp.
„Und warum diese irre Musik?“
„Weiß nicht. Sie braucht das. Auch bei den Schulaufgaben dreht sie volle Pulle auf. Meist Santana oder Jethro Tull. Und Chicago, wenn sie sauer ist. Magst du die auch?“
Ich nickte eifrig, obwohl ich noch nie von solchen Namen gehört hatte.
Nina hatte aufgehört zu malen. Sie kauerte im Gras, die Arme um die angezogenen Knie geschlungen und schaute mich an. Mir war das unangenehm. Ich drehte mich zur Seite und betrachtete das kleine Häuschen.
„Kannst reinschauen, wenn du willst.“
Als erstes fiel mir ein Fernsehgerät auf, das auf einem knallroten Tisch stand. Gleich daneben die ebenfalls rote Stereoanlage, auf der sich eine Schallplatte drehte. Im Wandregal stapelten sich unzählige Platten, Musikkassetten, CDs und Bücher. Die ganze linke Hausecke füllte ein lustig bunter Sessel aus. Unter den beiden Fenstern diente ein breites Kieferholzbrett als Schreibtisch. Überall lagen Zettel, Bilder, Stifte und Stofftiere herum, sogar auf dem Teppichboden.
Es wurde ein recht lustiger Nachmittag. Nina entpuppte sich als hervorragende Spielgefährtin. Sie steckte voller spaßiger Einfälle, spielte fabelhaft Karten und erzählte pausenlos Witze. Zum Abschied schenkte sie mir eines ihrer Bilder mit einem roten und einem blaubunten Vogel.
Als ich am nächsten Morgen Nina wie immer versteckt hinter der Schultreppe entdeckte, winkte ich ihr zu und lief hinüber. Im gleichen Moment fielen mir Frank und die Anderen ein. Aber es war schon zu spät. Sie hatten uns längst entdeckt und brüllten im Chor: „Zombie hat nen Bräutigam! Zombiebraut und Bräutigam!“
Nina blieb ganz ruhig und schloss die Augen. Ich hasste sie.
„Das ist nicht wahr! Ich will Zombie das Brot wegwerfen.“
Aber keiner hörte auf mich. Tränen der Wut schossen mir in die Augen. Mir war entsetzlich übel. Die Kinder lachten immer lauter, schnitten Grimassen und kamen bedrohlich nahe. Ich fürchtete mich und lief weinend nach Hause.
Mutter erschrak über mein rotfleckiges Gesicht und steckte mich ins Bett. Ich bekam Fieber und war lange krank. Erst drei Wochen später durfte ich wieder zur Schule.
Gleich am ersten Tag erfuhr ich von Ninas Tod.
Das ist nun schon so viele Jahre her. Aber ich habe das kleine Mädchen nie vergessen und träume noch heute manchmal von ihren bunten Vögeln. Von dem, der ein bisschen böse ist und von dem lieben mit den starken Flügeln.
Mein Fahrlehrer Heinrich
„Können Sie nicht aufpassen? Sie sitzen hinter dem Steuer und nicht beim Friseur! Das war ein Stoppschild! Ein STOPPSCHILD! Was macht da ein normaler Mensch?“
Ich machte erst mal gar nichts, saß nur verschreckt hinter dem Lenkrad und war den Tränen nahe. Vorsichtig versuchte ich zu kuppeln. Nichts passierte. Die Karre rührte sich nicht. Meine nassen Hände rutschten ab, als ich die Gangschaltung abtastete. Verflixt, wo ist nur der erste Gang? Ich schloss die Augen und versuchte, mich zu konzentrieren. Mit der rechten Hand drückte ich den Schalthebel nach links und dann nach vorn. Geschafft. Nun langsam die Kupplung kommen lassen und vorsichtig Gas geben. Der kleine Fiat heulte auf und sprang mit einem wilden Satz schräg auf die Straße. Erschrocken ließ ich das Lenkrad los. Heinrich fasste zu. Er fluchte laut über Weiber am Steuer. Ich bat um Entschuldigung und übernahm schnell wieder das Lenkrad. Dabei achtete ich darauf, meine Hände genau auf „zehn nach neun“ - die rechte etwas rechts oben, die linke links in die Mitte – auszurichten.
Ich konzentrierte mich auf die Fahrspur und versuchte, ruhig zu atmen. Ein. Aus. Immer wieder. In den Innenspiegel schauen, blinken, Außenspiegel, Kopf drehen. Langsam und gleichmäßig fuhr der Fiat an.
Plötzlich ein Ruck. Der Gurt zerrte an meiner Schulter. Wir standen mitten auf der Kreuzung. Was hatte ich jetzt wieder falsch gemacht? Mir war entsetzlich heiß. Um mich herum hupten Autos. Die Fahrer wedelten mit ihren Händen vor ihrer Stirn, tippten sich an die Schläfen, grinsten höhnisch. Heinrich grinste zurück.
Eine Frau am Steuer. Man wusste Bescheid.
Heinrich brüllte mir ins Ohr: „Was sollte das nun wieder? Erst findet Madame Schlaftablette das Gaspedal nicht und jetzt nicht die Bremse.“
Ich zuckte zusammen. Was war denn passiert? Wieso fragt er nach der Bremse?
„Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich nicht gebremst hätte!?“
Aha. Heinrich hatte gebremst. Wegen IHM stand ich jetzt mitten auf der Kreuzung und wusste nicht weiter. Meine Knie zitterten. Aber nicht vor Angst. Ich war wütend.
Heinrich wetterte: „Geht das in kein Weiberhirn, dass man langsam an eine Vorfahrtstraße heranfährt?“
„Langsam? Aber ich fahre doch langsam. Sie meckern doch ständig, dass ich zu langsam bin.“
„Und warum siehst du das Vorfahrtschild nicht?“ Verächtlich duzte er mich und schimpfte noch einmal: „Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich nicht gebremst hätte.“
„Was wohl?“, fauchte ich zurück. „Wir würden jetzt nicht mitten auf der Kreuzung stehen.“ Ich drehte mich zu ihm um. „Sie bringen mich damit in Gefahr.“
„Sei nicht so frech! Fahre endlich an die Seite! Das wirst du wohl noch schaffen.“
An die Seite. An welche Seite? Habe ich jetzt Vorfahrt?
Heinrich erklärte mir keinen meiner Fehler. Ich wusste nur, dass ich alles falsch machte.
„Hast du Halsstarre, weil du dich nicht umdrehst? Oder verrutscht sonst die Frisur?“
„Rechts! Weißt du nicht, wo rechts ist?“
„Die Prüfung kannst du vergessen, wenn du nicht bald den dritten Gang findest.“
Ich schluckte. War ich wirklich nicht in der Lage, Auto fahren zu lernen? Glaubte mein Lehrer, ich sei zu dumm für den Führerschein? Nein – dumm war ich nicht. Für mein Abitur musste ich mich nicht groß anstrengen. Studieren wollte ich nicht, ich wollte Geld verdienen. Mein eigenes Geld. Mit meinem guten Abschluss war es leicht, den Lehrvertrag bei der Deutschen Bank zu bekommen. Ich galt als ruhig und ausgeglichen und kam mit den neuen Computerprogrammen leicht zurecht. Auch mit dem Beamer und dem neuen Kopierer hatte ich keinerlei Probleme.
Weshalb machte mich schon der Gedanke ans Autofahren so nervös? Bereits beim Einsteigen zitterte ich und hatte Mühe, den Zündschlüssel ins Schloss zu stecken. Ich schwitzte, weil ich Blinker und Scheibenwischer nicht auseinander halten konnte. Kein Wunder, dass mein Fahrlehrer keine Geduld mit mir hatte. In seiner Gegenwart brachte ich kaum ein Wort über die Lippen und freute mich jedes Mal, wenn die Fahrstunde endlich vorüber war.
Auf dem Heimweg trödelte ich durch den Park. Ich hatte keine Augen für die Enten, die in einer langen Reihe über den Weg watschelten. Ich dachte nur an den groben Fahrlehrer. Verärgert stieß ich einen kleinen Stein beiseite und ließ mich auf die nächste Bank fallen. Ein älterer Herr setzte sich zu mir.
„Na, Mädchen, zu viel gelaufen? Ja, ja, Sport ist gesund, aber ausruhen ist auch wichtig.“
Wieso zu viel gelaufen? Sehe ich wie ein Jogger aus? Ich sah an mir hinunter: völlig verschwitzter Schlabberpulli, weite Flanellhose, bequeme flache Sportschuhe. Die langen braunen Haare hatte ich mit einem einfachen Gummiband im Nacken zusammengebunden.
Nicht schön, aber zum Autofahren sehr praktisch. Ins Büro würde ich so gekleidet natürlich nicht gehen.
Zur nächsten Fahrstunde konnte ich nach der Arbeit nicht erst nach Hause laufen, um mich umzuziehen. Ich stand in meinem engen schwarzen Lederrock und meiner roten Lieblingsbluse am Treffpunkt nahe der Petrikirche. Große schwarze Onyxperlen glitzerten an meinen Ohren und an der Halskette. Ich war noch geschminkt, meine langen braunen Haare fielen locker über die Schultern. Statt der flachen Sportschuhe trug ich halbhohe Pumps, mit denen ich hoffentlich die Pedale im Auto bedienen konnte.
Heinrich lehnte an der Beifahrertür. Als er mich sah, zog er seinen Bauch ein. Ich musste schmunzeln. Heinrich lächelte mich an.
„Können wir?“, erkundigte ich mich vorsichtig.
Heinrich reagierte nicht. Mit offenem Mund starrte er mich an.
„Richter. Montag halb sechs.“
„Fräulein Richter?“
Ich nickte. „Haben Sie jemand anderen erwartet?“
„Nein. Nein, nein … ich wusste nur nicht. Ich meine...“
Was sollte dieses Gestotter bedeuten? Hatte er mich nicht erkannt? Ich lachte. Heinrich lachte sofort zurück.
„Wie geht es Ihnen?“, fragte er freundlich.
„Brauchen Sie noch was? Oder können wir sofort fahren?“
Natürlich können wir sofort fahren. Dafür bin ich schließlich hier. Ich sagte gar nichts, setzte mich schnell in den kleinen Wagen. Sofort saß Heinrich neben mir und wollte mir beim Anschnallen helfen.
„Geht´s?“
Ich nickte irritiert, aber ich verstand gar nichts.
Heinrich reichte mir den Zündschlüssel.
„Ganz ruhig bleiben! So ein hübsches, junges Mädchen wie Sie schummeln wir locker durch die Prüfung.“ Er blinzelte mir verschwörerisch zu.
Jetzt verstand ich. So tickt dieser Mann also.
Und mir war im gleichen Moment klar, wie ich mich verhalten musste.
Ich bat: „Bitte, könnten Sie so lieb sein und mir noch einmal erklären, worauf ich als erstes zu achten habe?“ Bemüht hilflos schaute ich Heinrich ins Gesicht.
Er versicherte eilig: „Selbstverständlich, Fräulein Richter. Selbstverständlich.“
Ich drehte den Schlüssel im Zündschloss um.
Der Motor heulte auf. Aber Heinrich blieb ruhig.
Er lächelte mich beruhigend an.
Heinrich hatte viel Geduld. Er gab genaue Anweisungen, wann ich zu kuppeln und wann ich in welchen Spiegel zu schauen hatte.
Ich seufzte. „Ihre starken Nerven möchte ich haben. Nur einen einzigen Tag. Wie leicht wäre dann meine Arbeit im Büro.“