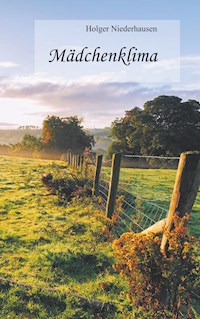Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die fünfzehnjährige Diana hat so tiefe Gedanken und Empfindungen, dass sie sich wie durch einen Abgrund von ihren Altersgenossen getrennt erlebt. Als sich ein Junge ihrer Klasse in sie verliebt, erlebt sie zum ersten Mal so etwas wie eine Brücke. Aber dann begegnet ihr noch ein Junge, der extrem intelligent ist, aber offenbar nicht fühlen kann. Und ausgerechnet in diesen Jungen verliebt sie sich - und nimmt den Kampf um seine Seele auf...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Menschenwesen hat eine tiefe Sehnsucht nach dem Schönen, Wahren und Guten. Diese kann von vielem anderen verschüttet worden sein, aber sie ist da. Und seine andere Sehnsucht ist, auch die eigene Seele zu einer Trägerin dessen zu entwickeln, wonach sich das Menschenwesen so sehnt.
Diese zweifache Sehnsucht wollen meine Bücher berühren, wieder bewusst machen, und dazu beitragen, dass sie stark und lebendig werden kann. Was die Seele empfindet und wirklich erstrebt, das ist ihr Wesen. Der Mensch kann ihr Wesen in etwas unendlich Schönes verwandeln, wenn er beginnt, seiner tiefsten Sehnsucht wahrhaftig zu folgen...
Sanftmut ist das heilige
Herz des Kosmos...
Sie betrachtete ihr Spiegelbild, gedankenversunken. Wie kam es, dass man gerade dieser Mensch war und kein anderer? War man das? Und wer war das, den man so sah, in so einem Spiegel?
Ein schönes Mädchen ... sie sah ein schönes Mädchen. Eine Weile betrachtete sie es so, als ob es ein fremdes Mädchen sei, an irgendeiner Straßenecke. Oder hinter einer Fensterscheibe. Der Spiegel als Fensterscheibe...
Und dieses Gefühl hatte sie oft. Dass sie gar nicht sie selber war. Nicht der, den man im Spiegel sehen konnte – und den Andere auch ohne Spiegel sahen. Sondern jemand ganz anderes. Oder keiner von allen. Nichts, was man sehen konnte. Die Gestalt, die sich im Spiegel zeigte, war zufällig. Sie hatte eigentlich keine Bedeutung...
Ihr Blick blieb an der herausgebrochenen Ecke des Spiegels hängen – links unten. Wann war diese Ecke herausgebrochen? Sie konnte sich nicht daran erinnern. Es musste vor ihrer Zeit gewesen sein. Und das war auch so etwas: manche Worte, manche Formulierungen. ,Vor meiner Zeit’... Wann war das gewesen? War etwas vor ihrer Zeit gewesen? Sie konnte sich nicht vorstellen, jemals einmal nicht dagewesen zu sein – ihrem Spiegelbild zum Trotz.
Aber diesen Spiegel hatte man auch einmal hergestellt. Da waren Menschen gewesen, und sie hatten einen Spiegel gemacht – diesen Spiegel. Sie wusste nicht, wie man Spiegel machte. Sie nahm sich vor, es herauszufinden. Aber, jedenfalls, dieser Spiegel wurde irgendwann gemacht – auch schon ,vor ihrer Zeit’, denn er war älter als die herausgebrochene Ecke. Vielleicht machte man so etwas heute auch ganz mit Maschinen, auch früher schon, und der Mensch legte nur einen Hebel um, und eine Spiegelmasse ergoss sich in eine Form, erkaltete – und fertig war der Spiegel. Und zwar genau jener Spiegel, in dem sich Diana Lehmann dann fünfzehn Jahre später betrachten würde – falls er nicht zu lange in der Fabrik und im Geschäft gelegen hatte, bis ihre Eltern ihn gekauft hatten.
Eltern... Wieso hatte man Eltern... Sie hatte sich all diese Gedanken schon unzählige Male gemacht – und nie eine Lösung gefunden. Natürlich, die Schule hatte eine Lösung, die Wissenschaft hatte eine Lösung. Aber was war überhaupt Wissenschaft? Warum gab es Wissenschaft? Und was wusste die Wissenschaft wirklich? Natürlich, sie wusste, wie aus einer Eizelle und einer Samenzelle ein Embryo hervorwuchs. Aber wusste sie wirklich, wie das geschah – oder nur dass es geschah?
Und wieso war man gerade der Embryo dieser Eltern? Natürlich, man konnte immer sagen: Du bist es nun mal. Aber wenn man sich damit nicht zufriedengab? Auch schon nicht damit, ein Embryo zu sein, ein Zellhaufen... Was war denn, bevor Ei- und Samenzelle zusammentrafen? Davor gab es sie, diese beiden, aber noch nichts anderes.
Und auf einmal gab es dann einen Zellhaufen ... und neun Monate später ein Etwas, das einen Namen bekam ... und das fünfzehn Jahre später, wie schon unzählige Male zuvor, vor dem Spiegel stand – genau diesem Spiegel, der mit der abgebrochenen Ecke –, und sich dann fragte: Bin ich das?
Man kam vom Hundertsten ins Tausendste mit solchen Fragen. Es ging ja mit dem Namen weiter. Wieso gaben einem die Eltern – was waren Eltern? – einem kurz nach der Geburt einen Namen? Und warum diesen? Ihre Mutter hatte irgendeine Beziehung zu jener sagenumwobenen Lady Diana gehabt, hatte sie irgendwie gemocht, und also auch den Namen, und das hatte ihrem Mann gereicht, er war einverstanden – und so hatte sie diesen Namen bekommen. Wie konnte so etwas reichen? Eine Idee, eine Sympathie – und ihr Vater war sogar nur ,einverstanden’ gewesen! Es fühlte sich fast an wie eine peinliche, unangenehme Situation: Der Zellhaufen ist ja groß geworden. Jetzt ist er da, ein Baby auf einmal – und nun hat es ja noch gar keinen Namen...!
Sie hatte einmal eine ähnliche Redensart gehört: Wenn etwas Hals über Kopf auf einmal da war. Wie ein Lottogewinn. Wie hieß sie noch...
Da fiel es ihr wieder ein: ,Wie die Jungfrau zum Kind...’ Das war auch so etwas: Wie einem plötzlich Dinge wieder einfielen... Aber jetzt durfte sie den Faden nicht verlieren. Jetzt war sie bei der Jungfrau mit dem Kind. Und ja, so war es auch mit dem Namen. Sie war zu ihrem Namen gekommen wie die Jungfrau zu dem Kind. Einfach so. Willkürlich war das. Sie hatte gar nicht mitreden können – wie auch? Aber ihrem Vater war es offenbar auch egal gewesen – und ihre Mutter dachte sich: Ich will sie Diana nennen, nach meiner Lieblings-Prinzessin.
Aber hatte sie irgendetwas mit dieser Lady Diana zu tun? Doch rein gar nichts! Und trotzdem trug sie ihren Namen? Andererseits war diese Lady Diana nicht die Einzige, die so hieß. Nur, dass ihre Mutter sie wegen ihr so genannt hatte. Nun hieß sie also Diana.
Dieses Spiegelbild dort hieß Diana. Und das, was aus dem Zellhaufen geworden war, der sich aus zwei Zellen entwickelt hatte, die noch nichts davon gewesen waren, und was sich jetzt in dem Spiegel spiegelte, also das Gesicht mit dem ganzen Körper unten dran. Das hieß Diana. Eigentlich brauchte das also gar nicht ihr Problem zu sein, wenn sie nicht so heißen wollte. Es hieß dann ja nur jemand anders so. Das Dumme war, dass einen alle auch so nannten. Weil alle nur das sahen, was sie jetzt auch im Spiegel sah. Es gab also keinen Ausweg. Man musste es so hinnehmen. Vorerst.
Wenn sie das Bild so ansah – wie sie es schon oft gemacht hatte –, gefiel ihr das Mädchen. Es war ein sehr schönes Mädchen. Aber das hieß trotzdem nicht, dass sie sich gefiel – denn so betrachtete sie es gar nicht. Manchmal natürlich schon. Manchmal musste man wissen, was im eigenen Gesicht los war, weil man zum Beispiel das Gefühl hatte, dass man etwas im Auge hatte. Oder weil man sich gerade kämmte – wobei man das auch blind machen konnte. Aber viel lieber betrachtete sie das Gesicht im Spiegel, indem sie sich sagte, das war jemand.
Und dann war es wie gesagt ein schönes Mädchen. Zu schön eigentlich. Das störte sie immer dann, wenn sie sich sagen musste, dass sie das selbst sei. Und wenn man die Folgen davon in der wirklichen Welt spürte. Am schönsten war es, das Mädchen nur zu betrachten – und zu denken: Was für ein schönes Mädchen! Ein Glück ist das jemand anders...
Und was fand sie an ihr schön? Nun, die Haare waren schön – schön seidig, lang, dunkelbraun, fast schwarz. Blaue Augen. Etwas zu kleine Nase – was aber Andere auch wiederum schön fanden. Der Mund – obwohl ihre ältere Schwester sie seit fast einem Jahr neidisch damit aufzog, dass er ,sexy’, ,sinnlich’ und auch sonst in jeder Hinsicht begehrenswert sei. Ihr war das alles viel zu viel – und gerne hätte sie es geändert. Aber solange er nur ihrem Spiegelbild gehörte, fand sie ihn schön. Ihr Spiegelbild würde sicherlich damit klarkommen...
Und zuletzt war da noch der Leberfleck etwas seitlich unter ihrem rechten Auge. Bei dem Spiegelbild dachte man, er gehörte zum linken Auge. Hier hatte sie wirklich sehr lange gebraucht, um zu verstehen, wie man einen Leberfleck schön finden konnte. Im Grunde hatte sie all die Jahre gebraucht, sich an ihn zu gewöhnen. Und erst in den letzten Monaten hatte sie das Gefühl gehabt, dass er schön sein könnte – wenn man alles unter gewissen Aspekten betrachtete.
Das war überhaupt das Allerwichtigste: wie man etwas betrachtete. Schon bei dem Leberfleck ging ihr das alles viel zu schnell. Die Menschen sagten dann entweder: ,schön’ oder aber: ,nicht schön’. Und schon war es fertig! Sie musste gestehen, dass es ihr bei dem Leberfleck ja scheinbar nicht anders gegangen war. Andererseits konnte sie sich zugute halten, dass sie nie aufgegeben hatte, von dem ,nicht schön’ zu einer anderen Möglichkeit zu kommen. Sie musste aber bemerken, dass die Menschen das sehr selten taten. Natürlich nicht bei dem Leberfleck ihres Spiegelbildes! Sondern generell...
Es ging alles auf der Welt viel zu schnell. Und wenn einmal etwas fertig war, war es fertig. Vor allem in den Köpfen. Umdenken taten sie dann nicht mehr, diese Köpfe. Aber warum denn nicht? Warum wollten Köpfe immer, dass alles fertig war? Vielleicht war ihnen das Umdenken zu anstrengend... Vielleicht wollten sie am liebsten überhaupt nicht denken. Obwohl sie trotzdem fortwährend dachten – aber eben immer das Gleiche...
Also der Leberfleck, um ihm nun auch wirklich gerecht zu werden – denn auch er hatte ein Recht darauf –, hatte aufgehört, in ihren Augen ,nicht schön’ zu sein. Sie wusste gar nicht recht, ob er damit in ihren Augen nun ,schön’ genannt werden durfte. Aber sie sagte sich, dass der Leberfleck gewiss sogar ein Recht darauf hatte, überhaupt nicht irgendwie genannt zu werden – oder sogar selber entscheiden zu dürfen, wie er genannt wurde. Sogar ,Leberfleck’ war die allerschlimmste Krücke, um überhaupt eine Benennung zu haben, die sich natürlich nur Erwachsene ausdenken konnten. Auf den ersten Blick schien es schöner, die andere Bezeichnung zu nehmen, von der sie auch irgendwann erfahren hatte: ,Schönheitsfleck’. Und doch fühlte sie den Fleck dadurch eigentlich auch erniedrigt – auf eine bloße Funktion, gleichsam nur kosmetisch.
In diesen letzten Monaten aber hatte sie gelernt – und eigentlich war das auch schon vorher der Fall gewesen, als sie ihn noch ,nicht schön’ gefunden hatte –, den Fleck an der Wange ernst zu nehmen. Das war auch so etwas, was niemand verstand, nicht Julia, ihre ältere Schwester, nicht Thomas, ihr jüngerer Bruder, aber auch nicht ihre Eltern, nicht die anderen Erwachsenen, überhaupt niemand, den sie kannte. Sie alle würden nicht verstehen, wenn sie versuchen würde, es zu erklären: Was es bedeutete, diesen Leberfleck ernst zu nehmen. Sie würden es also erstens nicht verstehen – und zweitens, selbst wenn sie es verstehen würden, würden sie sie für verrückt erklären. Also würden sie es noch immer nicht verstehen...
Dabei war es doch so einfach. Man nahm ihn einfach ernst! Er war weder ein Leberfleck noch bloß ein ,Schönheitsfleck’, sondern er war dieser Fleck, dort, genau an diesem Punkt ganz nah am Auge, etwa ein Zentimeter schräg unter dem Auge, zur Wange hin, den Übergang zur Wange bildend. Gleichsam wie ein treuer Hüter: ,Hier bin ich, ich kann nicht anders. Ich beschütze diese Wange...’
Dieser Fleck war genauso einzigartig wie alles andere. Die Menschen hielten sich immer für so einzigartig – aber sie hatten keine Ahnung, dass auch alles andere einzigartig war, sogar an ihnen, oder auch nicht an ihnen, aber eben auch jeder beliebige Leberfleck, der eben gar nicht beliebig war, sondern genau an diesem einen Ort saß. Wenn er einen Zentimeter weiter rechts säße, wäre er schon nicht mehr dieser, sondern ein anderer... Allein schon das Wort ,säße’! Er saß eben nicht, sondern er war da. Man konnte fast sagen, er lebte dort. Er existierte, wie sie auch existierte. Und sie, zumindest ihr Spiegelbild, konnte nicht ohne ihn existieren, weil es mit ihm existierte – und ohne ihn wäre es bereits ein anderes...
Aber darüber dachten die Menschen eben nie nach – und ernst nahmen sie es schon gar nicht. Dadurch war eben alles nur ein ,Leberfleck’ und fertig, ein ,Schönheitsfleck’ und fertig. Dadurch wurde das Gesicht vielleicht schöner, aber der Fleck war ganz unwichtig.
Sie jedenfalls hatte in den letzten Monaten begonnen, diesen Fleck zu lieben. Nicht, weil er ihr Gesicht schöner machte, sondern weil er da war. Weil er so war, wie er war. Weil er dazugehörte. Weil er nicht egal war. Weil er ein Recht darauf hatte, gesehen zu werden. Sie liebte ihn, wie sie die Blumen liebte, die zwei Häuser weiter aus den Blumenkästen eines Fensters leuchteten, das im Erdgeschoss jedem Passanten ins Auge fiel. Die meisten gingen trotzdem einfach so vorbei – aber das war es eben: Wenn man sie sah, waren sie schön, einfach weil Blumen schön waren...
Flecken waren nicht einfach schön. Aber konnte man sie nicht auch so behandeln wie Blumen? Sie hatten ein Recht darauf. Zumal auch sie die Straße – oder in diesem Fall das Gesicht – nicht verschandelten, sondern ihm schlicht und einfach nur eine eigene Note gaben. Aber sie waren auch etwas. Als solche konnte man sie doch respektieren? Wenn man das tat, konnte man sie aber auch mögen. Nicht an sich – also an seinem eigenen Gesicht –, sondern an sich, also als dieses. Es gab alles nur einmal auf der Welt.
Nun – man konnte reden und reden, die Leute würden es doch nicht verstehen...
„Diana? Diana! Wo bist du?“
*
Die Stimme ihrer Mutter riss sie aus ihren Gedanken.
„Hier, Mama. Im Bad!“
„Kannst du bitte Einkaufen gehen? Ich brauche Milch für meinen Kaffee. Und wir brauchen noch einiges andere. Morgen ist Sonntag.“
„Ja, Mama...“
Als sie in die Küche ging, erhielt sie von ihrer Mutter eine längere Einkaufsliste. Diese sah sie entschuldigend an und sagte:
„Ich weiß, eigentlich ist heute Thomas dran. Aber er hat ja bei Jakob übernachtet, und ich kann nicht immer warten, bis ihr alle wieder da seid und euer Amt übernehmen könnt...“
Im letzten Satz schwang einiger Ärger mit.
„Ist schon gut, Mama...“
Ihre Mutter blinzelte einmal lächelnd mit dem Auge.
„Meine Lieblingstochter!“, sagte sie dankbar.
Sie wandte sich um, um im Flur den Rollwagen für die Einkäufe zu nehmen und sich auf den Weg zu machen.
Als der Gehweg sie aufgenommen hatte und sie sich von ihren Füßen weiter führen ließ, ging ihr auch dies weiter nach. Sie fand es ja schön, dass sie ihrer Mutter eine Freude machen konnte. Aber so etwas wie das, was ihre Mutter dann gesagt hatte – meine Lieblingstochter –, war ihr immer tief unangenehm. Etwas in ihr wehrte sich dagegen. Sie wusste genau, was ihre Mutter meinte. Aber musste man das auch sagen? Reichte es nicht einfach, sich zu freuen? Musste man dann ,Lieblingstochter’ sagen und so eigentlich alles Schöne gleich wieder kaputtmachen?
Es machte ihr nichts aus, statt Thomas einkaufen zu gehen. Sie dachte an ihren jüngeren Bruder. Er hätte in derselben Situation einen Riesenaufstand gemacht. Er tat letztlich immer am wenigsten, fühlte sich aber immer am ungerechtesten behandelt. Wenn er auf irgendetwas schaute, war es immer die Frage: Wieviel müssen die anderen tun, bevor ich wieder dran bin? Ich habe schon dies-und-das gemacht. Warum nicht Diana? Warum nicht Julia? Julia macht gar nichts mehr!
Und das war der andere Streitpunkt. Ihre ältere Schwester war schon siebzehn. Inzwischen übernachtete sie mehr woanders als zuhause. So waren ihre Ämter eigentlich fast schon Makulatur. Sie existierten noch auf dem Papier und im Kopf, man wusste: Julia ist donnerstags und sonntags mit dem Abwasch dran. In Wirklichkeit aber wusch ihre Mutter inzwischen in zwei von drei Fällen selbst ab – weil sie einfach die Nase voll hatte und sie die Dienste auch nicht anders verteilt kriegten. Thomas hätte sich gegen jede Lösung, die nicht alles drittelte, kategorisch gesperrt.
Warum? Warum nur? War es so schwierig, etwas für die Familie zu tun? Wieso dachte er immer, er würde benachteiligt? Wieso kam es überhaupt darauf an, nicht benachteiligt zu werden – und immer an erster Stelle zu stehen im Nie-mehrals-andere-machen-Wettbewerb? Warum merkte er gar nicht, wie er dadurch war – und wurde?
Und Julia war nicht viel anders – inzwischen. Deswegen war sie ja ,Mamas Lieblingstochter’. Aber darum ging es ihr gar nicht. Sie fand es im Prinzip furchtbar, dass die Familie zerfiel. Julia war mit ihren Freunden und Freundinnen beschäftigt und betrachtete die Familie oder das Zuhause im wesentlichen nur noch als Durchgangsstation. Wenn sie zuhause war, ging sie davon aus, dass man sich freute, war im Prinzip selbst auch ganz nett, aber hielt Vorträge über das, was sie gerade dachte und mochte, und nahm wenig Rücksicht darauf, ob man das überhaupt hören wollte.
Sie hatte soviel verstanden, dass das ein Zustand zwischen Pubertät und Erwachsenwerden war. Julia benahm sich wie eine fast Erwachsene, die dies zumindest glaubte zu sein, und die gar nicht merkte, wie sehr sie sich in den Mittelpunkt drängte, wenn sie mal da war. Aber wenn das so war, wollte sie weder in die Pubertät kommen, noch erwachsen werden. Aber das konnte kein Naturgesetz sein, denn sie selbst war doch gar nicht so – und sie war auch schon fünfzehn, das hieß, weit drin in der Pubertät... Was war das überhaupt?
Sie merkte natürlich, was das war – körperlich. Aber sonst? Sie sah nur all die anderen Mädchen und Jungen, die in der Pubertät waren – und sah auch da sehr genau, was es war. Aber immer mehr litt sie daran und wunderte sich darüber und fragte sich, wieso all diese Mädchen und Jungen so waren. Und auch die Erwachsenen. Die ganze Welt... Eine einzige große Frage. Leidvolle Frage...
*
In der Fußgängerzone sah sie die Frau. Sie sah diese Menschen sofort – Menschen, die Andere ,Bettler’ nannten, weil sie um Geld baten, obwohl das Wort aus dem Mittelalter stammte und sich seitdem nicht geändert hatte. Ein Wort wie ,Leberfleck’, nichtssagend, hässlich.
Die Frau saß hier in der Fußgängerzone neben einer Sitzbank auf dem Boden, mit einem Pappbecher, und sie hielt den Kopf gesenkt. Sie hatte sie noch nie gesehen. Die Frau hatte lange graue Haare und mochte vielleicht sechzig Jahre alt sein. Ihr Gewissen zog sich heftig zusammen, als sie an ihr vorüberging. Sie musste sie dabei die ganze Zeit ansehen – die Frau hatte ein liebes, verhärmtes Gesicht. Warum saß sie da? Sie schämte sich, erst einkaufen zu wollen und dann wiederzukommen. Aber dann hatte man mehr Ruhe...
Sie musste ihren Blick von der Frau fast losreißen. Wieso sah niemand anders sie an? Sie sah auch niemanden an – und das konnte man so gut verstehen! Aber wieso sah sie niemand an? Das konnte sie nie, niemals verstehen...
Der Gedanke an die Frau, das Bild der Frau, es begleitete sie bis in den Supermarkt. Nur halb bei der Sache, steckte sie einen Euro in den Einkaufswagen und fuhr durch die Gänge, dabei die Einkaufsliste Schritt für Schritt durchgehend. Auch das tat ihr weh. Dieses abgepackte Gemüse, all diese Dinge, Riesenstapel, Regale, Gänge, lauter Dinge – und wie sie hergestellt wurden. Ohne Rücksicht... Ihr Vorschlag, im Bio-Supermarkt einzukaufen, war von ihren Eltern glattweg abgelehnt worden. ,So viel verdienen wir nicht’, hieß es. Dabei hatte ihr Vater einen guten Job bei der Stadtverwaltung. Aber er war ,Alleinverdiener’. Reichte es dann nicht? Reichte es dann nicht, um die Natur zu schützen, um Lebensmittel zu essen, die ohne Gift produziert waren? Aber sie hatten doch ein Auto. Sie fuhren im Sommer in den Urlaub. Und Julia bekam pro Monat fünfzig Euro Taschengeld. Sie hätte gar nicht gewusst, was sie damit tun soll, und hatte vor einem Jahr zu ihrem vierzehnten Geburtstag nach vielen Jahren eine Erhöhung auf fünf Euro in der Woche bekommen. Sie fand das noch immer unglaublich viel. Damit konnte man sich jeden Monat ein Buch kaufen. Oder etwas anderes. Aber fünfzig Euro im Monat! Natürlich musste Julia damit ihre ganzen Kosmetika auch bezahlen – aber wenn sie sie brauchte! Mit fünfzig Euro im Monat könnte man aber auch die Welt retten – und Monat für Monat Lebensmittel ohne Gift kaufen. Aber dafür war kein Geld da...?
Traurig rollte sie mit dem Einkaufswagen an die Kasse und stellte sich in die Schlange. Sie spürte es im Bauch – bis da hinein tat es weh, nicht körperlich, aber seelisch. All diese Dinge im Wagen zu sehen, von denen man wusste: das ist nicht richtig. Das ist falsch. Und alle, alle tun es. Und keiner denkt darüber nach. Aber es ist falsch. Auch sie tat es. Weil sie den Kampf nicht führen konnte. Weil sie Streit nicht ertrug. Aber sie wusste, dass es falsch war, und sie litt daran. Obwohl sie als die ,Lieblingstochter’ sogar am allermeisten einkaufte. Wie verrückt war diese Welt...
Als sie dran war, bezahlte sie mit dem Fünfzig-Euro-Schein ihrer Mutter und verstaute das Wechselgeld im Einkaufs-Portemonnaie. Dann packte sie alles Eingekaufte in den Rollwagen, fuhr den Einkaufswagen zurück und begab sich wieder in die Fußgängerzone.
Jetzt hatte sie alles erledigt, was sie musste, und nun war sie frei. Gleich würde die Frau wieder da sein – noch immer dort sitzen –, und dann würde sie mit ihr sprechen. Sie hatte schon mit so vielen dieser armen Menschen gesprochen. Man musste mit ihnen sprechen. Wieso tat es keiner?
Als sie die Bank mit der Frau wiedersah, fuhr sie hinter der Bank herum, an der Frau vorbei, stellte ihren Wagen neben sich und setzte sich dann neben der Frau. Es war ein warmer Aprilmorgen.
Sie umschlang ihre von ihrem Frühlingskleid bedeckten Beine und schaute vorsichtig zu der Frau, die neben ihr saß – und die voller Erstaunen verfolgt hatte, was gerade neben ihr geschah.
„Guten Morgen...“, sagte sie zu der Frau unsicher.
Sie wollte auch nie in die Privatsphäre eindringen, obwohl diese Menschen schon so wenig Privatsphäre hatten...
„Guten Morgen...“, sagte die Frau traurig und ebenfalls etwas verunsichert.
Jetzt erst wurde ihr deutlich, dass dies für die Frau der falsche
Gruß gewesen sein musste.
„Sind sie...“, fragte sie befangen, „sind sie schon ... schon lange hier?“
„Hier?“, fragte die Frau müde. „Hier in dieser Stadt? Hier auf der Straße?“
Sie schämte sich und kam sich fast so vor, als würde jede ihrer Fragen die Frau doch belästigen. Dabei wollte sie so sehr das Gegenteil.
„Ich weiß nicht...“, sagte sie unsicher. „Sind ... Sie denn nicht von hier?“
„Nein...“
„Aber – wieso sind Sie dann hier?“
Die Frau hatte so ein liebes, armes Gesicht...
„Mein Mann“, begann die Frau mit müder, leiser Stimme, als wolle sie nicht, dass die vorbeigehenden Passanten etwas hörten, die nun vielfach schauten – auf einmal, weil sie jetzt mit da saß –, „er war, also er ist – Alkoholiker. Und – und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten...“
Es war eine Grenzwanderung... Ein Tasten im heiligen Reich eines völlig fremden Lebens.
„Und dann...?“, fragte sie so vorsichtig wie möglich.
„Dann bin ich ... hier gibt es ein Hilfszentrum. Für Frauen.
Da bin ich hingefahren. Es gibt Notunterkünfte, zum Übernachten, haben sie gesagt – und da konnte ich bis jetzt übernachten. Aber das ist nicht dauerhaft. Ich weiß nicht, wo ich bleiben soll.“
Sie war entsetzt.
„Und die Leute vom Hilfszentrum?“
Die Frau seufzte.
„Es gibt Formulare. Es gibt so vieles. Aber ich hab dazu im
Moment keine Kraft. Ich bin ja erst vor drei Tagen angekommen. Sie haben gesagt, ich soll meinen Mann verklagen. Aber das kann ich nicht. Ich kann so was nicht...“
„Verklagen? Warum denn?“
Die Frau schaute sie einige Momente schweigend an. Dann sagte sie:
„Das willst du alles gar nicht wissen...“
Betroffen schwieg sie. In solchen Momenten fühlte sie sich klein, behandelt wie ein kleines Kind. Vielleicht wollte sie es nicht wissen, das konnte sein – aber wie wollten andere Menschen wissen, was sie wissen wollte und was nicht? Wieso entschieden sie einfach über sie?
„Er hat mich geschlagen...“, sagte die Frau nun leise. „Und auch noch Schlimmeres...“
Nun schämte sie sich fast. Jetzt fühlte sie sich wirklich, als wäre sie in das Privateste der Frau eingedrungen. Sie wusste nicht, was das noch Schlimmere war. Aber sie konnte es sich denken. Und sie hatte von der Frau niemals verlangen wollen, das zu gestehen. Sie hatte nicht gewusst, dass es so schlimm war. Betroffen schwieg sie...
„Tut mir leid...“, murmelte sie dann.
Die Frau kam ihr sehr einsam vor, einsam und verloren.
„Und die Formulare?“, fragte sie leise, sich fortwährend irgendwie schuldig fühlend, weil sie so wenig verstand und noch weniger machen konnte. „Was gibt es noch – außer das Verklagen...?“
Die Frau schüttelte müde den Kopf.
„Ich weiß es nicht... Theoretisch müsste ich ja zurück, aber das kann ich ja nicht. Theoretisch ist eine andere Behörde zuständig – aber jetzt bin ich ja hier. Ich kann nicht mehr zurück. Theoretisch müsste ich umziehen, mich ummelden, was auch immer...“
Wieder schüttelte die Frau den Kopf.
„Ich weiß es nicht...“
„Also Sie brauchen etwas zum Schlafen?“
„Ja... Erstmal...“
Die Frau sah sie mit leiser Hoffnung an, als hätte sie etwas.
Wieder schämte sie sich.
„Es tut mir leid...“, sagte sie leise. „Ich – ich hab ja auch nichts...“
„Ja, natürlich...“, sagte die Frau mit geschwundener Hoffnung. „Es ist nett von dir, dass du trotzdem gefragt hast...“
Sie war auf einmal unsicher, ob sie noch willkommen war, oder ob sie nun eine Last wurde, wenn sie noch blieb.
„Es tut mir sehr leid...“, sagte sie aufrichtig.
Die Frau schwieg eine Weile. Ihre Gefühle strömten zu der Frau hin...
„Weißt du...“, sagte diese nun wiederum leise, „du bist der erste Mensch, der in dieser Stadt mit mir spricht. Außer den
Leuten vom Hilfszentrum, meine ich...“
Tief betroffen konnte sie nur schweigen. In so einem Moment hatte man einfach keine Worte.
„Dafür danke ich dir...“
„Das müssen Sie nicht“, erwiderte sie voller Mitleid, und nun begegneten sich ihre Blicke einen langen Moment, bis sie dem
Blick der Frau ausweichen musste...
Am liebsten hätte sie den Arm der Frau gestreichelt, oder ihren Rücken – irgendetwas... Aber das wagte sie nicht.
„Brauchen Sie jetzt irgendetwas?“, fragte sie warm. „Ich hab gerade eingekauft... Gemüse, Obst.“
„Du bist so nett, Mädchen... Ich habe etwas Geld bekommen.
Ich kann mir auch nachher etwas zu essen kaufen. Aber einen
Apfel vielleicht – wenn du mir einen geben kannst...“
„Aber natürlich!“
Sie war so froh, dass sie irgendetwas tun konnte, dass sie fast überstürzt aufstand und in dem Rollwagen umständlich nach den Äpfeln fischte, bis sie die Tüte erwischt hatte und einen davon herausnahm.
„Wollen Sie vielleicht zwei?“, fragte sie die Frau.
„Nein – einer reicht, liebes Kind...“
Sie reichte ihn der Frau. Die ganze Zeit begleitete sie das Gefühl, so unendlich wenig tun zu können. Ein fortwährender leiser Strom der Scham...
„Und wie heißt du?“, fragte die Frau nun dankbar.
„Diana.“
„Diana? Ein schöner Name...“
„Finden Sie?“
„Aber ja!“
„Und wieso?“
„Wieso? Er ist doch schön. Sehr schön sogar. Ein schöner
Klang...“
Es war ihr ein wenig unangenehm, so schön über ihren Namen gesprochen zu hören.
„Und Sie?“, fragte sie schüchtern. „Wie heißen Sie...?“
„Gisela. Gisela Franke.“
Ein Schweigen trat ein. Da hatte ein Mensch einfach einen Namen. Jeder Name war ein Mensch. Und auf einmal hatte ein solcher Mensch kein Zuhause mehr. Und eine alte Frau hieß auf einmal Gisela Franke – und hatte seit drei Tagen kein Zuhause mehr, sondern war jetzt hier in ihrer Stadt, und der einzige Platz, den sie hatte, waren die Pflastersteine der Fußgängerzone neben der Bank in der Nähe des Supermarktes...
„Soll ich...“, fragte sie unsicher, „soll ich Ihnen ... meine Telefonnummer oder Adresse geben? Falls Sie vielleicht Hilfe brauchen ... ich meine, Sie brauchen natürlich Hilfe, aber ich meine – ich wollte sagen – –“
„Ach, du liebes Mädchen. Ja, schon gerne. Aber ich will dir auch nicht zu nahe treten. Ich werde schon irgendwie zurechtkommen. Aber – ja, freuen würde ich mich, dich wiederzusehen... Überhaupt...“
„Gut...“, sagte sie unbeholfen, weil sie selbst gar nichts zum Aufschreiben dabeihatte. „Haben Sie ... also ... haben Sie etwas zum Schreiben?“
„Ja...“
Die Frau kramte in einem kleinen Beutel, der neben ihr lag, und fischte einen kleinen, abgegriffenen Notizblock und einen alten Kugelschreiber hervor. Sie reichte ihr beides. Die Geste rührte sie sehr – um so mehr, als sie beim Aufschlagen bemerkte, dass es bereits Eintragungen gab und sie über diese privaten Eintragungen hinwegblättern musste, um die leeren Seiten zu finden.
„Also“, sagte sie zögernd, „dann schreibe ich – hierhin?“
„Ja, bitte.“
Sie trug in ihrer schönsten Schrift ihren Namen mit Adresse und Telefonnummer ein. Man konnte dies heute gar nicht ohne Unbehagen tun, weil es so viele Geschichten in der Welt gab – und immer wieder hieß es: Gib nicht deine Daten heraus! Aber Google hatte ohnehin alle Daten – und so viele andere Konzerne, von denen man es kaum wusste, der amerikanische Geheimdienst, und wer noch alles. Aber eine liebe Frau, die nichts mehr hatte, durfte ihre Adresse nicht bekommen? Doch, sie durfte!
Wieder gab sie mit diesem Strom von Mitleid der Frau das alte Notizbuch und den Stift zurück.
„Bitte...“
„Danke, liebes Kind.“
„Dann ... dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal alles Gute...
Ich ... ich komme jedenfalls sehr oft hier vorbei. Wenn Sie dann ... noch da sind...“
„Vielen Dank, Diana. Du bist wirklich wie ein Engel gewesen. Ich wünsche dir auch alles Gute!“
„Danke...“, sagte sie mit tiefer Verlegenheit.
Dann erhob sie sich unbeholfen und sah die Frau noch einmal an.
„Auf Wiedersehen...“
Sie winkte aus nächster Nähe unbeholfen einmal kurz mit ihrer Hand.
Die Frau grüßte zurück.
„Auf Wiedersehen...“
Sie konnte sich nicht von einem Menschen verabschieden, ohne sich noch mindestens zwei- oder dreimal umzusehen. Wie war so etwas möglich? So etwas wie Abschiede? Wie konnte man auseinandergehen, wenn man eben noch in einer Begegnung war? Wie konnte so etwas wie eine Begegnung beendet werden? Es war, als zerrisse man einen Faden, ein Band, ja, ein Netz, eine Hülle. Eine zarte Eihülle, wie die von einem Küken, die nicht kaputtgehen durfte, weil das Küken ja noch drin war.
*
Als sie bei einem Müsli mit ihrer Mutter am Tisch saß, während diese ihren Kaffee mit Milch trank, sagte sie möglichst beiläufig:
„Mama – wenn jetzt eine Frau von ihrem Mann geschlagen wurde, und Schlimmeres... Und ... wenn sie dann von ihm weggelaufen wäre. Und wenn sie –“
Ihre Mutter hatte sie begreifend gemustert und schließlich mit ihrer ganzen Miene alles gestoppt.
„Diana...“, unterbrach sie sie mit diesem typischen entlarvenden Ton, „hast du etwa wieder jemanden auf der Straße getroffen und dich mit ihm unterhalten?“
„Nicht jemanden, Mama“, antwortete sie nun verzweifelt. „Es war eine Frau. Eine liebe alte Frau. Ihr Mann hat sie geschlagen, und –“
„Und wir können nicht für alles Leid in der Welt verantwortlich sein, Diana!“, vervollständigte ihre Mutter den Satz auf ihre Weise. „Wann begreifst du das endlich?“
Hilflos sah sie ihre Mutter an.
„Ich ... ich kann das nicht begreifen, Mama! Was heißt denn ,alles Leid in der Welt’? Sie ist doch hier! Hier in unserer Stadt, Mama – ganz in der Nähe. Bei der Bank kurz vor dem Supermarkt. Da sitzt sie jetzt – und hat niemanden. Und ihr Name ist Gisela – Gisela Franke. Das ist nicht alles Leid in der Welt. Es ist eine Frau...“
„Nein“, sagte ihre Mutter entschieden. „Wir können ihr jedenfalls nicht helfen, Diana.“
„Sie könnte in meinem –“
„Nein, Diana!“, unterband ihre Mutter nun alle Vorschläge, ohne sie angehört zu haben. „Sie könnte gar nichts. Nicht bei uns. Das geht nicht, Diana – verstehst du denn nicht? Du kannst nicht einfach Menschen aufnehmen. Du kennst sie gar nicht. Und man kommt auf die Dauer gar nicht miteinander klar, das kann ich dir schon jetzt voraussagen. Du stellst dir das immer alles so leicht vor. Das ist es aber nicht. Die Frau muss sehen, wie man ihr helfen kann. Wir können es nicht. Wirklich nicht.“
Das war dann immer das Ende eines solchen Gesprächs. Ein Machtwort. Das, was die Mutter dachte – oder der Vater –, das zählte. Natürlich. Es war ja nicht ihre Wohnung. Sie konnte also nichts tun, als es zu versuchen. Aber es scheiterte immer.
Sie schwieg betroffen.
„Diana...“, versuchte ihre Mutter es nun wieder gutmütig.
„Ich meine – versuchst du es denn wenigstens zu verstehen?
Ich kann ja deine Gedanken auch verstehen. Aber versuchst
du denn auch, unsere Position, unsere ... Überlegungen zu verstehen?“
Sie sah ihre Mutter traurig an. Auf solche Fragen konnte man dann immer nicht mehr antworten... Sie gaben einem ein schlechtes Gewissen, dass man es angeblich nicht versuchte.
Weil die Erwachsenen doch immer weiser waren, mehr überschauten und die richtigeren Entscheidungen trafen.
„Ich kann euch verstehen“, erwiderte sie. „Aber ich verstehe es trotzdem nicht...“
Die Mutter seufzte.
„Na ja“, sagte diese schließlich. „Komm erstmal in unser Alter. Wenn du dann einmal drei Kinder hast und so weiter ... vielleicht verstehst du es dann...“
Und das war das zweite ,Argument’. Sie wollte ja aber gar nicht so werden!
„Ja, Mama...“
Ihr Wunsch nach Harmonie war immer so groß... Und doch wurde er immer nur so einseitig erfüllt – indem sie nachgab. Indem sie etwas ,einsah’, was ihr Herz niemals einsehen konnte. Aber darauf beruhte die Harmonie. Dass ihr Herz einsehen musste, während alle anderen nicht einsehen brauchten. Ihr Herz musste einsehen, dass alle anderen nicht so waren wie sie...
*
Ursprünglich hatte sie sich für diesen Samstag vorgenommen, das Buch weiterzulesen, das sie angefangen hatte. Sie hatte vor kurzem einen schwedischen Schriftsteller entdeckt, Peter Pohl, und nun hatte sie das zweite Buch von ihm begonnen, ,Ich bin Malin’. Aber obwohl sein Stil sich von allem unterschied, was sie bisher gelesen hatte, und er sie außerordentlich berührte, konnte sie sich doch nicht entschließen, ihr Vorhaben wahrzumachen. Zu sehr ging ihr die Begegnung mit der Frau nach. Lieber wollte sie jetzt allein sein, draußen. Sie machte sich also zwei Brote für unterwegs, sagte ihren Eltern Bescheid und machte sich dann auf den Weg.
Es gab ein Naherholungsgebiet, das mit dem Bus in zwanzig Minuten zu erreichen war. Hier ging sie oft spazieren. Es gab einen Weg, der durch die Felder führte, teilweise sogar durch Landschafts- und Naturschutzgebiet. Sie liebte die Natur – und fühlte sich auf solchen einsamen Wanderungen immer wundersam geborgen...
Als sie den Bus bestieg, waren nicht allzu viele Menschen darin. Das war nicht ungewöhnlich. Es gab genügend andere Ausflugsziele. Auch war es gerade die Lücke zwischen Vormittag und Mittag. Dennoch saßen im hinteren Teil des Busses, wo sie sich ebenfalls hinsetzte, hinter ihr drei ältere Mädchen. Sie achtete zunächst nicht auf deren Gespräch, sondern sah nach draußen – aber die Mädchen unterhielten sich so ungeniert, dass man nach kurzer Zeit mithören musste, ob man wollte oder nicht.
Zuerst wurde ihr deutlich, dass die Mädchen in den nächsten Monaten ihr Abitur machten. Sie waren also drei Jahre älter als sie, gerade erwachsen geworden.
Jetzt erzählten sie von ihren ,Ex’. Ein Mädchen sagte:
„Ich hatte schon in der vierten einen Freund. Und in der sechsten hat er mit mir Schluss gemacht, weil ,ich zu viel Zeit bräuchte’.“
Sie glaubte, ihren Ohren nicht zu trauen. Wovon redeten diese Mädchen? Sie rechnete nach. In der vierten Klasse war man neun Jahre alt, in der sechsten dann elf...
Jetzt sprachen sie über ihren ersten Sex. Ein Mädchen sagte, das war mit fünfzehn. Eines hatte ihn schon mit vierzehn. Sie wurde rot, obwohl sie den Mädchen nur den Rücken zukehrte...
Sie sprachen über die Pille. Eines der Mädchen sagte:
„Allein schon, weil man sonst immer diskutieren muss: Willst du ein Baby oder nicht?“
Ein anderes sagte:
„Ich denke mir schon lange: wenn du achtzehn bist, kriegst du ein Baby. Safe. Aber wenn es so wäre – ich könnte nie abtreiben.“
„Das könnte ich auch nicht.“
„Ich meine, ich bin kein Gegner, oder so etwas. Wenn Frauen so was machen – das müssen sie entscheiden. Aber ich selbst, ich könnte das nicht. He, Leute – wir müssen raus!“
Für einen Moment sah sie noch einmal die drei Mädchen im Profil und dann ganz kurz, als sie ausgestiegen waren. So sah man also aus, wenn man sein Abitur machte und achtzehn geworden war. Und wenn man schon neun Jahre zuvor seinen ersten Freund hatte und schon seit vier Jahren offenbar ganz regelmäßig Sex...
Sie war völlig erschüttert. Ein wenig erinnerten diese Mädchen sie an ihre große Schwester, Julia. Bei ihr hatte sie sich nie gefragt, wie das alles war. Aber auch Julia traf sich mit verschiedensten Freunden – und hatte daneben einen festen Freund, wobei das auch wechselte. Und nun hatten diese drei Mädchen ihr völlig ungeniert offenbart, in einer Unterhaltung, in der jeder mithören konnte, sicher auch noch ein, zwei Fahrgäste ein paar Reihen weiter vorne, was heute auf diesem ,Gebiet’ normal war.
Sie fühlte sich völlig fremd. Berührt von einer fremden Welt, ganz fremd. Wie konnte man über diese Dinge so reden? Selbst ihr Erschrecken bekam sie kaum zu fassen – in dem, was genau sie so erschreckte. Allmählich wurde ihr es dann aber doch deutlich, dass es genau dies war: diese Art zu sprechen. Als wäre es normal. Nun – wenn man es normal fand, dann war es das auch. Dann gab es genau das: den ersten Freund, den zweiten, den dritten... Den ersten Sex, den zweiten, den dritten, den fünfundachtzigsten.
Sie würde das nie verstehen. Dass die anderen in ihrem Alter und in dem Alter dieser Mädchen so darüber redeten. Dann war das ... dann war es auch nicht anders als die neueste Episode der gerade laufenden Serien, in denen sich die anderen heute ja auch so hervorragend auskannten. Ob man nun Folge acht von Serie X in Staffel Y geschaut hatte – oder ob man Sex Nummer dreiundvierzig mit Freund Nummer neun gehabt hatte ... welchen Unterschied machte das noch? Dann war auch das nur noch ein ,Event’. Und dann warf man eben die Pille ein, um ,durchstarten’ zu können.
Sie fühlte fortwährend, wie ihre Seele erschauerte. Sie konnte das noch weniger verstehen, als dass ihre Eltern die alte Frau nicht aufnahmen. In ihre Eltern konnte sie sich noch ein wenig hineinfühlen. In diese Art, über diese Dinge zu sprechen, nicht mehr. Sie konnte sich vorstellen, dass es möglich war, weil es ja vor ihren Augen geschah. Aber sie konnte sich nicht vorstellen, wie man so werden konnte, wie man freiwillig so sprechen konnte. Wie man über das Heiligste überhauptso sprechen konnte, als würde man es ... von der Straße aufkratzen...
Sie musste aussteigen – der Bus hatte sein Ziel erreicht. Sie verließ die Bushaltestelle, und schon nahm die Natur sie auf. Um sie herum grünte es, blühte es vorsichtig – und sangen die Vögel.
Die Natur – warum fühlte sie sich in ihr nur so wohl? Man konnte in ihr noch das Kleinste lieben. Es war alles schön. Die unendliche, wunderschöne Landschaft, mit all ihren Einzelheiten – und dann bis hin zu dem kleinsten Baumstumpf mit den einzelnen Moospolstern darauf, ja noch die kleinsten Mooshälmchen. Die einzelnen Sämlein. Der kleinste Käfer. Alles – einfach alles. Alles war schön. Wie eine Biene zu den Weidenkätzchen flog. Wie sie fleißig Pollen und Honig sammelte und dann zu ihrem Stock trug. Dieses kleine, liebe Insekt – das sich so anstrengte, so fleißig war, man sah gar nicht, wie fleißig. Man sah ja immer nur Momente. Und schon diese kleinen Momente konnten einen so ungeheuer rühren... Nur dass auch dies niemand anders erlebte, offenbar niemand sonst.
In der Natur war alles so unglaublich schön. Man konnte es so sehr lieben. Es war in seiner Schönheit so unglaublich berührend. In seiner Schönheit – aber auch ... aber auch in ... seiner Unschuld. Die Natur war ganz und gar, wie sie war. In allem schön. Und so unglaublich unschuldig. Das Mooshälmchen. Die einzelne Blume. Der Baum. Der Käfer. Die Ameise. Die Biene. Alles war so völlig unschuldig. So wehrlos gegenüber dem Menschen auch.
Und dann waren da die Mädchen von heute, wie sie heute waren. Und die sahen das alles nicht. Die sahen nur ihre Handys. Die sahen und unterhielten sich über Freund Nummer X und über Sex Nummer Y, überhaupt nicht mehr gezählt. Alles normal. Nicht mehr der Rede wert. Zwar der Rede wert, denn man unterhielt sich ja darüber – aber gerade um so entheiligter...
Wenn man über die Natur reden würde, würde man sie auch ... nicht mitnehmen können in ihrer ganzen Schönheit. Man würde reden – aber die Natur wäre nicht mehr da. Man würde auch die Natur zerreden. Man zerredete heute alles – und sah nichts mehr.
Aber wie kam das? Wieso merkte man nicht – wie sehr man alles kaputtmachte? Schon durch das Reden! Schon durch die Art des Redens! Es war für sie ein völliges Rätsel. Sie verstand es nicht...
Was sie spürte, war, dass diese Mädchen offenbar stolz darauf waren, so zu sein. Irgendetwas fanden sie ,toll’ daran, so darüber zu reden: über ihre ersten Freunde schon mit neun, zehn Jahren. Über das gegenseitige ,Schlussmachen’ schon mit elf oder zwölf. Über den ersten Sex mit vierzehn oder fünfzehn – und dann immer weiter, mit achtzehn war es längst normal, alles normal, und man war stolz darüber! Wie konnte man darüber stolz sein? War das nicht unendlich furchtbar... Unendlich traurig und trostlos? Offenbar nicht für diese Mädchen. Sie fanden das alles offenbar toll. Dabei war es so schlimm – so schlimm...
Sie spürte, dass ihre Gefühle ein wenig so waren wie heute Morgen gegenüber der alten Frau. Ja – die Mädchen taten ihr wirklich irgendwie leid. Aber irgendwie auch nicht. Aber etwas tat ihr leid. Was war es dann aber? Was tat ihr leid? Womit hatte sie Mitleid?
Aber ja! Es war das, worum es ging – dieses selbst. Sie wusste noch nicht, wie das war: die Liebe. Die wirkliche Liebe. Das wusste sie noch nicht. Sie wusste nur eines: sie war nicht so, wie diese Mädchen davon redeten. Diese Mädchen kannten die Liebe überhaupt nicht – nicht die wirkliche... Sie redeten von etwas, was auch die neueste Serienepisode sein könnte – und das war es ja auch, eine Episode in einer unendlichen Serie, und die einzelnen Staffeln waren dann die wechselnden Freunde. Sie erschauerte wieder.
Womit aber hatte sie dann Mitleid? Sie spürte dieses Gefühl gegenüber dem, was diese Mädchen immer nicht kannten. Sie spürte ein unsägliches Leid darüber, dass dieses Etwas überhaupt nicht mehr gekannt wurde. Sie kannte es selbst auch noch nicht – und doch hatte sie so sehr das Gefühl, dass sie es viel besser kannte als all die anderen, die es gerade ... ja, wirklich mit Füßen traten...
Sie selbst würde dieses ,Etwas’ heilig halten, weil es wirklich heilig war.
Jetzt erinnerte sie sich auch wieder an ein Gespräch, das sie vor etwa einem Dreivierteljahr mit Julia gehabt hatte. Diese hatte sie neckend nach ihrem Freund gefragt – aber da war noch kein Freund. Dann hatte sie sie wieder mit ihrem ,sinnlichen Mund’ aufgezogen. Und dann hatte sie in etwa gesagt: ,Diana – ich glaube, du bist die Ultra-Idealistin, oder Romantikerin, oder wie man auch immer dazu sagen soll. Aber wir leben nicht mehr in einer solchen Zeit. Es gibt auch keine Traumprinzen mehr. Nimm es einfach, wie es kommt! Sonst kommt irgendwann nichts mehr... Dann hast du die Realität verträumt. Und die ist voller Jungs...’
Sie fand diese kleine Ansprache damals auch genauso furchtbar. Jetzt stellte sie fest, dass es genau das Gleiche war. Es war die Einstellung.
Wieder schauderte ihr Inneres. Es war ihr völlig egal, wie sehr die Welt ,voller Jungs’ war. Sie wollte überhaupt keine Welt voller Jungs – und schon gar nicht voll solchen, wie sie heute herumliefen. Gegen die allermeisten Jungs waren die Mädchen von eben ja noch harmlos! Das war das Schlimme: dass es immer noch schlimmer wurde...
Sie wollte niemanden, der so war. Keine Freundin, keinen Freund. Niemand, der so war, würde sie je verstehen. Würde es so jemanden überhaupt geben? Einen, der sie verstehen würde? Einen Einzigen? Ein Einziger würde ihr ja reichen... Ein Einziger... Sie glaubte nicht, dass es selbst nur einen Einzigen geben würde. Aber wie konnte es sein – dass für alle allein schon dies, die Liebe, auch die körperliche Liebe, so gewöhnlich war? Aber dann auch alles andere... Die Natur, die unendliche Schönheit... Die Blumen am Fenster eines Erdgeschosses. Eine alte Frau, die vor drei Tagen alles verloren hatte, was sie bis dahin gehabt hatte.
Warum? Warum sahen sie alle das nicht? Niemand... Warum sah es niemand...? Was machte sie alle so blind? Was für eine Art Blindheit war dies? Eine, auf die man noch stolz war – denn das sah sie ja auch: dass die Menschen auf diese Art von Blindheit stolz waren, so stolz...
Und das Rätsel wogte und würgte wieder in ihrem Bauch, bis dorthin spürbar, als leidvolle Frage, als unbeantwortetes Leid... Und dann spürte sie Tränen in sich aufsteigen – und wusste nicht, woher sie kamen, sie kamen einfach...
A

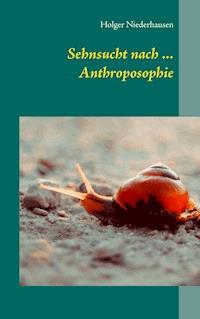

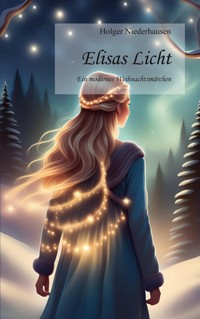
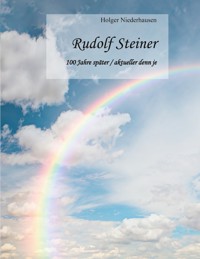







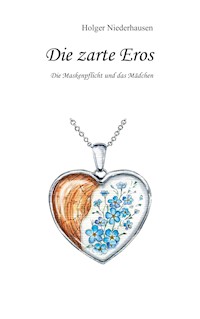



![Die [durchgestrichen: letzte] erste Unschuld - Holger Niederhausen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9d69c6320692c771bc65edda9a41b406/w200_u90.jpg)