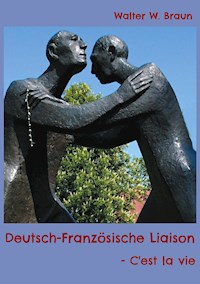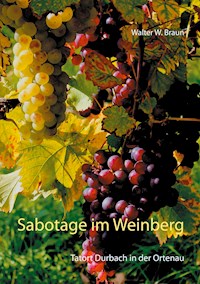
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ja wer macht denn so etwas, ist der entsetzte Aufschrei von Doris, einer Winzerin im idyllischen Weinort Durbach in der klimatisch verwöhnten Ortenau. Soeben musste sie von ihrem Mann hören, dass ein Übeltäter ihren gepflegten Weinberg durch Sabotage geschädigt, ja im Grunde total zerstört hat. Bisher hielten sie ihr Dorf, das geschützt in einem Talkessel und in einer lieblichen Region in Mittelbaden liegt, für intakt. Das Weindorf Durbach ist durch viele begehrte Auszeichnungen für exzellente Weine unter Kennern weltweit bekannt. Und unter den Einwohnern kennt jeder den anderen, alle sind in der dörflichen Gemeinschaft eingebunden, in der Gesinnung eher etwas traditionell und konservativ; sehr mit der Umwelt und Natur verbunden. Und nun diese frevelhafte Tat. Wird man den Täter finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort:
Der Wein- und Erholungsort Durbach mit einer Gemarkungsfläche von 2633 Hektar an der Badischen Weinstraße, liegt in der Vorbergzone zwischen Rheinebene und Schwarzwald, etwa sieben Kilometer von der Kreisstadt Offenburg entfernt. Eingebettet in gepflegte Weinberge mit endlos scheinenden vertikal und horizontal verlaufenden Rebenzeilen, und insgesamt 42 romantische Seitentäler, erstreckt sich Durbach entlang dem gleichnamigen Bach, der mitten durch den Ort fließt und teilweise links und rechts mit blumenbehangenen Schutzgeländern eingezäunt ist .
Aus Wikipedia
Durbach ist Schauplatz dieser fiktiven Geschichte, die sich aber so oder ähnlich jederzeit und in allen biologisch landwirtschaftlich ausgerichteten Bereichen zutragen könnte.
Walter W. Braun
Bühl, Oktober 2016
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Durbach, ein Bilderbuchort in der Ortenau
Das Erbe
Eine schwere Entscheidung
Ein neuer Weinberg
Prachtvolle Entwicklung
Ein großes Fest
Urlaub in Südafrika
Erste Ernte
Ursachenfindung
Sherlock Holmes ist unterwegs
Dem Täter auf der Spur
Dörfliche Solidarität
Tatkräftige Hilfe
Das Urteil
1Durbach, ein Bilderbuchort in der Ortenau
Die Sonne stand voll im Zenit und schien ungehindert und verschwenderisch vom wolkenlos azurblauen Himmel in die lieblichen Seitentäler des weithin bekannten Weindorfes Durbach, im klimatisch verwöhnten Ortenaukreis 1), nahe der Kreisstadt Offenburg. „Die Rheinebene vor der Haustür, das Ortsbild geprägt von den gleichmäßigen und sanften Reihen der unzähligen Rebstöcke, im Hintergrund eine typische Schwarzwaldlandschaft mit dunklen Wäldern, saftig grünen Wiesen und dabei den Mooskopf mit über 870 Meter immer im Blick“, so beschreibt es der Kenner. Von dort grüßt die Sagengestalt des Moospfaff 2) den neugierigen Betrachter.
Hier beginnt der andere Teil für die Wanderer auf unzähligen Wegen und ein Paradies für Naturliebhaber in den gepflegten Wäldern und Seitentälern.
Des Beschauers Blick wird unwillkürlich auf die akkurat in Reih' und Glied stehenden und zu tausende zählenden Weinstöcken gelenkt, die sich rund um den Ort wohlgeordnet an den mal steilen, mal sanft ansteigenden Hängen aufwärts ziehen. Rundum sieht man in den Sommermonaten nur ein sattes Grün, das im Herbst in die leuchtend buntesten Farben wechselt und dem Betrachter ein märchenhaft romantisches Bild hinzaubert. Tatsächlich bietet der Anblick zu jeder Jahreszeit eine Augenweide für die Bewohner im Ort und die vielen Besucher und Urlauber, die sich gerne an dieser Idylle erfreuen wollen. Zahlreich sind auch die Weinkenner, die die edlen Tropfen der hochdekorierten Winzer zu schätzen wissen und deshalb auch weite Anreisewege nicht scheuen.
Über dem romantischen Ort thront die nicht zu übersehende Kulisse des auf einer 383 Meter hohen Felsnase gebauten und heute noch bewohnten Schloss Staufenberg 3). Es blickt auf eine über tausendjährige bewegte Geschichte zurück und befindet sich heute noch im Besitz des Markgrafen von Baden, der hier kommerziellen Weinbau betreibt.
Neben dem exzellenten Weinanbau mit eigener Vermarktung bietet das Schloss unter der Regie vom Durbacher Hotelier Dominic Müller, der unten im Dorf auch das renommierte Hotel Ritter 4) betreibt, eine gut besuchte Gastronomie für Wanderer und Tagesgäste. Für manche Hochzeit oder Events aus anderen Anlässen, bot es auch schon den besonderen Rahmen und begehrte Location.
Schon wegen der atemberaubenden Aussicht wird das Schloss an schönen Tagen sonntags und werktags von zahlreichen Tagesgästen angesteuert. Der Besucher hat von der Terrasse der Gartenwirtschaft einen atemberaubenden Blick auf das geschützt in einem Kessel eingebetteten, rund 4000 Seelen zählende Dorf mit seinen vielen Seitentälern, und darüber weit hinaus nach Südwesten ins Rheintal. Im Dunst der Rheinebene ist die unverwechselbare Silhouette des Straßburger Münsters gut zu erkennen und darüber das sich im grauen Dunst verlierende Band des Vogesenkammes auf der Elsässer Seite, dem Gegenstück zum Schwarzwald.
Die Weinberge standen Ende Mai im satten Grün. Der Haupttrieb jeder Rebe wächst in diesem Stadium täglich um 2 bis 3 Zentimeter; man kann sozusagen dem Wachstum zusehen. Die Rebstöcke sehen wir in endlosen horizontalen und vertikal verlaufenden Reihen rund um das Dorf im Tal, aufsteigend an den weitläufigen Hängen. Sie sind nur unterbrochen von endlosen, geschwungenen Bändern der Wirtschaftswege, die es dem Winzer ermöglichen, mit seinen Fahrzeugen in den Weinberg zu kommen, denn mit der Kräze (Rückentragekorb aus Weidengeflecht – auch Kiepe oder Chräze) trägt schon lange niemand mehr die Ernte mühsam und kraftraubend ins Tal.
Das friedliche Bild ist unvergleichlich und zeugt noch von der intakten Natur in einer idyllischen, seit Generationen gepflegten Kulturlandschaft.
In der Ferne ist im Osten, wie ein mahnender Finger, der Moosturm auf dem Mooskopf zu erkennen, der mit über 800 Meter höchsten Erhebung zwischen den Schwarzwaldtälern Rench und Kinzig, benannt nach den heute noch glasklaren Flüssen, die mitten im Schwarzwald entspringen und westwärts dem Rhein zufließen.
Überall sah man in diesen Tagen emsige Hände, die fleißig Laub von den Weinstöcken lichteten, Triebe stutzten und geschickt zwischen zwei Drähten fixierten. Die Blütezeit war schon vorüber und die Gescheine entwickelten sich langsam und sichtbar prächtig zu Beeren. Nur wenige wissen, dass die Früchte der Reben genaugenommen Rispen sind, so wie Hafer oder Rispengras, die aber Beeren ausbilden. Die Pflanzen sahen nicht nur für den Kenner sehr gesund und vital aus. Nur der Fachmann weiß aber, welche Arbeit am Boden und am Stock dahinter steckt und der Winzer zu dieser Jahreszeit leisten muss, damit seine Trauben sich gut entwickeln und gedeihen können.
Aber auch der Laie durfte sich an der Pracht und Vielfalt erfreuen, während der Winzer sich berechtigte Hoffnung auf ein gutes Wachstum machte und im Herbst wieder eine üppige Ernte, der verdiente Lohn für Müh‘ und Arbeit eines mühsamen Arbeitsjahres. Dabei ist es mit der eingefahrenen Ernte noch lange nicht getan. Dann beginnt erst die eigentliche Arbeit im Keller, die viel Wissen und Erfahrung, sowie handwerkliches Können erfordert, wenn der Winzer den Wein gewinnen will, der bei seiner verwöhnten Kundschaft gut ankommen soll. Und das tut er, das zeigt der Medaillenregen, der jährlich bei den Prämierungen über das Dorf niedergeht.
Gerade im gegenwärtigen Stadium sind die Gescheine und Fruchtansätze noch sehr empfindlich. Dieses Frühjahr hatten aber keine Nachtfröste den Winzern im Tal Sorgenfalten auf die Stirn getrieben und schon ließ sich erahnen, dass ein guter Jahrgang heranreift. Somit sah jeder Weinbauer zuversichtlich und optimistisch der weiteren Entwicklung entgegen. Jetzt durfte nur nicht noch ein Hagel in der Vegetationszeit und vor der Ernte übers Tal ziehen.
„Fritz, bisch z’friede wies us sieht?“, (bist du zufrieden wie die Reben stehen) fragte der Männel-Buur, der gerade seinen Traktor bestieg und in seine Reben fahren wollte, den Müller-Fritz, seinen Nachbarn. „Sell scho, s‘sieht allewill gued us, wie's isch und bis jetzit no gell. S’derf halt nur kei Hagl un kei starkis Unwetter im Summer kumme“ (Schon, es sieht gut aus, wie es ist. Nur darf im Sommer kein Hagelschlag und kein starkes Unwetter kommen), gab der mit breitem Grinsen im Gesicht zur Antwort. Das verwunderte den erfahrenen Betrachter ein wenig, denn alle wissen doch, Landwirte pflegen prinzipiell immer zu klagen und waren, wenn sie direkt gefragt wurden, eigentlich nie zufrieden.
Kurz nach der Mittagszeit eines normalen Wochentages hatten weder Felix Hafner noch seine Frau Maria an einem ganz normalen Arbeitstag die Zeit, in ihrem eigenen Weinberg die nötigen Arbeiten zu tun. Sie fuhren erst am späteren Nachmittag in die Reben, dann, wenn sie in ihrem Hauptberuf hatten Feierabend machen können, und ansonsten zumindest an den Wochenenden. Sie mussten alles abends verrichten oder am Samstag, denn das Ehepaar betrieb überschaubare 3,8 Hektar Weinanbau nur im Nebenerwerb. Damit waren sie allerdings auch nicht die einzigen.
Ihr Weinberg befand sich in den bevorzugten Steillagen unterhalb des Schlosses. Die Spitzenlage durfte ohne Einschränkung als exquisit bezeichnet werden, und mancher Weinbauer aus dem Ort beneidete sie insgeheim um dieses Stück Land, ohne dass dies jemand öffentlich zugegeben hätte.
Einen nicht unwesentlichen Nachteil hatte es allerdings. Die Fläche wäre viel zu klein, um sie im Haupterwerb zu bewirtschaften und davon auch noch leben zu können. Das war vor 30 Jahren bei ihrem Großvater, von dem sie das Gelände geerbt haben, noch ganz anders. Damals konnte ein Winzer durchaus mit 3 oder 4 Hektar auskommen, wenn man zusätzlich noch etwas Gemüse anbaute und Obst zur Eigenversorgung ernten konnte. Heute reicht das nicht mehr aus. Doch auch in der Freizeit kümmerte sich das Ehepaar intensiv und leidenschaftlich um „ihren Weinberg“, um ihr bescheidenes kleines Paradies.
Im Hauptberuf ging Felix der Tätigkeit als Sicherheitsingenieur in einem größeren Offenburger Industriebetrieb nach. Dort sah er bei Anlagen und eingesetzten Stoffen penibel nach dem Rechten. Seine Aufgabe war es, alle sicherheitsrelevanten Aspekte zu beschreiben, zu überwachen und konsequent dafür zu sorgen, dass von ihnen für die Mitarbeiter und die Umwelt keine Gefahren ausgingen.
Diese Tätigkeit hat sich in den letzten 20 Jahren sehr verändert und spezialisiert. Immer mehr Vorschriften kamen im Laufe der Jahre dazu, die es zu beachten gilt. Gerade von der EU werden die Unternehmen mit allen möglichen Gesetzen und Verordnungen überschwemmt. Die Reglementierung der eingesetzten Stoffe wird immer unübersichtlicher, der Papierkrieg nimmt gigantische Formen an und das fordert für ihn und seine Mitarbeiter Tag für Tag ein engagiertes Vorgehen. „Wenn in ein paar tausend Jahren Wesen von einem anderen Stern hier landen würden und dann archäologische Untersuchungen betreiben, dann werden sie annehmen, hier muss eine Papierfabrik gestanden haben“, spottete Hafner manchmal sarkastisch, wenn ihn der Papierkrieg wieder allzu sehr nervte.
Menschlich ist Felix Hafner nicht gerade stromlinienförmig, sondern eher progressiv gestrickt und hat durchaus seine Ecken und Kanten, ist aber offen und ehrlich. Auf ihn ist absolut Verlass. Das gilt sowohl im privaten Leben, wo er seit der Jugendzeit gerne einmal Grenzen überschritt und hin und wieder ordentlich über die Stränge schlug, natürlich noch im tragbaren Rahmen und ohne gegen Gesetze zu verstoßen. Und so demzufolge handelt er auch beruflich.
Gerade im Beruf gibt er sich selbstbewusst und achtet sehr darauf, dass die Normen eingehalten werden, und bei der Sicherheit kennt er keine Kompromisse. Das machte ihn nicht unbedingt beliebt, aber bisher wurde er geachtet und ist auch von der Geschäftsleitung respektiert und geschätzt. Manche gutdotierte Prämie landete schon auf seinem Konto, die ihm für umsetzbare Verbesserungsvorschläge zugestanden wurde, verbunden mit viel Lob und Anerkennung. „Sie sind halt noch ein Ingenieur der alten Schule, einer von denen, die selber auch noch eine Maschine bedienen können“, sagte man ihm einmal in einer Laudatio anlässlich einer Ehrung. „Ja, mein Vater, der in russischer Gefangenschaft war, hat schon davon berichtet, dass ihre Peiniger vor den Deutschen einen Heidenrespekt hatten und sie behaupteten ohne Scherz: Die können aus jeder Blechbüchse eine Bombe basteln“, verriet er einmal lachend in diesem Kreis. „Über meine handwerklichen Fähigkeiten bin ich durchaus Stolz.“
Privat war Felix schon viele Jahre voll im dörflichen Umfeld eingebunden. Sein Wort zählt im Turn- und Sportverein, er ist im Männergesangverein 1865 Durbach e.V. aktiv und dort als 2. Bass mit sicherer Stimme gefragt, ehrenamtlich ist er auch im Verein „Wein- und Heimatmuseum“ engagiert und er mischt sich gerne als Hästräger bei den Fastnachtsveranstaltungen unters närrische Volk. Das wären eigentlich genug Felder, um die nicht unbegrenzte Freizeit voll auszufüllen. Eine Last war ihm sein Tun bisher jedoch nie; es war ihm eher ein Vergnügen. Jeder kennt jeden im Dorf, da tauscht man sich aus und hilft sich auch gegenseitig, wo es nötig ist. Im ländlichen Bereich von Baden und speziell in der Ortenau ist die Welt im toleranten Miteinander noch in Ordnung. Ob sich allerdings sein Einsatz zukünftig neben dem Weinbau so fortsetzen lassen wird, das war noch nicht übersehbar und stand in den Sternen.
Seine Frau Maria Hafner geht seit ihrer Lehre und einer Weiterbildung ihrem Job als Sekretärin in Oberkirch nach. Sie ist die rechte Hand des Vorstandsvorsitzenden eines traditionellen, weltweit agierenden Industrieunternehmens. Um zum Arbeitsplatz zu kommen, musste sie nur über den Berg fahren und durch das liebliche, auch vom Wein- und Obstbau geprägten Bottenau talwärts, wo sich vor ihr dann das weite Renchtal öffnet. Dieses Tal ist weithin als bevorzugtes Obstparadies bekannt. Die Erdbeerplantagen haben Ausmaße mehrerer Fußballfelder und die Spalierbäume der Apfelplantagen sind nicht mehr überschaubar, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die endlosen Reihen an Turbo-Apfelbäumen sind heute über Quadratkilometer mit Netzen überspannt, die sowohl vor Hagel schützen sollen, wie die empfindlichen Äpfel auch vor dem Sonnenbrand. Warum der Begriff Turbo-Apfelbäume? Weil den tragenden Apfelbäumen vielleicht 10 Jahre gegönnt sind, dann werden sie ausgerissen und neue Bäume angepflanzt. Damit schlägt der Bauer zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe. Erstens können bei den kurzstämmigen Sorten die reifen Früchte leichter vom Boden aus gepflückt werden; es bedarf keiner Leiter mehr, wie es früher bei den Obstbäumen notwendig war. Zweitens wird dem verwöhnten Supermarkt-Kunden eine vom Äußeren her farblich makellose Frucht geboten, auch wenn sie geschmacklich nichts mehr hergibt. Und drittens kann er so schneller auf Modeerscheinungen reagieren, wenn der Kunde wieder einmal eine neue Sorte bevorzugt, die noch besser lagerfähig ist, noch länger haltbar, und so weiter. Das aber ist eine andere Geschichte.
Zurück zu Maria Hafner und ihrem Job. Für ihren Chef ist sie schon lange als rechte Hand unverzichtbar geworden und in vielem hält sie ihm den Rücken frei; aber nicht nur das, sie verstand sich stets als Vermittlerin und ausgleichende Instanz im Betrieb zwischen Mitarbeitern, Abteilungsleitern, Meistern und anderen Entscheidungsträgern einerseits, sowie dem Vorstand und der Geschäftsleitung andererseits. Von allen Seiten wird ihr ein glückliches „Händchen“ in dieser Aufgabe bescheinigt und oft wurde sie schon gelobt und gewürdigt. In der Freizeit betätigte sie ebenfalls, sowohl in Frauen Aktiv e.V., wie im Pfarrgemeinderat der katholischen Kirche, und wenn im Dorf ein Fest ausrichtet wird, gehört sie wie selbstverständlich zu den fleißigen Helferinnen, die ohne großes Aufsehen darüberzumachen, wirken und arbeiten und für einen reibungslosen Ablauf sorgen.
Oben: Blick auf Schloss Staufenberg, unten: In den Talkessel
1 ) https://www.durbach.de/
2https://www.nordrach.de/pb/1324765.html)
3 ) https://www.schloss-staufenberg.de/
4 ) https://www.ritter-durbach.de/
2Das Erbe
Den Weinberg hatte Felix Hafner vor 4 Jahren von seinem Großvater geerbt. Schon als Bub und Schüler hatte sein Opa ihn in die Reben mitgenommen und Felix war immer gerne dabei gewesen. Dabei erlernte er so nebenbei allerlei über die Geheimnisse und notwendigen Grundlagen des Weinanbaus. Natürlich half er später zwischendurch auch im Keller mit oder war wunderfizig (neugierig) dabei, wenn der eingelagerte Wein reifte und seinen letzten Schliff erhielt. Damals hinterließ jeder Winzer noch mehr seine eigene Handschrift in Geschmack, Charakter und Säure bei seinem Erzeugnis – und schon damals wollte jeder der Beste sein. Sein Großvater hatte die Winzerei noch im Vollerwerb betrieben, nebenbei aber auch verschiedene Obstsorten geerntet und die Früchte zu Most und Schnaps verarbeitet. Zum Schnaps brennen besaß er ein Brennrecht 5), das allerdings vor Jahren abgelaufen ist. Sein Großvater Anton Hafner hatte es nicht mehr verlängern lassen, sondern das Kontingent an einen Kollegen zu einem guten Preis verkauft.
Felix bedauerte das ein wenig – nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Das Hobby Schnaps brennen hätte er gerne nebenbei betrieben und sicher daran viel Freude gehabt. Dafür hätte er nach der Traubenernte sogar gut den anfallenden Trester und die Hefe verwerten und verarbeiten können. Nicht nur die Italiener vermögen einen guten Grappa zu brennen. Die Deutschen verstehen das auch, und die Grundlage für den Tresterbrand 6) ist quasi ein kostenloses Abfallprodukt.
Nebenbei haben seine Großeltern auf kleineren Flächen Kartoffeln angebaut, sowie auf den eigenen Feldern nahe beim Haus und auf anderen etwas weiter entfernt im Dorf, alles angepflanzt, was die Familie an Gemüse und Früchten zum eigenen Bedarf brauchte. Obst und Gemüse wurde, soweit Felix denken konnte, nie zugekauft; alles wurde aus dem eigenem Anbau verwertet und darauf waren sie stolz, das sparte eine Menge Geld. Noch in den 60er-Jahren lagerten vom Herbst an 15 Zentner Kartoffeln im trockenen, kühlen Keller und es standen drei Fässer Most für die durstigen Kehlen bereit. Gut 100 Gläser Eingemachtes füllten die Regale. Dazu wurde jährlich zweimal ein im Stall gemästetes Schwein geschlachtet. Das sicherte den Speiseplan auch in Notzeiten und lieferte reichlich Vorrat für Feste mit der Familie und mit den zahlreichen Verwandten aus beiden Linien, aus denen sie abstammten. „Für meine Großeltern waren das goldene Zeiten, sie waren bescheiden, vor allem aber zufrieden und ausgeglichen“, wie Felix sich gerne an Opa und Oma väterlicherseits erinnerte.