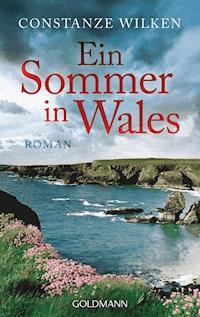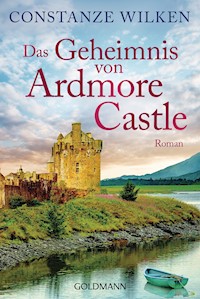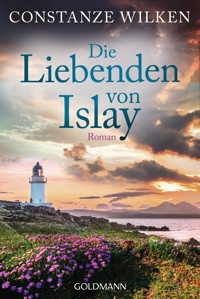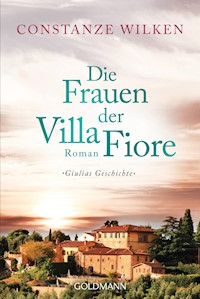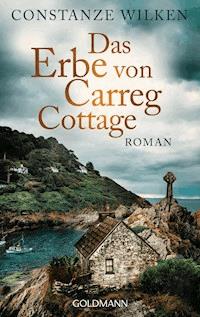8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Sie soll eine versunkene walisische Burg untersuchen – und stößt auf ein Rätsel aus ihrer eigenen Familie...
Als die junge Archäologin Dr. Samantha Goodwin den Auftrag erhält, eine vor der walisischen Küste versunkene Burganlage zu untersuchen, sagt sie begeistert zu. Sie freut sich nicht nur auf die interessante Arbeit, sondern auch auf ein Wiedersehen mit ihrer Großmutter Gwen, die im nahegelegenen Fischerdorf Borth lebt. Dann stößt Sam bei ihren Untersuchungen auf ein Skelett, das seit höchstens sechzig Jahren auf dem Meeresgrund liegt. Gwen ist davon überzeugt, dass es sich um Sams Großvater Arthur handelt, der vor Jahren in einer stürmischen Nacht auf dem Meer verschwand. Samantha beginnt nachzuforschen und begibt sich in große Gefahr. Denn manchmal ist es besser, die Toten ruhen zu lassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Ähnliche
Buch
Als die junge Archäologin Dr. Samantha Goodwin den Auftrag zur Untersuchung einer versunkenen Burganlage an der walisischen Küste erhält, die der Legende nach zum verschollenen Königreich von Cantre’r Gwaelod gehört, ist sie begeistert. Sie quartiert sich bei ihrer Großmutter Gwen ein, die in einem kleinen Cottage im Fischerdorf Borth ganz in der Nähe wohnt. Auf dem Weg zur Ausgrabungsstätte begegnet Sam dem kleinen Max und seinem Vater, dem Bootsbauer Luke Sherman, der sich seit dem Unfalltod seiner Frau liebevoll um Max kümmert. Sam fühlt sich sofort zu dem charismatischen Luke hingezogen. Und auch Luke kann sein Interesse an Sam nicht verhehlen.
Doch Sams Untersuchungen auf dem Meeresboden bringen mehr als antike Funde zu Tage: Sie stößt auf einen Toten, der kaum länger als 60 Jahre dort gelegen hat. Die alte Gwen ist davon überzeugt, dass es sich um ihren Mann, Sams Großvater Arthur, handelt, der vor Jahren in einer stürmischen Nacht auf dem Meer verschwand, dessen Leiche jedoch nie gefunden wurde. Als Sam zusammen mit Luke der Sache nachgeht und im Dorf Nachforschungen anstellt, schlägt ihr breite Ablehnung entgegen, und sie fühlt sich verfolgt. Es scheint, als ob irgendjemand um jeden Preis verhindern will, dass sie das Rätsel um ihren Großvater löst. Und dann gerät Sam in tödliche Gefahr …
Informationen zu Constanze Wilken
und weiteren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
CONSTANZE WILKEN
Sturm
über dem Meer
Roman
Für Alessa
Das versunkene Königreich Cantre’r Gwaelod
Cantre’r Gwaelod war einst ein mächtiges Königreich. In der Bucht von Cardigan hatten die Menschen dem Meer in mühevoller Arbeit fruchtbares Land abgerungen. Dieses Land wurde von einem starken Deich beschützt. Ein Hektar dieses Landes war so viel wert wie vier Hektar anderswo. In dem Deich befand sich ein Schleusentor, das bei Ebbe geöffnet wurde, um das Wasser abfließen zu lassen. Bei Flut musste das Tor geschlossen werden, um das Land und die Menschen vor dem Meer zu schützen. Jede Nacht wurde eigens ein Wächter zur Sicherung der Schleuse bestimmt.
Anno Domini 600 wehte ein Sturm von Südwest herauf und trieb eine Springflut gegen die Deiche. In dieser Nacht fiel Seithennin, einem Freund von König Gwyddno Garanhir, Longshanks genannt, die ehrenvolle Aufgabe der Schleusenwache zu. Aber Seithennin war ein verworfener Geselle, der gern trank und mit den Weibern tändelte. Es trug sich zu, dass Seithennin auf einer Feier in Aberystwyth war und seine Pflicht vergaß.
Das Meer stieg weiter und weiter, und der Sturm drückte die aufgewühlten Fluten gegen den Deich von Cantre’r Gwaelod. Seithennin aber lag in den Armen der schönen Meredid und dachte nicht an seine Leute, die arglos in den Dörfern hinter dem Deich schliefen. Und so kam es, dass das wütende Meer sich Bahn brechen konnte durch die offenen Tore. Das fruchtbare Land mit sechzehn Dörfern wurde überschwemmt. Die meisten Bewohner wurden im Schlaf vom Wasser überrascht und ertranken elendiglich, genau wie das Vieh. Nur König Longshanks und einigen Mitgliedern seines Hofstaats gelang die Flucht nach Sarn Cynfelin.
Nach diesem schrecklichen Unglück war der Deich zerstört, das fruchtbare Land verloren, und der König und seine Leute mussten ein ärmliches Dasein in den nahen Hügeln von Wales fristen.
Seitdem, so geht die Legende, läuten die Glocken von Cantre’r Gwaelod, wenn Gefahr droht.
Machynlleth, 20. Dezember 1955
Ein kalter Wind fegte über den Platz am Uhrenturm. Schnee drückte auf die Dächer des Bergdorfs, das durch die spärlichen bunten Lichter kaum freundlicher wirkte. Die Mauern der Häuser waren aus den grauen Steinen der Berge ringsherum erbaut und trotzten seit Jahrhunderten dem unwirtlichen walisischen Wetter. In der nasskalten Luft mischten sich die Gerüche von Schafdung, heißem Gewürzwein und Fettgebackenem, denn die Schafzüchter der Gegend hatten ihre Tiere zum letzten großen Markt des Jahres zusammengetrieben. Die Männer, rotgesichtig, mit dicken Wollmützen, die Kragen der Wachstuchmäntel hochgeschlagen, feilschten um Preise für den besten Bock, wie sie es seit Jahrhunderten taten. Es wurde gejohlt und gelacht, gefeixt und gebrüllt, und am Ende besiegelte ein Handschlag das Geschäft.
Eine Gruppe Zigeuner spielte zum Tanz auf und bot exotische Waren feil. Kurz vor Weihnachten waren die Menschen spendabler, auch wenn sie selbst nicht viel zum Leben hatten. Der lange Krieg hatte allen zugesetzt, doch den Walisern mehr, denn der wirtschaftliche Aufschwung fand in England statt, nicht in entlegenen Bergdörfern an der Irischen See. So kurz vor Weihnachten suchten die Frauen nach letzten Zutaten für das Festessen, hatten vielleicht auch einen Groschen für bunten Tand übrig, den sie sonst nicht kaufen würden. Aber die Kinderaugen sollten leuchten, lange genug hatten sie alle gedarbt und sich nach friedlichen, blühenden Zeiten gesehnt.
Früher hatte ein steinernes keltisches Kreuz über Machynlleth und seine Bewohner gewacht. Unter Queen Viktoria hatte es zu Ehren des Markgrafen von Londonderry einem hässlichen neugotischen Uhrenturm weichen müssen.
Niemand achtete auf den kleinen Mann mit der tief ins Gesicht gezogenen Mütze, dem groben Wollschal, den er sich bis über die Nase gezogen hatte, und den Stiefeln, in denen eine ausgebeulte graue Hose steckte.
Er trug einen Segeltuchsack auf dem Rücken, den er mit beiden Händen festhielt, als habe er Angst, man könne ihn berauben. Dabei sah der Mann viel zu ärmlich aus, als dass man mehr als ein totes Lamm oder einen Haufen Felle in dem Sack vermutet hätte. Seine Hände waren rau und kräftig von harter Arbeit an der Luft. Unsicher schaute er sich um und winkte abweisend, als ein Zigeunermädchen ihm einen Seidenschal unter die Nase hielt. Er merkte nicht, dass ihm die Schafe blökend aus dem Weg gehen mussten, weil er nicht darauf achtete, wo er hintrat.
Sein ungelenkes Verhalten ließ erahnen, dass er nicht oft unter Menschen war. Er lächelte nicht, obwohl angesichts des nahen Weihnachtsfestes die meisten fröhlich wirkten. Zumindest ein Mal im Jahr wollte man vergessen, wollte die Mühsal des täglichen Daseins in süßem, heißem Wein ertränken und essen und singen, bis der Pfarrer von der Kanzel den Kopf schüttelte und mahnend, wenn auch mit einem Augenzwinkern, den Finger hob. Davon war der Mann mit dem Seesack weit entfernt. Er stand jetzt direkt neben dem Sockel des Uhrenturms und starrte auf die Häuserreihe dahinter.
Die dunkelblaue Fassade gehörte zur Bank, vor dem roten Haus baumelte ein goldener Fuchs und verkörperte den Namen des Pubs. Daneben standen im Schaufenster eines Fachwerkhauses alte Medizinflaschen und Gefäße mit lateinischen Namen und machten das Apothekenschild überflüssig. Langsam ging der Mann mit dem Seesack um den Turm herum und steuerte auf einen Laden zu, in dessen Fenster Silberschalen, eine Kommode und ein verschnörkelter Spiegel standen. »Whitfields Antiquitäten« stand in goldenen Lettern auf einem dunkelgrünen Schild.
Tief Luft holend schulterte der Mann seinen Sack und stieg die Stufen hinauf. Er drückte die Türklinke und schreckte zusammen, als eine Glocke sein Eintreten verkündete.
»Guten Tag, Sir, was kann ich für Sie tun? Suchen Sie noch ein Geschenk für Ihre Frau?«, wurde er von dem Ladeninhaber begrüßt, dessen Tränensäcke und rote Flecken auf Nase und Wangen auf eine Vorliebe für Alkoholisches schließen ließen.
Aber Reece Whitfield kannte sich aus in seinem Metier. Schon sein Vater und sein Großvater hatten mit Antiquitäten gehandelt und ihn gelehrt, dass man Kunden nicht nach dem Äußeren beurteilen durfte. Manchmal hatten die seltsamsten Vögel viel Geld oder einen unverhofften Fund auf dem Dachboden eines Hauses gemacht. Die Möglichkeiten waren unendlich vielfältig, genau wie die Menschen, und deshalb musterte Whitfield den Kunden neugierig und nicht abfällig.
»Guten Tag.« Der Mann ließ den Sack zu Boden gleiten, wobei ein leises Klirren erklang. »Ich will was verkaufen. Man hat mir gesagt, dass Sie auch Sachen kaufen.«
Reece Whitfield setzte seine Brille auf und schob Füllfederhalter und ein Buch von der ledernen Arbeitsfläche des Verkaufstisches. »Dann zeigen Sie mal her, was Sie haben. Mit Besteck wird es schwierig, das sage ich gleich. Das müsste schon massives Silber sein.«
Eine Frau kam aus dem hinteren Teil des Hauses. »Reece, wir müssen noch über die Raten für das Auto und den Kredit sprechen …«
Barsch drängte Whitfield seine Frau zurück. »Nicht jetzt. Du siehst doch, dass ich Kundschaft habe.«
Der Fremde, dessen Hände in ausgefransten halben Handschuhen steckten, wühlte in seinem Sack und brachte ein unförmiges Bündel zum Vorschein. Er legte es auf den Tisch: Einfaches Tau war um gewachstes Tuch geschlungen, auf dem sich die für Salzwassereinwirkung typischen weißen Ränder zeigten. Vorsichtig, beinahe ehrfürchtig, entknotete der Mann das Bündel mit zittrigen Fingern. Schließlich zog er das feste Tuch auseinander und entlockte dem erfahrenen Antiquitätenhändler ein ungläubiges »Heilige Mutter Gottes!«.
1
University of Oxford, Institut für Archäologie, Oktober 2014
Dr. Samantha Goodwin warf den Bleistift auf ihren Schreibtisch und starrte wütend auf den Brief, der ihre Karriere bedrohte, wenn er sie nicht schon zerstört hatte.
»Verfluchter Mistkerl!«, fauchte sie und zerknüllte das Schreiben von Professor Christopher Newman, dessen Wappen golden auf dem Briefkopf prangte und sie zu verhöhnen schien.
Vor gar nicht langer Zeit waren sie und Christopher ein Liebespaar gewesen und hatten gemeinsam archäologische Schätze aus den Meeren der Welt geborgen und untersucht. Gemeinsam hatten sie die Ergebnisse erarbeitet, ausgewertet und veröffentlicht. Ihrer beider Namen hatte auf den Forschungsberichten gestanden, sie beide hatten Vorträge über ihre Erkenntnisse gehalten und sich Ehrungen und Auszeichnungen geteilt. Damit war es nun ganz offensichtlich vorbei!
»Wie kann er mir das antun!« Sam, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, stand auf und riss die Jacke vom Stuhl.
Dieser Oktober war kalt, nass und windig. Selbst ein kurzer
Weg über den Innenhof des Institutsgebäudes konnte einen durchnässen. Durch jahrelanges Arbeiten an Ausgrabungsstätten im Freien unter widrigsten Bedingungen war sie einiges gewohnt, aber sie wusste auch, dass etwas Zugluft ausreichte, um sich eine Erkältung einzufangen.
Sie warf sich ihre Wachstuchjacke über, griff nach dem zerknüllten Brief und glättete den Bogen beim Verlassen ihres Büros. Auf dem Flur standen zwei Studenten, die anscheinend auf sie gewartet hatten.
»Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit«, wiegelte Sam ab, doch die beiden jungen Frauen gaben nicht so schnell auf. War sie selbst auch einmal so hartnäckig gewesen? Wahrscheinlich, sonst hätte sie es nicht bis ans renommierte Oxford Centre for Maritime Archaeology geschafft.
»Okay, was ist? Ich habe nur eine Minute.« Sam stopfte den Brief in ihre Tasche, strich sich eine lange dunkelbraune Haarsträhne aus dem Gesicht und versuchte ein Lächeln.
»Dr. Goodwin, wir möchten uns für Baia anmelden. Wir haben beide Tauchscheine und können alle Kosten übernehmen«, sagte eine der jungen Studentinnen, deren Designerkleidung und teure Armbanduhr von wohlhabenden Eltern sprachen.
Innerlich stieß Sam einen Stoßseufzer aus. Es war so ungerecht, dass fast nur diejenigen, deren Eltern es sich leisten konnten, die begehrten Plätze in den ausländischen Forschungsprojekten bekamen. Baia, ausgerechnet der versunkene antike Badeort vor Neapel musste es sein! »Geht zu Professor Newman. Ich kann euch da nicht helfen.«
»Aber wir möchten gern in Ihre Gruppe, weil …«, sagte die zweite Studentin.
»Ich betreue Baia nicht mehr. Geht zu Professor Newman, danke!« Damit ließ Sam die verdutzten Studentinnen stehen und ging rasch davon.
Der römische Badeort, in dem schon Cäsar und Nero Erholung gesucht hatten, war ihr Steckenpferd, ihr Lieblingsprojekt gewesen. »Ah!«, presste sie wütend durch die Zähne und stieß die Tür zum Innenhof auf.
Die nasskalte Luft kühlte ihre aufgestauten Emotionen etwas ab, und Sam blieb kurz stehen, um sich zu sammeln. Zwar war Professor Farnham, der Institutsleiter, ein Gemütsmensch, doch unprofessionell und hysterisch wollte sie auch auf ihn nicht wirken.
Während sie langsamer auf den Eingang zum Hauptgebäude zuging, rekapitulierte sie das Geschehene. Mit vierunddreißig Jahren hatte sie viel erreicht, sich einen Ruf als Expertin für meereskundliche Archäologie erarbeitet und zahlreiche hochgelobte Aufsätze veröffentlicht. Das hatte rein gar nichts damit zu tun, dass sie und Christopher ein paar Jahre lang ein Liebespaar gewesen waren! Und er hatte die Frechheit, sie jetzt öffentlich als Nutznießerin seiner Gunst bloßzustellen. Hätte sie es kommen sehen müssen? Himmel, so schlecht hätte sie niemals von ihm gedacht! Das hatte er doch gar nicht nötig. Newman war der erste Juniorprofessor mit eigener Außenstelle in Neapel gewesen. Es war sein Verdienst, dass der European Research Council das Sponsoring für Baia übernommen hatte. Das hatte sie ihm nie streitig gemacht.
»Hallo, Sam!« Ein schlaksiger Mann im Tweedjackett winkte ihr zu, als sie in den Flur des archäologischen Instituts trat.
»Martin, hallo. Schon wieder zurück?« Martin MacLean gehörte zu einem internationalen Team, das in Syrien das Wassersystem des alten Androna mitsamt dem byzantinischen Bad ausgrub.
Martin küsste sie zur Begrüßung auf die Wangen. Er sah gebräunt aus, doch seine Miene war sorgenvoll. »Es wird schon wieder geschossen. Und keiner weiß so genau, warum und wie es weitergehen soll … Sehr schade, wo wir schon so weit sind.« Er hob die Schultern und kratzte sich den Dreitagebart. »Und bei dir?«
»Frag nicht. Ich muss zu Farnham und erzähl’s dir später. Heute Abend im Lamb and Flag?« Sam hatte schon die Tür zum Büro des Dekans im Auge.
»Gerne! Das hat mir gefehlt, unsere Mittwochabende im Pub. An Shisha und Tee werde ich mich nie gewöhnen.« Martin schüttelte grinsend den Kopf und wurde dann von einem anderen Kollegen abgelenkt, der ihn begrüßte.
Sam hatte den Eindruck, dass dieser junge Dozent sie mit einem herablassenden Blick bedachte. Er wusste es also schon. Wahrscheinlich hatte Christopher seine miesen Anschuldigungen als Gerücht wohldosiert gestreut, und sie dumme Gans hatte nichts mitbekommen. Entschlossen klopfte sie an die Tür des Dekans. Es dauerte nicht lang, und Stimmen näherten sich. Dann wurde die Tür geöffnet, und eine gutaussehende blonde Frau, deren hochmütiges Gesicht Sam wohlbekannt war, kam heraus, musterte sie kurz und sagte zu Farnham: »Danke, mein Lieber, ich werde darauf zurückkommen.«
Lauren Paterson war eine von Christophers wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und wahrscheinlich seine aktuelle Geliebte. Als Sam das triumphierende Aufblitzen in Laurens perfekt geschminkten Augen sah, traf sie die Erkenntnis wie ein Schlag. Wahrscheinlich steckte Lauren hinter der miesen Kampagne, um Sam endgültig aus dem Weg zu räumen. Lauren war wohl eifersüchtig auf das nach wie vor gute Verhältnis von Sam und Christopher, denn als Forschungsteam waren sie unschlagbar. Gewesen, setzte Sam in Gedanken hinzu, ignorierte Lauren und schenkte Farnham ein Lächeln.
Seit vier Jahren leitete Professor Farnham das Institut souverän und erfolgreich, was weniger seinen familiären Verbindungen zum Königshaus als vielmehr seiner wissenschaftlichen Kompetenz zu verdanken war. Struppige graue Haare, ein von Jahren in tropischen Gefilden gegerbtes Gesicht und eine verbogene Brille passten so gar nicht zum Image eines Dekans. Aber Farnham war ein Original, und seine blauen Augen hefteten sich interessiert auf Sam.
»Kommen Sie herein, liebe Samantha. Was führt Sie zu mir?«
Er bot ihr Platz in einem der Ledersessel und eine Tasse Tee an.
»Danke.« Sam versank in einem der riesigen Sessel und wartete, bis er ihr einen Becher russischen Karawanentee in die Hand drückte. Der rauchige Duft stieg ihr in die Nase und besänftigte ihr aufgewühltes Gemüt ein wenig.
Das Leder knirschte, als Oscar Farnham sich ihr gegenüber niederließ und sie erwartungsvoll ansah.
Wortlos nahm sie den zerknitterten Brief aus ihrer Tasche und reichte ihn Farnham. Beim Überfliegen des Inhalts verdüsterte sich seine Miene. »Das ist nicht schön.«
»Nein. Ganz und gar nicht. Vor allem ist es gelogen!«
»Davon gehe ich aus. Ich kenne Sie beide seit Jahren und kann nicht verstehen …« Farnham fuhr sich durch die Haare, schob seine Brille über den Nasenhöcker und machte ein schnalzendes Zungengeräusch. »Doch, ich kann.«
»Lauren«, war alles, was Sam sagte.
»Lauren Patersons Vater finanziert die kommende Saison des Baia-Projekts. Und Lauren und Christopher haben mich zu ihrer Hochzeit eingeladen.« Farnham trommelte mit den Fingern auf die Sessellehne.
Konnte es noch schlimmer kommen? Wohl kaum, dachte Sam. »Das wusste ich nicht. Ich meine, das mit der Hochzeit.«
»Sie hat es mir eben gesagt.« Farnham räusperte sich. »Ich will ganz ehrlich sein. Paterson als Sponsor zu verlieren wäre eine Katastrophe für das Baia-Projekt. Die Zukunft des Instituts hängt daran. Baia verschafft uns Aufmerksamkeit in der Presse und zieht Studenten und Laienforscher an. Aber was sage ich, Sie wissen selbst, wie das heutzutage läuft.«
»Christopher bezichtigt mich des Diebstahls geistigen Eigentums – und das stimmt nicht!«
»Hm, das ist wahr. Haben Sie sich gestritten?«
»Nein! Überhaupt nicht! Alles lief gut. Wir bereiten gerade den Bildband vor, für den Lauren unbedingt den Artikel über …« Sie hielt inne und biss sich auf die Lippen. »Lauren …«
»Ach, Samantha, das tut mir wirklich schrecklich leid für Sie. Aber wie es aussieht, hat Lauren großen Einfluss auf ihren zukünftigen Gatten.«
»Sie steckt dahinter. Ich soll von der Bildfläche verschwinden. Aber so einfach geht das nicht!«, wehrte sich Sam und ahnte, dass sie bereits verloren hatte, als Farnham sich seufzend zurücklehnte. »Mein Ruf als Wissenschaftlerin steht auf dem Spiel! Ich kann den Leuten hier doch schon ansehen, dass sie denken, ich wäre nur durch Christophers Protektion so weit gekommen!«
»Jetzt übertreiben Sie aber. Die Gerüchteküche kocht ab und an über, aber Sie werden nicht in diesem giftigen Sud ertrinken, liebe Samantha.« Farnham lächelte ermutigend. »Darauf gebe ich Ihnen mein Wort.«
»Ich lasse das nicht so stehen!«
»Können Sie Ihren Anteil an den Forschungen genau belegen?«
»Ja, nein, wir haben zusammen … Mal habe ich kartiert und beschrieben und dann …« Sie schluckte. »Nein.«
»Ich billige Christophers Verhalten nicht und werde diesbezüglich mit ihm sprechen. Aber ich empfehle Ihnen, sich aus dem Baia-Projekt zurückzuziehen. Gegen eifersüchtige Verlobte bin ich machtlos«, sagte er lächelnd.
Doch Sam war nicht nach Scherzen zumute. »Sie entziehen mir das Projekt also?«
Sie stellte den Becher ab und erhob sich.
»Im Moment halte ich das für die einzige Lösung. Um die Wogen schnell zu glätten, und, wie gesagt, ich kläre das mit Christopher.«
»Und Lauren?«
»Äh, offiziell liegt nur Christophers Brief vor, und Lauren, nun ja, ihr Vater …« Der Dekan wand sich und wich ihrem Blick aus.
»Ich verstehe. Unter diesen Umständen sollte ich vielleicht unbefristeten Urlaub nehmen und mir neue Perspektiven überlegen.«
»Aber nein! Liebe Samantha, wir finden etwas für Sie. Lassen Sie mich schauen.« Farnham hatte sich ebenfalls erhoben und wühlte in den Unterlagen auf seinem mit Bücherstapeln und Akten überfüllten Schreibtisch. »Syrien fällt weg. Martin ist gestern wieder … Die Western Marmarica Coastal Survey Studie ist auch schwierig geworden, weil Libyen die Grenzen teilweise zugemacht hat.«
Sam schaute deprimiert zu, wie der Dekan Fotos von begehrten Ausgrabungsstätten zur Seite legte und wollte sich schon abwenden, als ihr Blick auf die Aufnahme eines Strandes fiel.
Sie zog das Bild heraus. »Wales. Das ist doch der Strand von Borth. Der Sturm vor einigen Tagen hat den versteinerten Wald freigelegt.«
»Sie sind damit vertraut?« Farnham richtete sich auf und schaute beinahe mitleidig auf die unspektakuläre Aufnahme. »Ich überlege noch, ob wir ein Team hinschicken. Viel Aufwand für eine so große Fläche, die bald wieder im Meer verschwunden ist.«
Samantha nickte gedankenverloren. »Meine Großmutter lebt in Borth. Ich habe viele Sommer dort verbracht und kenne jede Ecke des Strandes.« Sie betrachtete eingehend das Foto der dunklen Erhebungen auf dem Meeresboden. »So weit waren die Baumstümpfe noch nie freigelegt, und das hier sieht aus wie die Reste einer der Burganlagen … Mein Gott, kann das sein? Cantre’r Gwaelod … das versunkene Königreich …«
Farnham zog eine Mappe aus einer Ablage und legte weitere Fotografien hinein. »Bitte, es ist Ihr Projekt, Samantha. Wales im Oktober ist sicher nicht mit Aleppo zu vergleichen. Aber zumindest fliegen Ihnen dort keine Kugeln um die Ohren. Was sagen Sie?«
»Ich fahre nach Wales.«
2
Shermans Bootswerft, Borth, Oktober 2014
Der Wind hatte aufgefrischt, die Wellen wurden größer, türmten sich und bildeten weiße Schaumkronen. Wie wütende Pferde treiben sie auf den Strand zu, dachte Luke und suchte mit dem Fernglas nach einer kleinen Gestalt in roter Jacke. Endlich entdeckte er seinen achtjährigen Sohn, der im schlickigen Watt herumstrolchte und mit einem Stock an den alten Baumstümpfen herumstocherte. Das untergegangene Königreich … Luke schüttelte grinsend den Kopf. Für derlei Geschichten hatte er nicht viel übrig. Als ehemaliger Navy-Offizier konnte er sich Aberglauben nicht leisten. Er glaubte an das, was er sah, und für seinen Geschmack hatte er wahrlich genug gesehen. Wozu Menschen fähig waren, wusste er nur zu gut. Noch heute plagten ihn Albträume, die er mit niemandem teilen konnte.
Luke wollte Max gerade zurufen, nicht noch weiter hinauszulaufen, da blieb sein Sohn stehen, drehte sich um und winkte in seine Richtung. Luke hob den Arm. Der Junge hatte die braunen Haare und dunklen, verträumten Augen seiner verstorbenen Frau. Vor drei Jahren war Sophie bei einem Autounfall gestorben und hatte durch ihren viel zu frühen Tod sein Leben auf den Kopf gestellt. Der Schmerz und die Trauer waren eine Sache, aber das Leben musste weitergehen, und Max brauchte ihn. Bei seinen Kameraden war er auf wenig Verständnis gestoßen, als er den Dienst quittiert und sich nach Borth zurückgezogen hatte. In dieses gottverlassene walisische Kaff am Ende der Welt. Das waren Zacharys Worte gewesen, nicht seine.
Zac Malory war noch immer sein bester Freund, auch wenn sie einander selten sahen. Sie hatten Dinge zusammen erlebt, die einen auf ewig verbanden. Der Wind wehte Luke eine blonde Strähne über die Augen. Er setzte das Fernglas ab und zog eine Mütze aus der Jackentasche. Auf dem dunkelblauen Wollstoff prangte in orangefarbener Schrift Sherman’s Boatyard. Er war Luke Sherman, und die Bootswerft in Borth gehörte ihm.
Wenn man zwanzig Jahre beim SBS, dem Special Boat Service der Royal Marines, gedient hatte und ehrenvoll ausschied, war die Abfindung großzügig. Luke hob das Fernglas wieder an die Augen. Max stand jetzt neben einer Frau, die aufs Meer hinauszeigte und dann die Baumstümpfe fotografierte. Lange, dunkle Haare schauten unter einer Wollmütze hervor. Luke richtete sein Fernglas auf ihr Gesicht. Etwas irritierte ihn. Vielleicht war er zu lange im Dienst gewesen, um Menschen überhaupt noch unvoreingenommen begegnen zu können. Aber wenn das eine Touristin war, dann sollte ihn der Teufel holen.
Sie hob das Kinn, und er schaute ihr plötzlich direkt in die Augen. Neugierige, forsche bernsteinfarbene Augen, die ihn unmöglich gesehen haben konnten. Sie wandte sich Max zu, sagte etwas und ging davon. Das Vibrieren seines Telefons in der Hosentasche riss ihn aus seinen Beobachtungen.
»Sherman«, sagte Luke und verließ die Düne, von der aus er die Bucht überblickt hatte.
»Mr Sherman, schön, dass ich Sie gleich erreiche. Peters, wir haben ein Boot in Aberdovey liegen, und es muss unbedingt noch überholt werden …«
Während Luke sich das Anliegen des Kunden anhörte, folgte er dem Holzsteg durch die Dünen bis zu einem kleinen Parkplatz, auf dem er seinen Geländewagen abgestellt hatte. Neben ihm stand der Wagen eines Rangers vom Nationalpark. In dieser Jahreszeit hatten die Ranger weniger Sorgen mit wild Campenden in den Dünen als mit ortsunkundigen Strandwanderern, die sich nicht um die Gezeiten kümmerten, von Nebel und Flut überrascht wurden und eingesammelt werden mussten.
»Okay, Mr Peters, wenn Sie das selbst machen können, bringen Sie das Boot in unsere Werkstatt. Morgen Vormittag passt es.« Luke beendete das Gespräch und öffnete seinen Wagen, als Ranger Steven mit einem Sack Plastikmüll aus den Dünen kam.
»Hallo, Luke, alles klar?« Steven, Ende zwanzig, kleiner und drahtiger als der eher muskulöse Luke, schwenkte den Sack. »Hoffe, das war’s langsam für diese Saison.«
»Aye, mir reicht es auch, bin froh, wenn die Caravanparks dichtmachen.« Luke stammte aus Yorkshire, und seine Sprache war noch immer dialektgefärbt.
»Im Prinzip nichts dagegen, wir leben alle vom Tourismus, aber müssen die so viel Müll hinterlassen? Wie laufen die Geschäfte?«
»Habe gerade einen neuen Winterauftrag reinbekommen. Ein Mr Peters von drüben.« Er nickte Richtung Norden. Der Dovey mündete hier ins Meer, und auf der anderen Seite der Flussmündung lag Aberdovey, ein hübsches, verschlafenes Feriendorf.
Steve warf den Sack auf die Ladefläche seines Pick-ups und nickte. »Yup, Peters, dem gehört ein Hotel, das er nicht selbst betreibt, seine Exfrau, glaube ich. Kommt aus Manchester.«
»Ah, danke. Ist immer besser, man weiß, mit wem man es zu tun hat.«
»Oh, dem kannst du eine saftige Rechnung schicken, da tut’s nicht weh … Habe deinen Jungen unten gesehen. Soll ich ihn nachher mitnehmen?«
Eine heftige Böe fegte durch die Dünen, und dunkle Wolken ballten sich über dem Meer zusammen. »Ja, danke dir. Ich weiß auch nicht, was ich mit ihm machen soll. Ist ein lieber Junge, aber seit Sophies Tod kapselt er sich ab. Und am Meer fühlt er sich wohl. Es tut ihm gut, und er weiß, dass er nicht zu weit hinauslaufen darf.« Hilflos hob Luke die Schultern. Er machte sich immer Sorgen um seinen Sohn, aber er konnte ihn schließlich nicht einsperren, und Max war ein helles Kerlchen.
»Das dauert eben, und ich sehe ihn ja auch mit den anderen Kindern. Gib ihm Zeit, dann kommt er wieder zu sich.« Steven klopfte seinem Freund auf die Schulter. »Dir fehlt eine Frau, Luke, damit wieder Leben in euren verschrobenen Männerhaushalt kommt.«
Luke verzog das Gesicht. »Hast du nicht eben gesagt, das dauert?«
»Aber nicht zu lange, sonst verlernst du’s am Ende noch.«
»Ich vergesse immer, dass du frisch verheiratet bist, Steven. Es sei dir verziehen.« Er zog die Autotür auf und schwang sich hinein. »Bis nachher. Und danke!«
»Jederzeit!« Steven griff nach einem leeren Müllsack und stapfte durch den weichen Dünensand davon.
Luke verließ Ynyslas, den nördlichen Strandabschnitt von Borth, über einen Feldweg und bog auf die kaum breitere Straße, die direkt an den Dünen entlang nach Borth führte. Nach einem Kilometer wurden die Dünen niedriger, und die ersten Fairways des Golfplatzes schmiegten sich in die raue Küstenlandschaft. Gegenüber, auf der Landseite der Straße, stand ein einzelnes weißes Cottage und trotzte windschief den Elementen. Dort lebte die alte Gwen Morris seit Jahren allein. Im Sommer saß die alte Dame meist auf der Veranda und schaute auf das Meer hinaus.
Heute stand eine silberne Limousine vor dem Haus, und Luke hoffte für die alte Dame, dass ihre Familie sie besuchte. Nun folgten in knappen Abständen einzelne mehr oder weniger gepflegte Ferienhäuser, meist Bungalows. Als er ein Schild mit der Aufschrift »Camping« passierte, bog er links ab. Seine Bootswerkstatt befand sich an einem Ausläufer des Dovey am Moor. Der Wagen ruckelte über Schlaglöcher, teilweise war die Fahrbahn an den Rändern abgebrochen, und die Räder sanken im weichen Boden ein. Hohes Schilfgras säumte die von zahlreichen kleinen Flussarmen zerfurchte Landschaft. Die Grünflächen dazwischen waren saftig, aber zu feucht, um als Bauland verkauft zu werden.
Luke fuhr langsam über die einspurige Brücke, welche die Ufer des Lery miteinander verband. »Sherman’s Boatyard« stand in orangefarbenen Lettern auf einem Holzschild an der Bootshalle. Vor zwei Jahren hatte er den heruntergewirtschafteten Betrieb gekauft und kämpfte noch immer gegen den schlechten Ruf seines Vorgängers an. Doch seine Sorgfalt bei der Auswahl von Mitarbeitern zahlte sich aus. Die Aufträge häuften sich, und das Unternehmen schrieb schwarze Zahlen.
Er hielt vor dem geöffneten Hallentor, legte die Mütze auf den Beifahrersitz und sprang aus dem Wagen. Auf dem Hof lagen sechs Boote, die winterfest gemacht werden sollten, weitere fünf waren bereits fertig und mussten von den Besitzern abgeholt werden. Auf einem Gelände, das Luke erst kürzlich dazugekauft hatte, standen mehr als ein Dutzend Motorboote und Segelyachten im Winterquartier.
Aus der Halle tönte ohrenbetäubend laute Musik zum rhythmischen Sound einer Schleifmaschine.
»Liam!«, brüllte Luke und stellte sich so, dass der junge Mann in T-Shirt und Weste ihn sehen konnte.
Liam, der dabei war, einen Schiffsrumpf von altem Lack zu befreien, stellte die Maschine ab, nahm den Mundschutz vom Gesicht und wischte sich mit einem Handschuh den Schweiß von der Stirn, wobei er den Rand der Wollmütze nach oben schob. »Boss, bin fast fertig!«
Luke drehte die kleine Stereoanlage leiser, die vor dem Büro auf einem Holzstapel stand. »Wie hältst du diesen Lärm nur aus!«
Lachend machte Liam eine Luftgitarrenbewegung mit der Schleifmaschine. »Das ist kein Lärm, das ist Pantheon, bester Metal Sound!«
»Wenn’s dir gefällt. Van Morrison ist mehr nach meinem Geschmack.«
»Softi«, grinste Liam, schien sich zu erinnern, wen er vor sich hatte, und sagte: »Sorry, Boss.«
»Und hör auf, mich Boss zu nennen.« Luke ging um den aufgebockten Rumpf des kleinen Segelschiffs herum und fuhr mit den Fingerspitzen über die Oberfläche. »Da musst du noch mal drüber. Das muss alles runter.«
»Okay, Boss, äh, Luke.« Liam war nicht der Schnellste, aber gutmütig und hörte zumindest zu, wenn man ihm etwas erklärte. Er kam aus dem nahen Aberystwyth und verdiente sich mit verschiedenen Jobs sein Auskommen.
Mehr als eine Vollzeitkraft konnte Luke sich noch nicht leisten, und die Stelle hatte er dem gelernten Bootsbauer Tyler French gegeben. Der kostete ihn zwar mehr, kannte aber alle Tricks und Kniffe seines Metiers aus jahrelanger Erfahrung auf verschiedenen Werften. Zuletzt hatte er für einen britischen Unternehmer auf einer Werft in Thailand gearbeitet. Das Heimweh hatte den fünfzigjährigen Tyler nach Wales getrieben, und Luke hoffte, dass den geschätzten Mitarbeiter nicht allzu bald wieder das Fernweh packte.
»Wo ist Ty?«
»An der Stingray, die vorgestern reingekommen ist.« Liam zog seine Maske übers Kinn. »Kann ich heute früher gehen? Ich will mit Gareth zu einem Konzert in Carmarthen.«
»Wenn das hier fertig wird, ja. Und vergiss nicht, wer saufen kann, kann auch arbeiten«, ermahnte er Liam, denn die Vergangenheit hatte gezeigt, dass er nach ausgiebigen Touren mit Gareth in der Werkstatt tagelang unbrauchbar war.
Liam verdrehte genervt die Augen, zog sich die Maske übers Gesicht und stellte die Schleifmaschine an. Luke verließ die Halle, denn das Motorboot war in einem kleineren Gebäude aufgestellt worden. Kaum trat er nach draußen, wurde er von einer Windböe erfasst, die ihm den aufgewirbelten Sand in die Augen trieb. Das würde einen heftigen Sturm geben, dachte Luke und nahm sich vor, später alle Boote samt Planen zu überprüfen, die draußen festgemacht waren. Er war froh, dass Steven sich um Max kümmerte, sonst hätte er jetzt losfahren müssen.
In der kleineren Werkstatt war es bis auf gelegentliches Klopfen und leises Fluchen still. »Ty?«
»Verhenkertes … ah, Luke, gut, dass du kommst. Sieh dir das hier an.« Eine graue Strubbelmähne tauchte hinter dem Bootsrumpf auf. Tylers eisblaue Augen begrüßten Luke, doch in Gedanken war der Bootsbauer ganz bei seinem Problem. Er hielt einen kleinen Gummihammer und klopfte einen Bereich neben dem Kiel ab. »Hörst du das?«
»Aye, ein Riss, würde ich sagen.« Luke war zwar kein gelernter Bootsbauer, doch er hatte sein Hobby zum Beruf gemacht und durch sein Leben im Dienst der Royal Navy viel gelernt.
»Der Eigner hat von zehn Litern pro Stunde gesprochen, die das Boot zieht. Ich habe den Rumpf überprüft. Den Bereich um den Riss herum könnte ich mit der Rotex anschäften, austrocknen lassen, Epoxidharz und 420er Glasfasergelege, und es wäre wieder so gut wie neu.« Tyler hob den Kopf und legte die flache Hand gegen das Motorboot. Er war einen Kopf kleiner als Luke, doch drahtig und kraftvoll. »Das ist die günstige Variante.«
Luke überlegte kurz. »Mach das. Der Eigner ist ein netter Typ und empfiehlt uns sicher an seine Freunde.«
Ein Wagen fuhr auf den Hof, und Luke nickte Tyler noch einmal bestätigend zu, bevor er die Werkstatt verließ. Beide Gebäude waren von Grund auf renoviert und mit viel Holz regional typisch verkleidet worden. Zunehmend sahen sich auch Touristen gern auf dem Gelände um, und Luke überlegte, ob er im Sommer eine Kitesurfschule am Strand eröffnen sollte.
Als er seinen Schwiegervater aus dem Auto steigen sah, wurde sein Herz schwer. Rhodri Perkins war einer der Gründe gewesen, warum Luke nach Borth gezogen war. Der frühe Tod seiner Tochter hatte Rhodri mehr zugesetzt, als er jemals zugeben würde. Rhodri führte das Lighthouse, einen gut gehenden Pub in Borth, und war in zweiter Ehe mit der um einige Jahre jüngeren Leah verheiratet. Leah hatte eine Tochter mit in die Ehe gebracht, die neunzehnjährige Lucy, deren lockerer Lebenswandel ihn die eigene Tochter noch schmerzlicher vermissen ließ.
Die beiden Männer nahmen einander kurz in den Arm. »Rhodri, was führt dich her?«
»Ich habe eine Überraschung für Max. Wo ist der kleine Racker?« Suchend schaute sich Max’ Großvater um.
»Am Strand. Steven bringt ihn gleich vorbei. Willst du warten und einen Kaffee mit mir trinken?« Luke hatte ein Cottage am Rande des Moors gemietet, von dem aus er auch zu Fuß zur Werft gehen konnte. Doch jetzt steuerte er mit Rhodri auf das Büro in der Werkshalle zu, in dem neben Schreibtisch und Sitzecke für Kunden auch eine Teeküche untergebracht war.
»Gern. Warte, ich nehm’s schon mal aus dem Wagen.« Rhodri öffnete die Heckklappe seines Kombis und hob ein kleines Mountainbike heraus.
»Ich wusste gar nicht, dass Max Geburtstag hat«, meinte Luke und schüttelte den Kopf. »Du verwöhnst ihn.«
Rhodri lächelte, wobei sich die scharfen Linien um Mund und Augen vertieften. Um seine Augen lagen dunkle Schatten, aber das brachte das Nachtleben mit sich. Seinen rasierten Schädel versteckte er meist unter einer verwaschenen Baseballcap. Über einem dicken Wollpullover trug er eine Weste zu ausgebeulten Jeans. Er war fast sechzig Jahre alt, und man sah ihm jedes einzelne Jahr an.
»Kannst du mir das verdenken? Max ist ein Sonnenschein, was ich von Lucy leider nicht behaupten kann.« Er stellte das Fahrrad vor dem Eingang ab.
Gemeinsam betraten sie die Halle, wo Liam eifrig die Schleifmaschine betätigte. Nachdem Luke die Bürotür hinter ihnen geschlossen hatte, wurde es ruhiger. Er hatte die Tür und das schmale Fenster zur Halle isoliert, um relativ ungestört arbeiten und telefonieren zu können.
»Ist sie schwanger, oder hat sie das Praktikum geschmissen?«, fragte er und stellte die Espressomaschine an.
Rhodri ließ sich in einen der abgewetzten Ledersessel fallen, nahm die Cap vom Kopf und rieb sich den Schädel. »Ich weiß gar nicht, ob eine Schwangerschaft das Ärgste wäre, sie ist gefeuert worden – aus einem Praktikum!«
Der Espresso zischte unter dem ratternden Geräusch der Maschine in zwei Tassen. Luke konnte auf vieles verzichten, aber nicht auf seinen Espresso. Er gab in beide Tassen einen Löffel Zucker und reichte Rhodri eine. »Was kann man denn schon falsch machen, wenn man ein Praktikum bei einem Immobilienmakler macht? Hat sie den Kunden Tee über die Hose gegossen?«
»Wenn sie überhaupt aufgetaucht ist, kam sie zu spät, und dann war sie auch noch patzig zu einem wichtigen Kunden. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Meine Kontakte sind aufgebraucht. Soll sie zusehen, wie sie klarkommt«, meinte Rhodri bitter.
»Tja, sie ist neunzehn und muss selbst wissen, was sie tut. So hart das klingt, aber was willst du machen? Außerdem ist sie nicht deine leibliche Tochter und hat dich nie akzeptiert. Das macht es nicht gerade einfacher …«
Luke leerte seine Tasse in einem Zug und horchte nach draußen, wo ein Wagen vorfuhr.
»Nein, das macht es nicht, und Gott weiß, dass ich mir Mühe gegeben habe. Aber nun soll es so sein. War das eben ein Auto?« Rhodris Miene erhellte sich. Er stand auf und stellte seine Tasse auf den Tisch.
Und sie hörten bereits Max’ helle Stimme. »Dad? Ich bin wieder da, und rate mal, wen ich getroffen habe?«
Wie eine frische Brise stürmte ein dunkelhaariger Junge durch die Halle auf sie zu, ließ sich von Luke umarmen und von seinem Großvater die Haare zerzausen. Ranger Steven folgte ihm mit einem breiten Grinsen.
»Hallo zusammen!« Er hob schnuppernd die Nase. »Kaffee!«
»Geh rein und mach dir einen«, lud Luke seinen Freund ein, bevor er sich seinem Sohn zuwandte. »Okay, wen hast du getroffen?«
Doch Max war bereits von seinem Großvater in Beschlag genommen, der ihn an der Hand nach draußen zu seinem neuen Fahrrad führte. Das Geschenk wurde mit Freudenschreien begrüßt, und Luke ließ die beiden allein.
»Mach mir bitte auch noch einen, Steven«, sagte er.
»Wir haben hohen Besuch. Ich glaube, das wollte Max dir erzählen. Zucker?«, fragte Steven.
Luke nickte. »Hohen Besuch? Naturschutzamt?«
»Besser oder schlechter, wie man’s nimmt. Eine Archäologin aus Oxford, vom Centre für Maritime Archaeology.«
»Die wollen sicher mal wieder nach dem versunkenen Wald sehen. Na dann … Cheers!« Luke hob seine Tasse. Seit er nicht mehr bei der Navy war, trug er die Haare länger, doch seiner Haltung merkte man den Militärdienst noch immer an. So was steckte in den Knochen. Eine gerade Nase und das markante Kinn prägten sein eher längliches Gesicht, dessen schön geschwungener Mund gern, aber zu selten lachte.
Steven legte den Kopf schief. »Die Lady meint es ernst. Eine Frau Doktor mit Ambitionen, wenn du mich fragst. Und hübsch. Das hat sogar Max festgestellt.« Der Ranger grinste.
»Der Junge kommt nicht nach mir«, lachte Luke und dachte an den Blick in grüne Augen, die nicht wussten, dass sie beobachtet wurden.
»Ich habe nur kurz mit ihr gesprochen. Sie war ganz aufgeregt, weil der Sturm mehr von den Baumstämmen freigelegt hat als jemals zuvor. Eventuell holt sie Verstärkung und will alles kartieren und untersuchen.«
»Hoffentlich ohne Presserummel …«, murrte Luke.
»Darauf legt sie sicher keinen Wert, kann ihr nur schaden, wenn lauter Idioten im Watt herumtrampeln, herumstochern und womöglich sogar nach Schätzen buddeln, wo es keine gibt.«
Luke fuhr sich durch die Haare. »Lassen wir uns überraschen.«
3
Borth, Wales, Oktober 2014
Sam zog ihren Parka aus und hängte ihn an einen der gusseisernen Garderobenhaken im Flur. »Ich bin wieder da, Granny!«
»Nimmst du die Sandwiches mit? Sie stehen auf dem Küchentisch«, rief ihre Großmutter aus dem Wohnzimmer.
Das Cottage zählte zu den ältesten Häusern des Ortes, der einmal ein winziges Fischerdörfchen gewesen war. Der Boden war noch mit selbstgebrannten Fliesen der Erbauer aus dem achtzehnten Jahrhundert bedeckt, die Wände schief, die Decken niedrig, und durch die maroden Fensterrahmen zog es. Auch das mit Schieferplatten gedeckte Dach war renovierungsbedürftig, und der letzte schwere Sturm hatte ein Loch gerissen, das nur notdürftig repariert worden war. In der Küche stand ein alter Gasherd, und das Mobiliar hätte jeden Antiquitätenhändler erfreut. Verbeulte Kupferpfannen und Töpfe hingen dekorativ und praktisch zugleich in Griffhöhe.
Sam bewunderte ihre Großmutter dafür, dass sie mit ihren achtzig Jahren im Haus noch immer alles selbst machte. Das Leben hatte Gwen Morris viel abverlangt und sie dazu gezwungen, sich und ihre kleinen Kinder allein durchzubringen. Die Sandwiches waren in perfekte Dreiecke geschnitten und auf einem handbemalten Porzellanteller dekoriert. Sam wusch sich kurz die Hände, strich sich die vom Wind zerzausten Haare aus dem Gesicht und nahm den Teller mit.
Ihre Großmutter saß auf dem Sofa, neben sich einen Korb mit Handarbeiten, und blätterte in einer Zeitschrift. »Ah, Sam, komm, setz dich, iss etwas, du bist viel zu dünn.«
Sam lächelte und setzte sich folgsam in einen Sessel. Der Ofen verströmte eine wohlige Wärme, die ihre feuchte Kleidung durchdrang. Auf dem Tisch, der aus Strandholz gezimmert war – damals eine Notwendigkeit, heute ein Schmuckstück – stand Teegeschirr. Es hatte sich wenig geändert, dachte Sam, während sie sich und ihrer Großmutter Tee in Keramikbecher goss. Schon als Kind hatte sie es geliebt, in den Ferien nach Wales ans Meer zu fahren. Das kleine Cottage mit dem verwilderten Garten inmitten der Dünen bedeutete Freiheit, und Gwen war eine begnadete Geschichtenerzählerin. Immer standen eine Teekanne, Sandwiches oder Scones bereit, wenn Sam ins Haus kam, sich ins Sofa kuschelte und ihrer Großmutter zuhörte. Lange hatte es einen Collie namens Tavis gegeben, den Sam über alles geliebt hatte, doch nach dessen Tod hatte Gwen sich gegen einen neuen Hund entschieden.
»Fühlst du dich nicht einsam, Gran? Ich meine, wäre es nicht gut, wenn du wieder einen Hund hättest?«, sprach Sam laut ihre Gedanken aus.
Gwen, deren silbernes Haar kurz geschnitten war, gab Milch in ihren Tee und schüttelte den Kopf. »Ich bin zu alt. Nimmst du den Hund, wenn mir etwas zustößt?«
Sam biss sich auf die Lippe. »Ich, nein, das ginge nicht, aber wir könnten sicher jemanden finden, der …«
»Nein! Solange ich mein Leben allein meistern kann, ist es gut. Ich bin auf niemanden angewiesen und muss mich um niemanden sorgen. Allein bin ich, seit mir das Meer meinen Mann genommen hat, seit meine Kinder aus dem Haus sind. Aber einsam bin ich nicht, denn ihr seid alle hier.« Die alte Dame legte sich die rechte Hand auf die Brust.
Sam schluckte und biss in ein Käse-Chutney-Sandwich. »Das ist so lecker! Machst du das Chutney immer noch selbst?«
»Natürlich! Glaubst du, ich kaufe diesen Mist aus dem Supermarkt?«, erwiderte Gwen entrüstet.
Nachdem sie das köstliche Brot aufgegessen hatte, sagte Sam: »Tut mir leid, Granny, ich mache mir nur Gedanken. Obwohl ich weiß, dass ich kein Recht dazu habe, so selten, wie ich dich in der letzten Zeit besucht habe.«
Gwen Morris hatte die gleichen meergrünen Augen wie ihre Enkelin und lächelte milde, wobei ihr einst schönes Gesicht sich in Hunderte kleine Falten legte. »Ich bin alt, aber nicht weltfremd, Sam. Du bist eine erfolgreiche Wissenschaftlerin, und ich bin sehr stolz auf dich!«
Von all ihren Ausgrabungsstellen schickte Sam ihrer Großmutter Fotos und Bücher über die geschichtlichen Hintergründe. Sie wusste, dass Gwen, die selbst nie die Chance auf eine weiterführende Schule gehabt hatte, sich dafür interessierte. Im Grunde wusste Gwen mehr über ihre Arbeit als ihre Eltern. Sam seufzte. Ihre Eltern besaßen einen Weinfachhandel in Lincoln, in dem auch ihr Bruder Tom mitarbeitete. Alles, was nicht mit dem Geschäft zu tun hatte, wurde kaum beachtet.
Dabei nahm Sam das ihrer Familie nicht einmal übel. Sie hatte sich vielmehr schon immer als das schwarze Schaf gefühlt, weil sie sich in Büchern vergraben und von fremden Ländern und Kulturen geträumt hatte. Und seit ihre Eltern sie mit acht Jahren das erste Mal allein zu Gwen nach Wales geschickt hatten, war daraus eine Tradition geworden. Sam hatte nie offen ausgesprochen, dass sie sich bei Gwen wohler fühlte als zu Hause, doch aus den spitzen Bemerkungen ihrer Mutter klang oftmals Eifersucht auf das enge Verhältnis zwischen Enkelin und Großmutter mit. Es mochte daran liegen, dass Gwen für die eigenen Kinder kaum Zeit gehabt hatte, weil sie um jeden Penny hatte kämpfen müssen.
»Sam, Liebes, ein Penny für deine Gedanken!«, sagte Gwen und sah sie aufmerksam an.
»Der Tee ist gut. Ich weiß nicht, warum er bei mir nie so schmeckt.« Sam lächelte.
»Weil du dann nicht hier bist. Willst du mir nicht endlich sagen, was dich bedrückt?« Gwen griff in den Korb und nahm ein beigefarbenes Wollknäuel heraus. »Das ist deine Farbe. Daraus stricke ich dir einen Pullover für den Herbst.«
Sam streifte die Schuhe ab und zog die Füße auf den Sessel. Sie hatte Gwen nichts von Christophers hinterhältigen Anschuldigungen gesagt. »Ach, Institutsquerelen. Das renkt sich wieder ein.«
Die dicken Stricknadeln klapperten rhythmisch, ohne dass Gwen hinsah. Stattdessen musterte sie ihre Enkelin. »Die Baumstümpfe sind nicht zum ersten Mal freigespült worden, und du wolltest doch wieder ans Mittelmeer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?«
»Ich kann dir nichts vormachen, oder?«
Gwen blinzelte sie verschmitzt an. »Du kannst es versuchen.«
»Ich gebe auf.« Und während sie ihrer Großmutter von Christopher und seiner Intrige erzählte, lösten sich die Anspannungen der letzten Wochen. »Wie konnte ich nur so blind, so dämlich sein? Ich habe ihm vertraut, wir waren ein gutes Team. Wie kann er das einfach so hinwerfen, mich gegen diese Natter mit ihrem reichen Daddy austauschen?«
»Du hast dir die Antwort gerade selbst gegeben, Sam. Er ist es nicht wert. Ihr hattet euch doch schon getrennt, und die Neue ist jünger und kann sich durch das Geld ihres Vaters fast alles kaufen. Für sie ist es wahrscheinlich normal, und sie begreift nicht einmal, wie schändlich sie handelt. Geld und Macht kennen keine Moral. Leider. Deshalb ist unsere Welt so, wie sie ist.«
Sam hörte ihrer Großmutter zu. »Wo nimmst du das nur immer her? Und weißt du was? Jetzt geht es mir schon etwas besser. Auch wenn mein Vertrauen in die Liebe durch diese Erfahrung nicht gerade gewachsen ist.«
Gwen ließ ihr Strickzeug sinken. »Sag das nicht, Sam. Wenn dir die wahre Liebe begegnet, darfst du nicht zögern, weil du Angst vor erneuter Enttäuschung hast.«
»Das sagst du so einfach. Du bist deiner großen Liebe ja sofort begegnet. So viel Glück hat nicht jeder.« Sie hielt inne und fügte schnell hinzu: »Das hätte ich nicht sagen dürfen. Ihr hattet viel zu wenig Zeit.«
Doch ihre Großmutter wirkte nicht traurig, als sie antwortete: »Sechs gemeinsame Jahre und vier gesunde Kinder. Das ist mehr, als viele Menschen jemals erfahren dürfen. Nein, Sam, ich beklage mich nicht. Arthur war mein Mann, der Einzige. Nur hätte ich ihn gern ordentlich bestattet. Ich hätte gern gewusst, was er in seinen letzten Stunden durchgemacht, woran er gedacht hat. Das wurde mir verwehrt. Und solange ich das nicht weiß, kann ich meinen Frieden nicht finden.«
Gwen Morris’ Augen glitten zum Fenster, hinter dem die See auf den Strand rollte, jeden Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Das immer gleiche Lied der Wellen von Liebe und Tod.
Sam betrachtete ihre Großmutter, deren Gesicht im Zwielicht des halbdunklen Raumes plötzlich weich und jung aussah. Als junge Frau war sie eine dunkelhaarige Schönheit gewesen, die mit ihren meergrünen Augen gewiss mehr als einem Mann den Verstand geraubt hatte. Vielleicht hatte es auch betuchte Bewerber um die Hand der schönen Arbeitertochter gegeben, doch Gwen hatte ihr Herz nur einem geschenkt – Arthur Morris, einem jungen Fischer.
Es war Sams zweiter Tag in Borth, und bevor es dunkel wurde, wollte sie noch einen Spaziergang zum Campingplatz im Süden des Ortes machen.
»Granny, ich möchte vor dem Abendessen noch zu den Miltons. Vielleicht ist Millie dort. Was möchtest du essen? Ich bringe uns etwas mit.«
»Was du magst, Liebes, nur keine Pizza, damit kann ich mich nicht anfreunden.« Gwen beugte den Kopf tiefer über die Stricknadeln. »Und mach doch bitte das Licht an, wenn du gehst.«
Sam schaltete das Licht an. »Sag mal, führt Rhodri den Pub noch? Viel mehr Leute kenne ich wohl nicht mehr hier.«
»O ja, er hat das Lighthouse ganz nett renoviert. Läuft wohl nicht schlecht.« Gwen lachte. »Er hat wieder geheiratet, eine junge Frau, da muss er noch mal ran.«
»Überall dasselbe Spiel … Tröstet mich irgendwie.« Man musste das Leben mit einer gehörigen Portion Humor nehmen, dachte Sam, griff nach ihrem Parka und verließ das Cottage.
Der Wind griff sofort nach ihren Haaren und wirbelte sie durch die Luft. Die Sonne stand tief über der Bucht und tauchte den kleinen Ferienort in warme Orangetöne. Auf dem Golfplatz zu ihrer Rechten waren noch Spieler unterwegs, und sie hob grüßend die Hand, als sie in Sichtweite kamen. Da sie bereits den ganzen Tag am Strand verbracht hatte, lief sie nun auf direktem Weg in den Ort, der von einer Hügelkette eingefasst wurde. Die schönsten Ferienhäuser lagen auf den südlichen Klippen, von denen man einen grandiosen Blick auf das Meer hatte. Etwas unterhalb befand sich an der Ausfahrtstraße Richtung Aberystwyth der Campingplatz der Miltons.
Der Ort selbst war noch immer nicht schön, viele heruntergekommene Häuser wurden zum Verkauf angeboten, doch es gab auch zahlreiche Neubauten, die von reichen Anlegern zeugten. Die Zukunft würde weisen, wohin Borth sich entwickelte. Im Vorbeigehen nahm Sam die hellblaue Fassade des Pubs wahr, der mit seinem neuen Schild und einer überdachten Terrasse deutlich an Attraktivität gewonnen hatte. Doch einen Besuch bei Rhodri wollte sie sich für den Rückweg aufsparen.
Millie Milton war ihre erste Freundin hier in Borth gewesen. Mit acht Jahren war man nicht wählerisch, wenn man irgendwo die Neue war, und Millie hatte ihr die besten Badestellen und die Trampelpfade durch die Moorlandschaft am Dovey gezeigt. Außerdem hatte Millie ein Pony besessen, auf dem sie am Strand entlanggeritten waren. Mit zunehmendem Alter hatten sie sich entfremdet. Millie war immer eifersüchtiger auf Sams Aussehen geworden und hatte sie zunehmend wegen der Bücher aufgezogen, die sie mit sich herumschleppte.
Sam las das Schild über der Einfahrt zum Campingplatz »Andy’s Holiday Park«. Andy und Iris waren Millies Eltern, und der Platz bestimmte ihr Leben. Ihr Wohnhaus grenzte an das Gebäude mit der Rezeption, dem Imbiss und den Aufenthaltsräumen. Ein Stück weiter befanden sich die sanitären Anlagen. Im hinteren Bereich der Anlage standen ganzjährig Caravans mit festen Plätzen, über den Rest verteilten sich im Sommer Zelte, Busse und Wohnmobile. Jetzt, am Ende der Saison, standen nur zwei Wohnmobile da, und in wenigen Dauercaravans brannte Licht.
Der Imbiss war noch geöffnet, und sie versuchte dort ihr Glück. Der Gestank von altem Fett und frittiertem Fisch schlug ihr entgegen, und als sie die Frau hinter der Theke erkannte, bereute sie ihren Besuch auch schon. Manche Dinge wurden mit den Jahren nicht besser.
Die junge Frau mit weißblonden Haaren, rot geschminkten Lippen, Fingernägeln derselben Farbe und einem langgezogenen Lidstrich, der ihre Katzenaugen betonte, erstarrte bei Sams Anblick. Die Augen wurden schmal, und die Unterlippe schob sich kurz vor, bevor sich die Lippen zu einem höhnischen Lächeln verzogen. »Na, wenn das nicht unsere Samantha aus Oxford ist. Hat man dich gefeuert, oder warum beehrst du uns mit deiner Gegenwart?«
Ihre schlanke Figur mit trainierten Oberarmen präsentierte Millie in einem weißen T-Shirt und Röhrenjeans.
»Gut siehst du aus, Millie, freut mich, dich zu sehen.« Lächelnd überging Sam die freche Begrüßung. »Wie geht es deinen Eltern?«
»Wie soll’s ihnen schon gehen.« Millie sah auf die Wanduhr über ihr. »Meine Schicht ist in drei Stunden zu Ende. Was glaubst du, wie es mir geht?«
»Keine Ahnung, aber da dich niemand zwingen kann hierzubleiben, gehe ich davon aus, dass du gern hier bist«, sagte Sam freundlich. »Komm schon, Millie, wir haben zusammen am Strand gespielt, gemeinsam unseren ersten Fisch gefangen. Uhh, ich werde nie diesen glibberigen, riesengroßen Fisch vergessen, der nach Luft schnappend auf dem Sand lag. Gott, hat der mir leidgetan!«
Millie verdrehte die Augen, doch ein Grinsen zog über ihr Gesicht, als sie erwiderte: »Das war ein Dorsch. Wir waren zehn und haben einen enormen Dorsch gefangen! Und ich musste das arme Vieh von seinen Qualen erlösen. Du Stadtkind hattest ja keine Ahnung von Fischen.«
Erleichtert darüber, dass die Feindseligkeit aus Millies Blick gewichen war, nickte Sam. »Das stimmt, und daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Mir sind sie lieber im Wasser.«
»Sag bloß, du bist eine von diesen neurotischen Vegetarierinnen?«
»Ach, Millie, jetzt weiß ich wieder, was mir gefehlt hat …«
Skeptisch beäugte Millie die Freundin aus Kindertagen. »Also, was willst du hier bei uns? Deine Großmutter besuchen?«
»Auch, ich wohne bei ihr. Sag mal, hättest du einen starken Espresso für mich?«
»Klar, das kriegen wir Hinterwäldler auch hin.« Sie drehte sich zu einem Kaffeeautomaten um und stellte das Programm ein. Während die Maschine zu rattern begann und der Duft von Kaffee die Friteusendämpfe durchdrang, sagte Millie: »Ist es wegen der ollen Baumstümpfe? Gleich nach dem Sturm waren eine Menge Fotografen hier. Sogar von der BBC kam hier einer reingeturnt. So’n super wichtiger Typ, dachte wohl, wir rollen ihm hier den roten Teppich aus … Zucker?«
Sam schüttelte den Kopf und nahm die kleine Tasse entgegen, die Millie auf den Tresen stellte. Als Sam nach ihrer Handtasche griff, winkte ihre ehemalige Freundin ab. »Der geht aufs Haus.«
»Danke.«
Millie verschränkte die Arme vor der Brust und musterte Sam. »Bist du verheiratet?«
»Nein, und du?«
»Meinst du, ich hätte mir einen von den Holzköpfen hier ans Bein gebunden? Vielen Dank auch. Eigentlich ist so ein Campingplatz nicht übel. Ich habe meinen Spaß. Nur der Winter ist lang.« Millie polierte die perfekt manikürten Nägel an ihrem T-Shirt. »Immerhin gibt es Aberystwyth, obwohl das auch nicht mehr das ist, was es mal war. Die Wirtschaft … Na ja, wie überall eben.«
»Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, wegen der Touristen und der Uni gäbe es hier keine Probleme.«
»Tja, falsch gedacht. Die kleinen Läden machen dicht, und die Ketten kaufen alles auf. Aber es kommen auch viele neue Kunden, reiche Säcke, die nicht wissen, wohin mit ihrer Kohle. Die kaufen alte Häuser auf, bauen Luxusvillen hin und legen sich noch ein Boot in den Hafen. Davon haben wir auf dem Campingplatz nichts.« Millie schnalzte mit der Zunge. »Die Bootswerft hat einen neuen Besitzer. Der lohnt einen zweiten Blick.«
Sam stellte die leere Tasse zurück. »Danke. Sherman? Ich habe, glaube ich, seinen Sohn heute am Strand getroffen. Max? Ein netter Junge.«
»Wirklich? Na, schau an. Was hast du bei dem Wetter da unten gemacht? Doch die Baumstümpfe?«
»Das versunkene Königreich. Du weißt doch, dass ich dafür schon immer eine Schwäche hatte.«
Die Tür fiel ins Schloss, und jemand fragte von hinten: »Eine Schwäche für mich?«
Millie verzog den Mund. »Sicher nicht, Gareth. Diese Lady hier kommt aus Oxford und fragt jemanden wie dich höchstens nach dem Weg …«
Sam räusperte sich verlegen, als sie den mittelgroßen Mann sah, der sie mit offensichtlichem Interesse musterte. Kurze dunkelbraune Haare, ausgeprägte Wangenknochen, dunkle Augen und ein selbstsicheres Lächeln. Die kräftigen Hände waren schmutzig, die Unterarme tätowiert. Er kam ihr entfernt bekannt vor. Oder erinnerte sein Gesicht sie an jemanden aus der Vergangenheit?
Gareth grinste. »Ich weiß schon, wie man sich benimmt, aber ich kann Ihnen nicht die Hand geben, Lady, weil ich gerade einen Wagen repariert habe.« Er sah Millie herausfordernd an und zeigte demonstrativ die ölverschmierten Hände.
»Geh nach hinten und wasch dich. Willst du was essen?« Millie warf ihm ein Handtuch zu, mit dem er sich die Hände abwischte.
»Einen Burger und Pommes.« Gareth riss den Getränkeschrank auf und nahm sich eine Bierflasche heraus.
Bevor Millie den Korb mit den Pommes frites in die Friteuse hängte, ging Sam zur Tür. »Wir sehen uns noch, Millie. Ich werde eine Weile hier sein.«
»Wie du meinst«, kam es wenig ermunternd zurück.
Sam atmete tief durch, als sie draußen stand, und hatte das Gefühl, dass Millie sie als Rivalin betrachtete, genau wie damals als Teenager. Und dafür gab es nun wirklich keinen Grund.
4
Eine Böe erfasste Sams Haare, als sie die schmale Straße zur Kreuzung hinunterlief. Sie zog sich die Kapuze ihres Parkas über den Kopf und sog tief die salzige Meeresluft ein, die vom nahen Strand heraufwehte. Vereinzelt gingen Lichter in den Häusern von Borth an, wobei die Neonreklame des Lighthouse der hellste Fleck in der langen Uferstraße war. Wenn sie schon Begrüßungsbesuche machte, konnte sie auch noch bei Rhodri vorbeisehen, der immer ein freundliches Wort für sie gehabt hatte.
In ihrer Jackentasche vibrierte das Handy. Christophers Nummer erschien auf dem Display. Was wollte er noch von ihr? »Hallo?«
»Sam?«
»Hast du jemand anderen erwartet? Was willst du?«
»Es tut mir leid, ich hätte diesen Brief nicht schreiben sollen, aber Lauren …«
»Aber Lauren? Du gibst ihr die Schuld? Du zerstörst mutwillig meine Karriere, nachdem wir jahrelang erfolgreich im Team gearbeitet haben? Du stellst mich als Lügnerin dar, diskreditierst mich vor dem gesamten Institut, und dann schiebst du die Schuld auf Lauren?« Mit jedem Satz waren ihre Stimme lauter und ihre Schritte schneller geworden.
»Nein, ganz so war es nicht. Sie ist einfach sehr geschickt, bekommt immer, was sie will, jung und bildschön, das schmeichelt meinem Ego. Herrgott, ich bin auch nur ein Mann!«
Sie sah ihn vor sich, wie er sich zerknirscht durch die Haare fuhr und dabei unverschämt gut aussah. Auf sein verschmitztes Lächeln war sie ja selbst hereingefallen, und im Bett hatten sie sich hervorragend verstanden. Es hätte alles perfekt sein können, wenn er nicht so furchtbar eitel und selbstgefällig wäre. Nie wusste man bei ihm, ob er etwas aus Berechnung oder aus Liebe tat. »Mach dich nicht kleiner, als du bist, Christopher. In erster Linie bist du Wissenschaftler, und deine Karriere bedeutet dir alles. Deshalb hast du dich mit Lauren eingelassen und mich ans Messer geliefert. Und was noch mieser ist – du weißt genau, dass ich nicht jeden Teil meiner Mitarbeit belegen kann, sonst hätte ich dich verklagt.«
»Das war ein Fehler, und ich habe Farnham darüber informiert, dass ich wohl etwas zu weit gegangen bin.«
»Etwas zu weit? Du Mistkerl!« Nicht einmal richtig entschuldigen konnte er sich. Und wahrscheinlich hatte er auch dieses Zugeständnis nur gemacht, weil Farnham ihn in die Mangel genommen hatte.
»Das ist wieder typisch für dich, Sam, du reagierst zu emotional. Aber bitte, wenn es dir dort in der walisischen Einöde gefällt, nur zu. Lauren sagt, dass ihr Vater für das nächste Jahr …«
»Ahh!« Wütend beendete Sam das Gespräch und steckte das Handy weg. Hatte er ihr etwa einen Job in seinem Team anbieten wollen? So dreist konnte selbst er nicht sein. Vielleicht doch. Vielleicht machte das den Unterschied aus.
Mehr enttäuscht als wütend biss sie sich auf die Unterlippe und fand sich im blauweißen Lichtkreis des Pubs wieder. Entschlossen stieß sie die Tür auf und war von der Atmosphäre angenehm überrascht. Die Einrichtung war neu, die Wände hell gestrichen, und hinter dem Tresen stand ein junges Mädchen neben Rhodri. Vergessen waren die abgewetzten Plüschsessel, die vergilbten Fotografien und die abgestandene Luft von zwei Generationen Zigarettenqualm und Ale.
Die Hälfte der Tische war besetzt, und in einer Ecke wurde Billard gespielt. Sam zog die Kapuze vom Kopf und öffnete den Parka, während sie zum Tresen ging. Rhodri schien sie zu erkennen, denn ein breites Lächeln erstrahlte auf seinem Gesicht.
»Samantha Goodwin, welch Glanz in meiner bescheidenen Hütte! Wie lange ist es her, seit du hier warst? Lucy, diese hübsche Lady kommt aus Oxford und sieht nicht nur unverschämt gut aus, sondern hat auch eine Menge Grips.«
Besagte Lucy füllte mit versteinerter Miene Saft und Bier in Gläser auf einem Tablett. Sie mochte kaum zwanzig Jahre alt sein, trug ihr langes dunkelblondes Haar in einem Pferdeschwanz und wirkte gelangweilt. »Hi«, war alles, was ihr über die Lippen kam, bevor sie das Tablett aufhob und damit zu einem der Tische ging.
»Meine Stieftochter«, erklärte Rhodri mit gerunzelter Stirn, wischte den Tresen vor Sam mit einem Tuch sauber und sah sie erwartungsvoll an. »Was darf ich dir geben? Ein Glas Wein oder ein Bier? Ich glaube, du mochtest das dunkle.«
Sam zog den Parka aus und legte ihn über einen Barhocker. »Wow, daran kannst du dich erinnern?«
Er überlegte kurz, bevor er eine dunkle Flasche auswählte. Dark-Age stand in keltischen Lettern darauf. »Kennst du dieses hier? Kommt aus Caerphilly.«
Sam ließ das goldbraune Ale in ihr Glas laufen und trank einen Schluck. »Hmm, das schmeckt fast wie ein Teekuchen im Glas. Gut!«
Zufrieden nickte Rhodri. »Dachte mir, dass es dir schmecken würde. Ich liebe meinen Job, das ist das ganze Geheimnis. Im Gegensatz zu Lucy, die an gar nichts Gefallen finden kann. Sieh sie dir an. Schäkert schon wieder mit den Gästen … Entschuldigung.« Schneller, als man es ihm zugetraut hätte, schoss Rhodri um die Bar herum und beorderte seine Stieftochter mit einem scharfen Blick und wenigen Worten zurück.
Mit schwingenden Hüften kam Lucy betont langsam zu ihnen, knallte das Tablett auf den Tresen und band ihre dunkelgrüne Schürze ab. »Mach deinen Mist doch alleine. Ich bekomme noch zehn Pfund für heute.«
Sam rückte automatisch zur Seite, denn Rhodri lief vor Wut rot an. Seine Lippen wurden weiß, und er zischte: »Verschwinde, Lucy.«
Verärgert zog das Mädchen einen Schmollmund, entdeckte eine Frau, die ihr trotz eines Altersunterschieds von zwanzig Jahren so ähnlich sah, dass es sich nur um ihre Mutter handeln konnte, und maulte: »Mum, er will mir meinen Lohn nicht geben.«
Rhodri sah Sam entschuldigend an, deutete mit dem Kopf auf eine Tür hinter der Bar und sagte zu seinen Frauen: »Nicht vor den Gästen. Ihr kommt beide mit.«
Seufzend nahm Sam einen tiefen Zug aus ihrem Glas und blieb bei einem Blick durch den Pub an einem Ölgemälde hängen, das eine mythologische Szene zeigte. Sie legte den Kopf schief, um den Teil, der von einem Pfeiler verdeckt wurde, besser erkennen zu können.
»Das versunkene Königreich von Cantre’r Gwaelod. Aber das hätten Sie wahrscheinlich erkannt …?« Die warme Stimme mit dem Yorkshire-Akzent gehörte einem ausgesprochen interessanten Mann, fand Sam.
Ihre Antwort fiel daher weniger brüsk aus als geplant. »Wie kommen Sie darauf, dass ich das erkannt hätte? Ich bin nicht von hier.«
Der blonde Mann mit den breiten Schultern deutete ein Lächeln an, nicht entschuldigend, nicht herablassend, nur freundlich und wissend. Er wirkte auf eine herausfordernde Art korrekt. Nein, militärisch, korrigierte Sam ihre Beobachtung. »Wo kommen Sie überhaupt her? Haben Sie sich angeschlichen?«