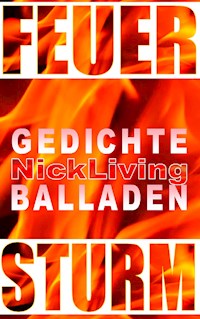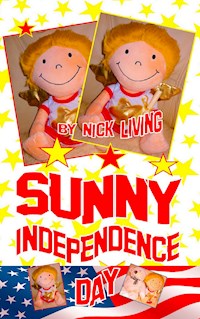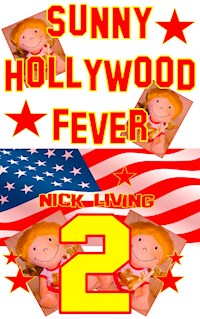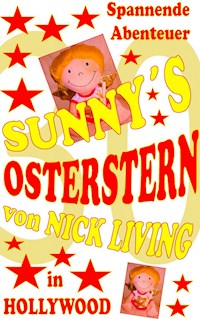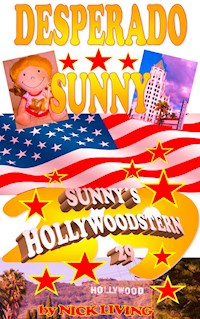Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Diesmal erzählt nicht Sunny selbst, sondern er lässt erzählen, vom Märchenerzähler von Hollywood! Und es sind auch nicht ausschließlich Geschichten für Kinder, es sind Kinder für Groß und Klein. Es sind unfassbare, vielleicht auch ein wenig glaubhafte Geistergeschichten. Sie mögen spannend sein und geheimnisvoll, lassen aber stets Raum für Spekulationen und für den Gedanken, dass da vielleicht doch mehr ist, als wir es uns jemals vorzustellen vermögen. Also lauscht dem Märchenerzähler von Hollywood, oder lest ganz einfach dieses Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SPANNENDE UND UNFASSBARE GESCHICHTEN FÜR KINDER UND ERWACHSENE
Inhaltsverzeichnis
STORY 1
STORY 2
STORY 3
STORY 4
STORY 5
STORY 6
STORY 7
STORY 8
STORY 9
STORY 10
STORY 11
STORY 12
STORY 13
STORY 14
STORY 15
STORY 16
STORY 17
STORY 18
STORY 19
STORY 20
STORY 21
STORY 22
STORY 23
STORY 24
STORY 25
STORY 26
STORY 27
STORY 28
STORY 29
STORY 30
STORY 31
STORY 32
STORY 33
STORY 34
STORY 35
STORY 36
STORY 37
STORY 38
STORY 39
STORY 40
STORY 41
STORY 42
STORY 43
STORY 44
STORY 45
STORY 46
STORY 47
STORY 48
STORY 49
STORY 50
STORY 51
STORY 1
Gerade hatte ich mir ein neues Handy gekauft. Stolz telefonierte ich mit sämtlichen Bekannten und war stundenlang damit beschäftigt, das neue Wunderwerk meinen Bedürfnissen anzupassen. Ich lud mir die verrücktesten Klingeltöne herunter und hörte damit immer und überall meine Musik. Als ich Tage später in den Urlaub fuhr, geschah genau das, womit ich nicht gerechnet hatte … irgendwo draußen, zwischen zwei riesigen Feldern blieb der Wagen stehen und bewegte sich keinen Meter mehr vorwärts. Fluchend schlug ich auf das Lenkrad ein. Doch alles Schimpfen nutze nichts … der Wagen funktionierte nicht mehr und musste wohl abgeschleppt werden. Genervt griff ich nach meinem nagelneuen Handy und wollte den Abschleppdienst anrufen. Doch ich konnte es nicht glauben … es ließ sich einfach nicht einschalten. Mir fiel ein, dass ich am gestrigen Abend noch stundenlang daran herumgestellt hatte. Vermutlich war der Akku leer. Voller Wut warf ich es auf den Beifahrersitz. Zu allem Unglück begann es auch noch zu regnen. Aber es half nichts – ich musste aussteigen, um Hilfe zu holen. Vielleicht gab es in der Nähe eine Siedlung oder ein bewohntes Haus. Ich stieg aus, zog mir die Jacke über den Kopf und lief los. Zu meinem Glück entdeckte ich an einer Trafostation eine alte Telefonzelle. Entschlossen ging ich hinein. Doch auch dort funktionierte nichts. Das Telefon war, wie ich es mir bereits dachte, tot. Gerade wollte ich die Telefonzelle wieder verlassen, da hielt ein klappriger Lieferwagen und drei maskierte Männer sprangen heraus. Ich wollte wegrennen, doch zum Fliehen war es bereits zu spät. Die Männer rissen die Tür auf und brüllten: „Los … Geld raus … her mit den Wertsachen!“ Mir rutschte das Herz in die Hose. Entsetzt starrte ich die Männer an und zog umständlich meine Geldbörse aus der Hosentasche. Plötzlich geschah etwas Merkwürdiges. Einer der Gauner griff schon nach der Börse, die ich ihm entgegenhielt, da knarrte und quietschte die Tür der Telefonzelle und schlug unvermittelt und lautzu. Ich konnte gerade noch rechtzeitig meine Hand zurückziehen. Die Gauner aber gaben nicht auf. Sie versuchten mit aller Kraft, die Tür wieder zu öffnen. Doch es ging nicht. Aus irgendeinem Grund ließ sich die Tür nicht mehr öffnen. Abwechselnd schlugen die Drei gegen die Scheiben, traten heftig mit ihren Springerstiefeln dagegen. Aber die Tür rührte sich nicht. Nun griffen sie zu härteren Mitteln. Eifrig beschäftigten sie sich damit, große Steine in der Umgebung zusammenzusuchen. Ich ahnte, was sie damit vorhatten. Meine Befürchtungen wurden bittere Realität … mit aller Kraft schleuderten sie die Brocken gegen die Verglasung der Zelle. Schon bildeten sich lange Risse … und ich sah mich bereits leblos am Boden liegen. Da knackte und knirschte es in den Scheiben und sämtliche Risse verschwanden. Die Telefonzelle schien sich selbst zu regenerieren. Innerhalb von wenigen Sekunden waren die Scheiben wieder vollkommen in Ordnung. Den drei Gaunern, die jene seltsamen Geschehnisse ebenfalls verfolgt hatten, stand das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Auch sie konnten nicht glauben, was sie da sahen. Schnellstens sprangen sie in ihren Wagen zurück und verschwanden. Es dauerte nicht lange, da erschien ein Streifenwagen der Polizei. Die Beamten erkundigten sich, ob ich drei junge Männer in einem alten Lieferwagen gesehen hätte. Noch immer unter Schock stehend schilderte ich ihnen die furchtbaren Geschehnisse. Mein seltsames Erlebnis mit der Telefonzelle aber verschwieg ich. Vor lauter Schreck vergaß ich, die Beamten um Hilfe wegen meines liegen gebliebenen Wagens zu bitten. Erst als sie wieder abgefahren waren, fiel es mir wieder ein. Jedoch kam ich nicht dazu, mich endlosen Selbstvorwürfen hinzugeben. Ich traute meinen Augen nicht ... die drei Gauner, die ich schon weit entfernt glaubte, kehrten zurück. Doch diesmal wollte ich mich nicht von den Dreien bedrohen lassen. Schnell versteckte ich mich hinter einem Busch neben dem Trafohäuschen. Die Drei hielten tatsächlich an und stiegen aus. Schließlich untersuchten sie die Telefonzelle. Dabei gingen sie äußerst rabiat vor. Sie zerfetzten die herumliegenden Telefonbücher und schlugen wie wild auf den Telefonapparat ein. Vermutlich erhofften sie sich auf diese Weise an das Geld im Inneren heranzukommen.
Auch der Telefonhörer musste daran glauben. Sie rissen einfach das Kabel aus ihm heraus und schlugen ihn dann so lange auf die metallene Telefonbuchkonsole, bis er aufsplitterte und zerbrach. Plötzlich vernahm ich das gleiche Knacken und Knirschen, welches ich bereits von dem letzten Überfall her noch kannte. Laut krachend schlug plötzlich die Tür zu und die Drei saßen in der Falle. Sie standen laut brüllend und tobend in der Zelle und kamen nicht mehr heraus. Und zu meiner großen Erleichterung erschien auch der Polizeiwagen. Diesmal allerdings mit Sirenengeheul und Blaulicht. Die Beamten sprangen aus dem Wagen und umstellten die Telefonzelle. Dann befahlen sie den Gaunern, sofort mit erhobenen Händen herauszukommen. Und … welch Wunder … wie von selbst öffnete sich die Tür und die Drei wurden verhaftet. Ich konnte es einfach nicht glauben. Die Telefonzelle hatte mir tatsächlich zum zweiten Mal das Leben gerettet. Schließlich riefen mir Polizeibeamten noch einen Abschleppdienst und mein Wagen wurde in die nächste Werkstatt gebracht. Meinen Urlaub aber trat ich nicht mehr an. Zu tief saß noch der Schreck und zu teuer war auch die Reparaturrechnung der Werkstatt. Doch all das war mir egal. Ich war nur froh, dass ich bei dem Überfall so glimpflich davon kam. Und manchmal fahre ich hinaus zu der alten Telefonzelle. Dann sitze ich neben ihr im Gras, genieße die Ruhe und weiß in diesem Augenblick genau, dass ich dort so sicher wie nirgendwo auf dieser Welt bin …
STORY 2
Es war der dritte und letzte Verhandlungstag. Der arbeitslose Gauner Eddi Johns war angeklagt, den Banker James Miller aus Habgier ermordet zu haben. Auf einem Friedhof sollte er den Banker abgefangen haben, als dieser gerade dabei war, seinem Vater einen Strauß seiner geliebten gelben Rosen aufs Grab zu legen. Eddi wollte Geld von ihm. Doch als dieser ihm keines geben konnte, schoss er auf ihn. Der Banker starb noch auf dem Grab seines Vaters. Auch der starb vor wenigen Wochen unter merkwürdigen Umständen. Der Mord wurde von einem angetrunkenen Obdachlosen beobachtet, der sein Nachtlager in unmittelbarer Nähe des Grabes aufgeschlagen hatte. Eddi leugnete jedoch bis zur letzten Minute. Schließlich wurde er frei gesprochen. Denn obwohl man dem Obdachlosen glaubte, konnte die Waffe, mit welcher er umgebracht wurde, nirgends gefunden werden. Damit schien der Fall abgeschlossen. Eddi verließ als freier Mann das Gerichtsgebäude. Millers Mutter aber blieb verstört und allein gelassen zurück. Ihre Trauer war unbeschreiblich. Sie konnte den Verlust des einzigen Sohnes einfach nicht verkraften. Ihr ging es von Tag zu Tag immer schlechter. Ein klein wenig Trost fand sie bei ihren geliebten gelben Rosen. Überall im Garten hatte sie diese wunderschönen Blumen angepflanzt. Sehr oft sprach sie mit ihnen. Und gerade jetzt, wo sie in so kurzer Zeit hintereinander den Mann und den Sohn verlor, weinte sie sich bei ihren Rosen aus. Beinahe jeden Tag ging sie auf den Friedhof, um am Familiengrab, in welchem nun auch ihr geliebter Sohn lag, zu trauern. Jedes Mal nahm sie einen Strauß ihrer gelben Rosen mit. Sie konnte nicht mehr allein zu Hause sein. Zu schwer wog der Verlust. An einem Sonntag ging sie wieder einmal völlig verzweifelt zum Grab. Sie hatte zwei große Sträuße gelber Rosen bei sich. Als sie vor dem Grab stand, brach sie weinend zusammen. Dabei fielen ihr die Sträuße aus der Hand. Sie landeten auf der Wiese neben dem Grabstein. Als sie die Blumen wieder aufheben wollte, bemerkte sie etwas Glänzendes, welches sich unter den Blumen im dichten Gras verbarg. Als sie das Gras etwas beiseite drückte, erstarrte sie vor Schreck … im Gras lag ein Revolver! Sie holte den Friedhofsverwalter und der alarmierte die Polizei. Da sich der Fundort in unmittelbarer Nähe des Grabes befand, hatten die Ermittler einen ganz bestimmten Verdacht. Vermutlich war das die Waffe, mit der Eddi den Banker erschossen hatte. Der Revolver wurde auf Fingerabdrücke untersucht. Und wirklich – auf der Waffe fanden die Ermittler seine Fingerspuren. Eddi gestand alles. Doch beim Verhör gab es plötzlich Unklarheiten. Eddi beteuerte, die Waffe in einen Fluss geworfen zu haben. Er beschrieb sogar, an welcher Stelle er den Revolver ins Wasser warf. Die Ermittler untersuchten das gesamte Gelände, welches Eddi beschrieb. Doch einen Revolver fanden sie nicht. Dafür aber einen wunderschönen Strauß gelber Rosen. Irgendjemand hatte sie in den Papierkorb, der am Flussufer neben einer weißen Holzbank stand, geworfen. Einer der Ermittler nahm den Strauß aus dem Korb. Dabei fiel eine kleine weiße Tüte heraus. Darauf war der Schriftzug „Arsen“ zu lesen. Sofort wurde der Rosenstrauß zur Gerichtsmedizin gebracht. Es stellte sich heraus, dass die Tüte ebenfalls Eddi gehört hatte. Denn neben den Fingerspuren, welche auf der Tüte gesichert werden konnten, fanden die Ermittler auch einen kleinen Notizzettel, auf dem der Name und die Adresse von Millers Vater standen. Es war eindeutig Eddis Handschrift! Nun konnte auch der rätselhafte Tod von James Millers Vater aufgeklärt werden. Als die Ermittler Eddi mit dem Rosenstrauß, in welchem sie die Arsentüte fanden, konfrontierten, bestritt dieser, jemals einen Rosenstrauß in seinen Händen gehalten zu haben. Er litt seit seiner Kindheit an einer seltenen Rosenallergie.
Story 3
In den Sommermonaten war ich beinahe täglich mit meinem Fahrrad unterwegs. Da ich noch nicht sehr lange in diesem kleinen Dorf lebte, erkundete ich auf diese Weise die herrliche Umgebung. Auch an den Pfingsttagen des letzten Jahres war es so. Ich zog meine Fahrradkleidung über und fuhr los. Irgendwann landete ich in einem riesigen Waldstück. Es hätte ein wirklich herrlicher Ausflug werden können, wenn da nicht dicke Regenwolken ihre Last ausgerechnet über mir loswerden mussten. Zu allem Unglück hatte ich mich auch noch verfahren! An einer einsamen Gabelung blieb ich stehen und schaute mich ratlos um. Doch ich wusste beim besten Willen nicht, in welche Richtung ich weiter fahren musste. Nirgends fand ich ein Schild und der dichte Wald verhinderte die Sicht. Ich wusste einfach nicht mehr, wo ich mich befand. So wendete ich und fuhr in die Richtung, aus welcher ich glaubte, gekommen zu sein. Doch der Weg endete im Dickicht des Waldes. Plötzlich sah ich einen jungen Mann in einem Jogginganzug. Er stand mitten auf dem Weg und winkte mir zu. Als ich näher kam, rannte er los. Ich verstand nicht, was das zu bedeuten hatte. Brauchte er Hilfe oder wollte er mir den Weg aus dem Wald zeigen? Lange überlegte ich nicht. Ich schnappte mein Rad und fuhr dem Mann hinterher. Hinter einer Biegung aber war er verschwunden. Wieder blieb ich stehen und wartete. Dann plötzlich erschien er wieder. Er stand einfach vor mir auf dem Weg und winkte unaufhörlich in meine Richtung. Und wieder rannte er los. Ich folgte ihm, doch es war so wie eben … Nach einigen Kurven verlor ich ihn aus den Augen. Ich konnte ihn nirgends mehr entdecken. Irgendwann stand ich vor einem kleinen Haus. Es war teilweise von Bäumen verdeckt, sodass man leicht an ihm vorübergehen konnte, ohne es zu bemerken. Ich stieg vom Rad, um mich zu orientieren. Aber der junge Mann zeigte sich nicht mehr. Da ich auch nicht wusste, wo ich mich befand, wollte ich in dem Haus nach dem Weg fragen. Vielleicht konnte mir dort jemand helfen. Ich ging auf die schmale Holztür zu und klopfte vorsichtig an. Dabei sprang die Tür einen Spalt weit auf. Vermutlich hatten die Bewohner vergessen, sie abzuschließen. „Hallo, ist jemand da!“, rief ich laut. Zunächst kam keine Antwort. Doch als ich noch einmal rief, vernahm ich deutlich ein seltsames Stöhnen und Wimmern. Obwohl mir nicht so ganz wohl war, trat ich ein. Noch einmal rief ich, ob jemand zu Hause sei. Und erneut vernahm ich das rätselhafte Wimmern. Langsam ging ich durch den schmalen Korridor. Hinter der nächsten Tür fand ich dann doch jemanden vor – ein Mann lag auf dem Boden und wand sich vor Schmerzen. Neben ihm lag ein Jagdgewehr. Vermutlich hatte sich ein Schuss gelöst. Als ich mich zu ihm herunter beugte, um ihm zu helfen, erstarrte ich … es war der junge Mann, den ich soeben im Wald gesehen hatte. Später stellte sich heraus, dass der junge Mann als Förster in dem großen Waldstück tätig war. An diesem Tage wollte er zur Jagd. Doch kurz zuvor erlitt er einen Kreislaufkollaps. Dabei fiel er auf das Gewehr. Es löste sich ein Schuss und verletzte ihn schwer. Wäre ich nicht rechtzeitig im Haus erschienen, wäre der Mann vermutlich gestorben. Hatte mich vielleicht der Geist des jungen Mannes zu seinem Hause geführt? Waren etwa seine große Not und seine Angst daran beteiligt, dass seine Seele mich zum Haus führte. Ich wusste es nicht und war froh, ihm noch rechtzeitig geholfen zu haben. Als der Mann endlich mit einem Notarztwagen abgeholt werden konnte, wollte auch ich wieder weiter fahren. Dabei fiel mir ein, dass ich ja den Weg nicht kannte. Ich hatte in dem Trubel einfach vergessen, nach dem Weg ins Dorf zu fragen. Da keiner mehr im Hause war und ich mein Handy nicht bei mir hatte, wollte ich das Telefon im Haus nutzen, um zu Hause anzurufen. Doch das funktionierte nicht. Ich konnte es nicht fassen! So viel Pech konnte man doch gar nicht haben. Genervt legte ich den Hörer auf die Gabel und schaute kurz aus dem Fenster. Doch was war das … ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Draußen auf dem Weg stand der junge Mann und lächelte zum Fenster hinüber. Dabei winkte er mir zu und rannte schließlich los …
STORY 4
Manchmal, wenn ich allein zu Hause sitze, erinnere ich mich an die alten Zeiten. Dann krame ich mir die alten Fotos aus dem Schrank und verbeiße mir so manche Träne. Ja, es war schon eine ereignisreiche Zeit, damals, vor 30 Jahren. Auf einem Foto entdeckte ich eines Tages auch unsere kleine alte Bar. Dort hatte ich damals meinen Ehemann Jim kennengelernt. Die Musik, der Blues … „What A Wonderful World“ mit Louis Armstrong … ich höre es noch, als wären all die vielen Jahre nicht vergangen. Ich sah mich mit Jim an einem der wackeligen Holztische sitzen und Rotwein trinken. Ach, wir konnten uns damals kaum etwas leisten. Aber in die kleine Bar gingen wir dennoch immer, wenn wir Zeit hatten. Damals lebten wir noch in einem heruntergekommenen Zimmer mitten in Boston. Wenn wir miteinander tanzten, dann war es so, als kannten wir uns schon eine Ewigkeit. Und dann heirateten wir. Irgendwann zogen wir weg aus der Gegend. Dann kamen die Kinder … die Karriere … das Haus … die Scheidung. Tränen liefen mir übers Gesicht. In die alte Bar sind wir seither nie mehr gegangen. Ich klappte das Fotoalbum zu und beschloss, nach Boston zu fahren. Noch einmal wollte ich nach der Bar suchen … vielleicht gab es sie ja noch. Mir war nach Erinnerungen und die Neugierde ließ mir einfach keine Ruhe. Ich zog eine Jacke über, stieg ins Auto und fuhr nach Boston. Natürlich konnte ich mich nicht mehr genau erinnern, wo sich die Bar befand. Aber ich erinnerte mich noch, dass sie wohl zwischen zwei zierlichen runden Gebäuden stand, die aussahen wie Türmchen. Und tatsächlich, nachdem ich mich mehrmals verfahren hatte, entdeckte ich die winzige Seitenstraße mit den beiden Türmchen. Sogar die Bar gab es noch. Doch die Fenster waren vernagelt und das Schild überm Eingang, welches mir damals viel größer erschien, hing nur noch an einer alten Stromleitung und pendelte im Wind hin und her. Die Schrift darauf war nicht mehr zu erkennen. Ich erinnerte mich, dass wir damals heimlich, um nicht den Eintrittspreis zahlen zu müssen, durch einen Nebeneingang, den ausschließlich das Personal nutze, hinein gingen. Ich suchte nach diesem Nebeneingang. Und ich fand ihn. Er stand offen. Vorsichtig trat ich ein. Unter meinen Schuhen knirschten Glasscherben der zerbrochenen Fensterscheiben. Die schmale Treppe, die zum Tanzsaal hinauf führte, war total verdreckt. Überall lagen zerfetzte Zeitungen und Unrat herum. Es roch muffig und alt. Sogar die Pendeltür zum Saal gab es noch. Ich stieß sie auf und stand augenblicklich in meiner eigenen Vergangenheit. Durch die Spalten der Bretter, die vor die Fenster genagelt wurden, fiel etwas Sonnenlicht auf das zerschundene Parkett. Das Licht verfing sich im Staub des leeren Raumes und verzauberte ihn regelrecht. In der Mitte des Saales stand vergessen ein kaputter Stuhl herum. Ich setzte mich, und was dann geschah, erscheint mir noch heute wie ein Wunder. Als ich mit meinen Fingern an der Unterseite des Stuhles entlang tastete, stieß ich auf etwas Weiches, das unterm Sitzpolster klemmte … es schien Papier zu sein. Ich zog es hervor und betrachtete es. Es war eine alte Zeitungsseite aus dem Jahre 1976. Unter einem langen Text konnte ich ein Foto sehen. Es war schon recht vergilbt. Aber ich konnte genau erkennen, was … oder besser gesagt wer darauf abgebildet war … Jim und ich … wie wir auf dem Parkett tanzend unsere Runden drehten. Ich konnte es nicht fassen … wir beide … damals vor über dreißig Jahren … unbegreiflich. Mir schien es beinahe so, als sollte ich diese Zeitung finden. Denn plötzlich knackte es draußen vor der Pendeltür. Ich erschrak und schaute ängstlich zur Tür. Was, wenn irgendwelche Gauner hereinkämen? Oder vielleicht Obdachlose, die das verfallene Haus für sich okkupiert hatten? Doch es kam ganz anders … als das Knacken und Knirschen verstummte, stieß jemand die Pendeltür auf. Durch das staubige Sonnenlicht konnte ich zunächst nicht sehen, wer da gekommen war. Langsam erhob ich mich von meinem Stuhl. Und jetzt konnte ich sehen, wer dort stand … Jim! Er schaute mich an und wir sprachen kein Wort. Wie konnte das nur möglich sein? Woher wusste er, dass ich ausgerechnet heute hier sein würde? Ich konnte mir all das nicht erklären. Doch es war real … Jim stand wirklich vor mir! In diesem Augenblick spürte ich einen heftigen Stich im Herzen. Mir schossen die Tränen in die Augen … ich konnte meine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Jim lächelte mich an und sprach noch immer kein einziges Wort. Und auch ich konnte nichts sagen … mir hatte es regelrecht die Sprache verschlagen. Das konnte einfach kein Zufall sein! Wir liefen aufeinander zu und umarmten uns. Wir konnten uns nicht mehr loslassen und in diesem Moment war es so, als gäbe es nichts, dass uns noch trennen konnte. Was für ein faszinierender märchenhafter Augenblick. Wir küssten uns und tanzten so wie damals unsere Runden – quer durch den Saal. Und wie im Märchen ertönte der alte Blues, zu dem wir schon damals getanzt hatten … „What A Wonderful World“ mit Louis Armstrong. Wir konnten unser Glück nicht fassen. Stundelang tanzten wir zu einer Musik, die eigentlich gar nicht da zu sein schien. Als es draußen langsam dunkler wurde, hielten wir uns noch immer in den Armen. Wir wussten in diesem magischen Augenblick genau – es musste ein Zeichen sein, dass wir uns genau zu diesem Zeitpunkt in dieser kleinen verfallenen Bar mitten in dieser riesigen Stadt wiederfanden. Es war fantastisch und unwirklich zugleich. Es war unfassbar! Als wir gemeinsam die Bar verließen, schien es uns, als wollte sie sich von uns verabschieden. Ein seltsam trauriges Gefühl schwebte in der Luft. Wir bedankten uns beim Verlassen des alten Gebäudes für diese wundervolle Schicksalsfügung. Und irgendwie schien es, als wünschte uns die alte Bar alles erdenkliche Glück dieser Welt. Jim und ich lebten seitdem wieder zusammen. Und es begann eine intensive und liebevolle Zeit, die wir dankbar entgegennahmen. Ein Jahr später, es war unser Hochzeitstag, wollte Jim wieder zur alten Bar zu fahren. Vielleicht konnten wir dort wie früher tanzen und dem alten Blues lauschen. Dazu nahm Jim einen kleinen CD-Player mit. Er hatte sich vor Jahren die CD mit unserem Lied gekauft. Wir fuhren nach Boston, doch das Gebäude, unsere kleine Bar zwischen den Türmchen gab es nicht mehr. Sie war weggerissen worden. An der Stelle, an welcher sie stand, befand sich nur noch ein Trümmerhaufen. Das Merkwürdigste aber war, dass wir neben dem Schutthaufen einen alten Stuhl fanden. Ich betrachtete ihn mir genau und fand die alte Zeitungsseite mit unserem Foto unter dem Sitzpolster. Ich zog sie heraus und steckte sie ein. Dann erkundigten wir uns in einem Antiquitätenladen ganz in der Nähe, wann das Gebäude weggerissen wurde. Die freundliche Inhaberin schaute uns irritiert an … offensichtlich wunderte sie sich über diese Frage. Schließlich meinte sie kühl: „Die Bar gibt es schon seit dreißig Jahren nicht mehr. Sie ist damals bis auf die Grundmauern abgebrannt. Seitdem liegt der Schutthaufen hier herum und keiner kümmert sich mehr darum …“. Wir konnten es nicht glauben. Doch plötzlich erklang Musik aus der Ferne … ein Blues, welcher uns beiden sehr bekannt vorkam und uns die Tränen in die Augen trieb …„What A Wonderful World“ mit Louis Armstrong. Und wir tanzten in dem kleinen Laden dazu, als sei die Zeit niemals vergangen …
STORY 5
Bis heute kann ich mir nicht erklären, was in dieser furchtbaren Gewitternacht wirklich geschehen war. Aber ich kann mich noch immer an jedes einzelne gruselige Detail erinnern. Seit kurzer Zeit besaßen wir ein kleines Haus auf dem Lande. Wir hatten es uns im letzten Jahr gekauft. Ray, mein Ehemann, arbeitete in der Stadt als Rechtsanwalt. Und es gab Tage, an welchen er nicht nach Hause kam. Er musste sich mit Klienten treffen und sehr viel recherchieren. Da wir uns noch im Aufbau unserer jungen Familie befanden, musste er jedes Mandat annehmen. Wir brauchten einfach das Geld! Ich war im vierten Monat schwanger und saß oft allein zu Hause. Doch ich genoss den herrlichen Ausblick auf den Wald gleich hinter dem Haus. An jenem verhängnisvollen Sommerabend saß ich noch lange auf der Terrasse unseres Hauses. Seit geraumer Zeit las ich in einer alten Bibel, welche ich von meiner Großmutter zum letzten Weihnachtsfest geschenkt bekam. Irgendwann musste ich eingeschlafen sein.
Jedenfalls wurde ich von lautem Donnergrollen eines nahenden Gewitters geweckt. Irgendwie musste die Bibel herunter gefallen sein. Ich hatte sie jedenfalls nicht mehr in der Hand und dachte wegen des Gewitters auch nicht daran, sie zu suchen. Todmüde ging ich ins Haus und vergaß vermutlich, hinter mir die Terrassentür zu schließen. Das Telefon klingelte und Ray war dran. Er meinte nur, dass er auch an diesem Abend nicht nach Hause kommen könnte. So blieb ich also wieder einmal mutterseelenallein zu Haus. Unterdessen war das Gewitter sehr nahe und die grellen Blitze erzeugten sekundenlang merkwürdige Schatten im Zimmer. Plötzlich fiel das Licht aus und mein Telefongespräch mit Ray wurde unterbrochen. Nun war ich also auch noch von der Außenwelt abgeschnitten. Nachdem ich mir noch etwas zu trinken aus der Küche geholt hatte, ging ich nach oben ins Schlafzimmer. Trotz des Gewitters musste ich schnell eingeschlafen sein … jedenfalls wurde ich von einem lauten Knall regelrecht aus dem Bett geworfen. Es hörte sich an, als sei eine Tür vom Wind zugeworfen worden. Oder war es etwas ganz anderes … ein Schuss vielleicht? Ich fuhr hoch und knipste an meiner Nachttischlampe herum. Doch der Strom war noch immer nicht da. Neben meinem Bett hatte ich eine kleine Taschenlampe für Notfälle postiert. Und jetzt war ein Notfall! In mir kroch die Angst hoch – die Angst um mich und um mein ungeborenes Kind. Ich nahm die Taschenlampe und ging hinunter ins untere Stockwerk, wo sich das Wohnzimmer und die Wirtschaftsräume befanden. Aber da war nichts. Lediglich der Wind bewegte die offen stehende Terrassentür auf und zu und erzeugte dabei diese merkwürdigen Geräusche. Erleichtert wollte ich wieder nach oben, um mich ins Bett legen. Da knallte es erneut – diesmal jedoch schien es ganz nah und sehr laut zu sein. Plötzlich überschlugen sich die Ereignisse. Ich stand noch auf der Treppe, da bemerkte ich, wie ein Schatten von der Terrassentür zur Küche huschte. Und schlagartig wurde mir klar … ein Einbrecher musste im Haus sein! Wie angewurzelt verharrte ich auf der Treppe und schaltete die Taschenlampe ab. Ich wagte nicht einmal Luft zu holen. Doch irgendwann musste ich weiter gehen. Der Einbrecher durfte mich nicht zu fassen bekommen. Ich wagte nicht, mir vorzustellen, was er tun würde, wenn er mich entdeckte. Besorgt strich ich mit der Hand über meinen Bauch. Ich dachte in diesem Moment nur an eines … an mein Kind! Glücklicherweise war es eine Stahltreppe, auf der ich stand, so konnte sie wenigstens nicht knarren. Aber mein Pech schien in dieser Nacht nicht mehr enden zu wollen. Ich stieß mit der Lampe an das Metallgeländer …
Das dabei verursachte Geräusch war laut genug, um den Einbrecher auf mich aufmerksam werden zu lassen. Blitzschnell kam er aus der Küche gerannt und stand bewegungslos vor der Treppe. Zu allem Unglück kam auch noch der Strom wieder und das Licht im Haus schaltete sich ein. Nun konnte ich nur noch beten. Der Einbrecher hatte einen schwarzen Strumpf über sein Gesicht gezogen und einen Revolver in der Hand. Damit fuchtelte er wild in der Luft herum. So schnell es mir möglich war, rannte ich die Treppe nach oben, geradewegs ins Schlafzimmer hinein. Ein Schuss fiel … traf mich aber nicht. Hinter mir schloss ich ab und wartete. Ich durfte mich keinesfalls zu sehr aufregen, doch die Angst lähmte meinen gesamten Körper. Was, wenn der Einbrecher die Tür aufbrach? Was, wenn ich mein Kind durch den Schock verlor? Nein, so weit durfte es niemals kommen! Irgendeine Gerechtigkeit musste es doch geben. Wieder fiel ein Schuss … ihm folgte ein lauter Schrei. Dann wurde es schlagartig ruhig. Was war geschehen? Hätte der Einbrecher nicht längst hier oben sein müssen. Bange Minuten vergingen, in denen ich nicht wagte, die Tür wieder aufzuschließen, um nach dem Rechten zu schauen. Die Stille im Haus war unerträglich. Ich zitterte am ganzen Leibe. Mein Blick fiel zum Wecker auf dem Nachttisch … er zeigte „Viertel Zwei“. Plötzlich vernahm ich erneut ein Geräusch … es hörte sich an, als würden Schlüssel klappern. Das musste Ray sein! Oh mein Gott … endlich! Ich musste ihn unbedingt warnen. Hastig schloss ich die Tür auf und rannte zur Treppe. Es war tatsächlich Ray. Sprachlos und wie vom Schlag gerührt stand er in der Diele. Und auch ich blieb entsetzt stehen. Vor der Treppe lag der Einbrecher und rührte sich nicht mehr. Allerdings wimmerte und stöhnte er leise vor sich hin. Vermutlich war er gestolpert und mit dem Kopf auf das Treppengeländer gefallen. Dabei wurde er wohl bewusstlos. Ray erfasste sofort die Gunst der Stunde. In Windeseile holte er einen Strick aus der Küche und fesselte damit den Einbrecher. Unterdessen rief ich die Polizei. Die Beamten kamen schnell und der Einbrecher konnte festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Einbrecher um einen lange gesuchten Mörder handelte. Er hatte bereits eine Frau in einem benachbarten Ort überfallen und getötet. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Offensichtlich war ich noch einmal mit meinem Leben davon gekommen. Glücklich fiel ich Ray in die Arme. Vorsichtig streichelte er meinen Bauch … Und plötzlich sah ich auch meine alte Bibel. Sie lag neben der Treppe. Genau dort, wo wir den Einbrecher fanden. Nachdenklich schaute ich auf das Foto meiner Großmutter, welches an der Wand neben der Treppe hing. Darauf schien sie so seltsam zu lächeln und mir zu zuzwinkern. Bei der Rekonstruktion des Falles wurde herausgefunden, dass der Einbrecher über die Bibel gestolpert war. Ich war mir jedoch sicher, am Nachmittag auf der Terrasse in der Bibel gelesen zu haben. Und zwar ziemlich genau auch eine Textstelle in einem der Zehn Gebote:
„Du sollst nicht töten“
STORY 6
Ken hatte eine Schwäche für Motoräder. Er fühlte er sich schon wie ein Biker. Mit einer Harley durch die Gegend düsen … davon träumte er. Doch leider reichte sein Geld, welches er sich bei seiner Arbeit als Gelegenheitsarbeiter in einer kleinen Baufirma zusammensparte, nur für ein kleines klappriges Moped. Aber er achtete es sehr und freute sich, überhaupt ein Zweirad zu besitzen. Denn er hatte sonst keinen, der ihm irgendetwas geben konnte. Mit seinen Eltern lag er seit Jahren im Streit. Sie wollten nichts mit einem Arbeitslosen zu tun haben und enterbten ihn. Als er schließlich auch noch seine Wohnung verlor und als Obdachloser auf der Straße leben musste, blieb ihm nur noch das alte Moped. Aber seine großen Träume, irgendwann vielleicht doch noch mit einer Harley durchs Land zu fahren, verlor er nie. Auf einem Müllplatz neben der Brücke, unter welcher er nächtigte, fand er eines Tages einen alten rostigen Stahlhelm. Er strich ihn mit schwarzer Farbe an und probierte ihn auf. Er passte sehr gut zu seinem zerschlissenen Lederoutfit und stand ihm wirklich ausgezeichnet. So ausgestattet fuhr er, immer wenn er sich wieder etwas Geld erarbeitet hatte, mit seinem Moped durch die Straßen. An einem verregneten Morgen wollte er schon sehr zeitig los, um der Erste zu sein, wenn die Arbeit verteilt wurde. Er brauchte dringend Geld und konnte es sich an diesem Tage nicht leisten, zu spät zu kommen. Der Regen wurde immer stärker und leichter Nebel breitete sich über der Landstraße, welche in die Stadt führte, aus. Ken fuhr nicht sehr schnell, konnte jedoch kaum etwas erkennen. In einer Kurve verlor er plötzlich die Gewalt über sein Gefährt. Das Moped kam ins Schleudern und rutschte zur Seite. Kopfüber fiel er die Böschung hinunter, stieß mit dem Kopf an einen Stein und landete geradewegs in einem Kornfeld. Sein Moped krachte führerlos gegen einen Pfeiler und blieb dort liegen. Glücklicherweise hatte er den Stahlhelm auf dem Kopf. Dieser schützte ihn vor Kopfverletzungen, die er sich zwangsläufig bei seinem Sturz zugezogen hätte. Eine ganze Weile lag er so da und starrte in den Regen hinein. Dann erhob er sich und nahm den Helm vom Kopf. Doch was war das … im Inneren des Helms entdeckte er eine Nummer. Zunächst konnte er sich keinen Reim darauf machen. Doch über der Nummer entdeckte er ein winziges Zeichen, ein Symbol. Es kam ihm irgendwie bekannt vor … irgendwo musste er es schon einmal gesehen haben. Nur wo? Da er keinerlei Idee hatte, was es mit der Nummer und dem rätselhaften Symbol auf sich haben könnte, setzte er den Helm wieder auf und suchte sein Moped. Zwar war es sehr verbeult, aber es fuhr noch. So konnte er doch noch zur Arbeitsvermittlung fahren und bekam einen Tagesjob in einer Metallfirma zugeteilt, in welcher er schon sehr gejobbt hatte. Schon als er durch das Firmentor fuhr, wurde ihm einiges klar ... Am Tor und auf dem Gebäudetrakt des Betriebes entdeckte er genau das gleiche Symbol, welches auch in seinem Helm eingeritzt war. Er konnte sich jedoch noch immer keine schlüssige Erklärung auf all das geben. Wieso war in seinem Helm ausgerechnet dieses Symbol eingeritzt? Am Nachmittag holte er sich seinen Lohn im Büro ab. Als er auf seinen Abrechnungszettel schaute, entdeckte er die Bankverbindung der Firma. Die Kontonummer glich der rätselhaften Nummer in seinem Helm bis auf die letzten beiden Ziffern. Wie ein Blitz schoss es Ken plötzlich durch den Sinn … die eingeritzte Nummer gehörte hundertprozentig zu dem Symbol der Firma! Vielleicht war es eine Kontonummer? Auf dem schnellsten Wege fuhr er zurück zu seinem geheimen Lager unter der Brücke. Wieder und wieder schaute er auf die Nummer in seinem Helm. Und immer wieder betrachtete er nachdenklich das Symbol. Plötzlich kam ihm eine verwegene Idee … Er wollte zur Bank fahren und dort erfragen, was es damit auf sich hatte. Dazu notierte er sich die Nummer auf einen Zettel. Schließlich fehlten nur noch ein sauberes Hemd und eine passende Krawatte … beides fand er in einem Koffer, den er noch besaß. Er stieg auf sein Moped und fuhr los. Tatsächlich hatte die Bank noch geöffnet. Am Schalter gab er vor, seine Bankkarte verlegt zu haben. Aber die Kontonummer könnte er noch sagen … mit unsicherer Stimme las er die Zahlen von seinem Zettel ab. Die Schalterangestellte schaute Ken zunächst sehr misstrauisch an. Dann fragte sie mit gesenkter Stimme, so, als sollte es niemand hören: „Sind Sie zufällig Ken Meyers? Und wenn JA … haben Sie Ihren Personalausweis dabei?“ Ken wusste nicht, was er sagen sollte, so überrascht war er. Woher wusste die Angestellte seinen Namen? Da er sich aber keiner Schuld bewusst war, nickte er mit dem Kopf. „Ja, das bin ich … wieso?“, fragte er leise und legte seinen Ausweis auf den Tresen. Wortlos nahm die Angestellte den Ausweis an sich und verschwand in den hinteren Teil des Raumes. Aus einem großen Stahlschrank entnahm sie eine dicke Akte. Mit ihr kehrte sie zurück. „Schauen Sie …“, sagte sie dann, während sie Ken den Ausweis zurückgab, „Ein Herr Joseph Meyers ist vor Kurzem verstorben. Vor seinem Tode hatte er noch ein Testament hinterlegt, welches auch beim Notar einzusehen ist. Darin wurden Sie als Alleinerbe benannt. Das Konto, welches Sie uns nun genannt haben, ist jetzt Ihres …“. Vorsichtig schob sie Ken einen Kontoauszug über den Tisch. Der glaubte zunächst, an einer Sehstörung zu leiden … aber es gab keinen Zweifel … auf dem Auszug war ein Guthaben von 2,5 Millionen Dollar zu verbucht. Es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Joseph Meyers tatsächlich um Kens Großvater handelte. Ihm gehörten mehrere Firmen. Unter anderem auch die, in welcher Ken als Gelegenheitsarbeiter ab und zu gejobbt hatte. Die Unterlagen bewiesen, dass Ken alles erben sollte. Warum seine Eltern nie von ihm erzählt hatten, konnte er sich letztlich nur so erklären, dass der Großvater als Soldat im Krieg gekämpft hatte. Darauf waren Kens Eltern nicht sehr stolz. Ja, sie schämten sich sogar dafür. Sie vernichteten alles, was an ihn erinnerte und sagten sich von ihm los. Daraufhin wurden sie von ihm enterbt. Auch den alten Stahlhelm des Großvaters warfen sie nach seinem Tod, von dem Ken nichts wusste, auf den Müll … Ken hatte ihn schließlich kurz darauf zufällig dort gefunden …
STORY 7
S