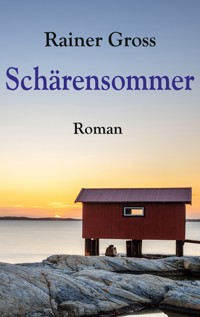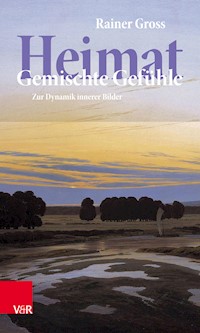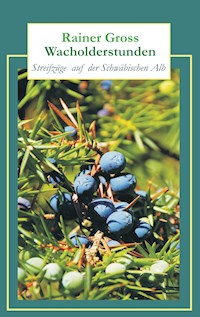Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Jahr des Fuchses, einer Welt ewigen Sommers, kennt sie jeder: die Jahrhunderte alte Sage vom Tempel des Königs. Eines Tages, so sagt sie, wird der junge Held die schwarze Glocke läuten hören und den Tempel des Königs finden. Und der einst vertriebene König wird zurückkehren und sein Reich wiederaufrichten. Es gibt viele Meinungen dazu, und der Glaube an die prophetische Kraft der Sage hat viele Formen. Da gibt es die kleine Mayfair, die davon träumt, den Helden einstmals zu treffen. Da sind die vier, die aufbrechen, um die Wahrheit herauszufinden und die drei Bücher zu suchen. Da ist Zinfandel, der Tinker, der die Königstreue seiner Sippe ablehnt und trotzig seinen eigenen Weg geht. Und da ist der Erzadept, Vorsteher des Adeptenordens, der weiß: Wenn der König zurückkehren würde, dann würde der Orden seine Macht verlieren. Und das will er um jeden Preis verhindern. Davon weiß Peregrin, der Mann ohne Gedächtnis, auf seinen Streifzügen durch die Wildnis, wenig. Von dem Gerede des Gelichters will er nichts wissen; er hat genug damit zu tun herauszufinden, wer er ist. So sucht jeder nach seiner eigenen Wahrheit, bis zu jenem Tag, an dem plötzlich überall das ferne Läuten einer Glocke zu hören ist…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Jahr des Fuchses, einer Welt ewigen Sommers, kennt sie jeder: die Jahrhunderte alte Sage vom Tempel des Königs. Eines Tages, so sagt sie, wird der junge Held die schwarze Glocke läuten hören und den Tempel des Königs finden. Und der einst vertriebene König wird zurückkehren und sein Reich wiederaufrichten.
Es gibt viele Meinungen dazu, und der Glaube an die prophetische Kraft der Sage hat viele Formen. Da gibt es die kleine Mayfair, die davon träumt, den Helden einstmals zu treffen. Da sind die Vier, die aufbrechen, um die Wahrheit heraus zu finden und die Drei Bücher zu suchen. Da ist Zinfandel, der Tinker, der die Königstreue seiner Sippe ablehnt und trotzig seinen eigenen Weg geht. Und da ist der Erzadept, Vorsteher des Adeptenordens, der weiß: Wenn der König zurückkehren würde, dann würde der Orden seine Macht verlieren. Und das will er um jeden Preis verhindern.
Davon weiß Peregrin, der Mann ohne Gedächtnis, auf seinen Streifzügen durch die Wildnis wenig. Von dem Gerede des Gelichters will er nichts wissen; er hat genug damit zu tun heraus zu finden, wer er ist.
So sucht jeder nach seiner eigenen Wahrheit, bis zu jenem Tag, an dem plötzlich, überall, das ferne Läuten einer Glocke zu hören ist…
Rainer Gross, Jahrgang 1962, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Er lebt mit seiner Frau als freier Schriftsteller seit 2014 in Reutlingen.
Bisher veröffentlicht: Grafeneck (Pendragon 2007, Glauser-Debüt-Preis 2008); Weiße Nächte (Pendragon 2008); Kettenacker (Pendragon 2011); Kelterblut (Europa 2012).
Bei BoD u.a. erschienen: Die Welt meiner Schwestern (2014); Das Glücksversprechen (2014); Yūomo (2014); Haus der Stille (2014); Abendzug nach Blankenese (2014); Schrödingers Kätzchen (2015); Drei Tage Wicklow (2015); Haut (2015); Der Traum der Delphine (2015); Halleluja (2015); Das Herz ist ein Reisender – Liebesgeschichten (2015); My sweet Lord (2016); Holiday (2016).
Die Sehnsucht, scheint mir, istdie einzige ehrliche Eigenschaftaller Menschen.
ERNST BLOCH
Für alle,
die mir von Jugend auf die Sehnsucht weckten,besonders für Ritchie.
Inhalt
Erstes Buch:
An einem Tag im Jahr des Fuchses
Erstes Kapitel:
Die Sage
Zweites Kapitel:
Die Straße der Träumer
Drittes Kapitel:
Zurück zu den Quellen!
Viertes Kapitel:
Aventiure
Fünftes Kapitel:
Fee
Sechstes Kapitel:
Der Morgen
Siebentes Kapitel:
Der Fuchs
Achtes Kapitel:
Jelängerjelieber
Zweites Buch:
Der lange Weg
Neuntes Kapitel:
Die schwarze Glocke
Zehntes Kapitel:
Im Kleinen Paradies
Elftes Kapitel:
Die Herberge zur Grünen Laterne
Zwölftes Kapitel:
Die Dame vom Fallenden See
Dreizehntes Kapitel:
Die Mühle am Wasserfall
Vierzehntes Kapitel:
Der Uhrenbaum
Fünfzehntes Kapitel:
Auf dem Fayre
Sechzehntes Kapitel:
Mittsommer
Siebzehntes Kapitel:
Lady Grünärmel
Achtzehntes Kapitel:
Mit zitternder Hand
Neunzehntes Kapitel:
Ein Lebwohl den Königen
Zwanzigstes Kapitel:
Die Grablege
Einundzwanzigstes Kapitel:
Schlösschen
Zweiundzwanzigstes Kapitel:
Niofes Spezereien-Geschäft
Dreiundzwanzigstes Kapitel:
Glücksritter
Drittes Buch:
Der Prinz kehrt heim
Vierundzwanzigstes Kapitel:
Die Wîdan
Fünfundzwanzigstes Kapitel:
Die Wegscheide
Sechsundzwanzigstes Kapitel:
Das Volk
Siebenundzwanzigstes Kapitel:
Der Sitzende Mann
Achtundzwanzigstes Kapitel:
Das Netz
Neunundzwanzigstes Kapitel:
Domicilium Sapientiae
Dreißigstes Kapitel:
Die Fahrt im Mompelfey
Einunddreißigstes Kapitel:
Ich bin’s
Zweiunddreißigstes Kapitel:
Im Fadenkreuz
Dreiunddreißigstes Kapitel:
Die Tür
Vierunddreißigstes Kapitel:
Das Licht am Himmel
Viertes Buch:
Der Tempel des Königs
Fünfunddreißigstes Kapitel:
Der Alte vom Berge
Sechsunddreißigstes Kapitel:
Der Tempel
Siebenunddreißigstes Kapitel:
Die starke Hand
Achtunddreißigstes Kapitel:
Das Jahr des Falken
Neununddreißigstes Kapitel:
Das Gericht
Vierzigstes Kapitel:
Wiedersehen
Erstes Buch:An einem Tag im Jahr des Fuchses
Erstes Kapitel:Die Sage
An einem Tag im Jahr des Fuchses“, begann der Alte zu erzählen. Sie hatten sich zu viert in das Haus in der Baumwurzel zusammengekuschelt, im Ofen knackte ein Feuer, das Eichelbier war stark und schäumte, draußen rann der Regen und gab ein stetiges Rauschen für den Hintergrund der Geschichte.
„Da kam eine Zeit, an die sich die Menschen gut erinnern. Als der starke junge Held aus dem Sonnenaufgang das Läuten der schwarzen Glocke hörte.“
„Was erzählst du da, Gevatter?“, sagte der kleine Troll in seinem Mooshemd. „Das ergibt doch keinen Sinn!“
„Scht, lass ihn doch“, sagte der dicke Bärenmensch, der in seinem Pelz ordentlich schwitzte. „Lass ihn erzählen!“
„Es weiß doch sowieso jeder, worauf das hinausläuft“, sagte der junge Spund, der in seinen engen Lederhosen und mit der Weste aus grüner Felbenrinde am elegantesten aussah.
„Und worauf?“, fragte der Bär.
„Auf den König“, krähte der kleine Troll.
„Kunststück“, brummte der Jungspund. „Alles im Jahr des Fuchses läuft auf den König hinaus. Ich kann das nicht mehr hören.“
„Und ich kann nicht genug davon bekommen“, sagte der Bär, nahm einen Schluck aus seinem Holzbecher und meinte aufmunternd: „Los, erzähl schon weiter, Gevatter!“
„Es gibt nichts zu erzählen“, sagte der misslaunig und vergrub sich in seinem dicken Kittel aus grobem Leinen. Sorgfältig rettete er seinen langen Bart aus den Gewandfalten und legte ihn obenauf, strich ihn glatt. „Jedenfalls nichts, was ihr nicht schon kennt.“
„Darum geht’s nicht“, sagte der Bär gereizt.
„Worum geht’s dann?“, wollte der Jungspund wissen.
„Darum, die Wahrheit der Sagen zu beherzigen. Darum, den König nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Darum, dass wir seiner gedenken bei allem, was wir tun.“
„Bist du ein Königskultler, oder was?“, blaffte Jungspund.
„Nicht jeder, der den König hochhält, ist ein Kultler!“
„Die Sage ist vielleicht doch eine Prophezeiung“, mischte sich der Troll ein.
„Papperlapapp“, sagte Gevatter. „Das Wissen der Altvorderen steckt darin, das ist der Clou! Es ist ein Stück alter Weisheit, gekommen auf uns, damit wir daraus lernen.“
„Da hast du vollkommen recht“, meinte überraschend der Jungspund.
„Ach ja?“
„Vielleicht steckt ja wirklich ein Körnchen Gold in dem ganzen Geröll. Vielleicht will uns die Sage ja wirklich etwas über die kommenden Zeiten erzählen.“
„Das sagst ausgerechnet du?“ Der Bär schüttelte den Kopf.
„Wer sagt denn, dass wir in den Zeiten leben, von denen da die Rede ist“, meldete sich der kleine Troll. „Ich dachte immer, sie erzählt von der Vergangenheit. Das betrifft uns nicht.“
„Der Jungspund mit seiner Lederhaut hat nicht unrecht“, schaltete sich Gevatter ein. „Nur fürchte ich, er meint es anders als ich. Für mich können wir aus dem Wissen der Altvorderen lernen. Für die kommenden Zeiten. Das ist richtig. Aber – “
„Wir können daraus lernen, dass wir nicht auf irgendwelche Schicksalsmächte vertrauen sollten, sondern selbst handeln müssen. Wir haben es in der Hand, ob die Welt zu einem Paradies für uns alle wird oder zu einer Hölle. Das Gerede von Sonnenaufgang und schwarzen Glocken ist doch bloß sinnbildlich. Der starke junge Held – das sind wir alle! Versteht das endlich!“
„Wir haben dich verstanden“, sagte Gevatter geduldig, „und du sagst uns seit Monden nichts Neues.“
„Wieso sinnbildlich?“, fragte der Troll.
„Ihr habt ja alle keine Ahnung“, polterte der Bär. „Alles im Jahr des Fuchses dreht sich um den König. Ohne den König gäbe es kein Jahr des Fuchses. Wir sollten mit ihm rechnen, dort, wo er jetzt ist.“
„Wir sollten vielmehr Wein nachschenken“, sagte der Jungspund.
„Lasst das Feuer nicht ausgehen!“, sagte der Troll und rückte näher an den Ofen.
„Keine Angst, Trollchen“, brummte Gevatter, „hier kann dir nichts passieren. Dieses Wurzelhaus ist sicher.“
„Hast du noch Kastanien zum Rösten?“, fragte der Bär den Gevatter.
„Ach ja. Tu noch ein paar in die Pfanne!“
„Wollen wir nicht lieber von etwas anderem reden?“, meinte der Troll. „Mir ist die Sage nicht ganz geheuer.“
„Kennt ihr die Sage vom Uhrenbaum, der mitten im Wald der Zeit steht?“
Und während neues Eichelbier schäumend ausgeschenkt wurde und die Kastanien in die gusseiserne Pfanne prasselten, ein Duft nach süßem Brot und Nüssen aufstieg und der Regen zunahm, erzählte Gevatter ihnen die Geschichte vom Uhrenbaum, der immer die wahre Zeit anzeigte, nur dass niemand die Uhr lesen konnte.
„Erzähl mir vom Tempel des Königs“, drängte das Mädchen und verhedderte sich mit seinen Öhrchen in dem Leinennachthemd, das es überzog.
„Nicht schon wieder!“, seufzte die Mutter.
„Doch, bitte bitte bitte!“
Die Alderfrau setzte sich auf die Bettkante, wobei ihr schweres Damastkleid raschelte. Als das Kind unter die Daunendecke schlüpfte, nahm die Mutter das Kristallglas vom Nachttisch und gab es ihm.
„Hier, trink zuerst etwas von dem Traumwasser. Damit du gut schläfst.“
„Ich habe noch nie einen bösen Traum gehabt“, sagte die Kleine eifrig. „Nicht, wenn du mir vom Tempel des Königs erzählt hast.“
Wieder seufzte die Alderfrau.
„Also schön.“
Sie begann zu erzählen und schaute dabei aus dem Fenster. Das Kinderschlafzimmer lag im Nordturm des Efeuschlosses. Durch die kleinblättrigen Ranken, die die Aussicht zu einer Märchenvignette machten, sah sie den See daliegen, glatt und silberhell im Schein des Dreiviertelmondes. Der Regen hing als silberner Schleier über dem Wasser und verbarg die Wälder am Ufer. Das gleichmäßige Rauschen war wie eine feste, zuverlässige Stimme in allen Räumen.
Sie liebte das Schloss und dieses beschauliche Gäu am Ende des Sees. Keine Straße führte hierher. Nur mit Schiffen kam die Welt zu ihnen. Ihr Mann, der Aldermann dieses kleinen Reiches, saß in der Bibliothek am Kaminfeuer und las in seinen Abgabenlisten. Seit zig Sommern ging alles seinen gewohnten Gang. Die kleine Mayfair war ein Geschenk gewesen, über das sie sich beide sehr gefreut hatten. Der Aldermann hatte dem König dafür am Hausschrein gedankt, darin war er altmodisch. Sie führte es eher auf die Tränke zurück, die sie ihm in seinen geliebten Federweiß gemischt hatte, Multbeeren und Süßholz und Großer Junifer. Das Rezept hatte sie von der Mume, die das Kind betreute.
„Mama, du bist ja gar nicht bei der Sache“, quengelte ihre Tochter.
„Wieso?“
„Es heißt nicht: das Läuten der schwarzen Glocke erklang! Es heißt: erscholl!“
„Nein, mein Kind“, sagte die Mutter sanft. „In den alten Schriften heißt es: erklang.“
„Aber du hast es mir immer anders erzählt. Du kannst es nicht einmal so und einmal so erzählen!“
„Verzeih, Liebes. Also: An einem Tag im Jahr des Fuchses, als die schwarze Glocke erscholl, schien die Zeit gekommen für den Einen, sich auf den Weg zu machen zum Tempel des Königs.“
„Weißt du, Mama, ich wünsche mir so sehr, den Tempel einmal zu sehen.“
„Aber Liebes, das ist doch nur eine Geschichte!“
„Aber eine wahre Geschichte! Ich weiß es. Einmal wird der Prinz kommen und mich holen. Und wir werden gemeinsam den Weg zum Tempel finden. Und dann werden wir da oben stehen und über die ganze Welt blicken, und darüber hinaus. Und alle werden jubeln und sich freuen.“
„Wie kommst du denn darauf?“
„Das habe ich mir so ausgedacht. Und einmal hab ich es geträumt. Es ist doch so, oder, Mama? Auf dem Berg mit dem Tempel sieht man über die ganze Welt und darüber hinaus.“
„Ja, schon. Es heißt, dass der Blick bis hinter den Horizont geht. Aber das ist sinnbildlich gemeint, Schatz.“
„Was ist sinnbildlich?“
„Man darf es nicht so nehmen, wie es dasteht. Der Blick hinter den Horizont bedeutet, dass man alles sieht, auch alles, was unsichtbar und verborgen ist. Alle Geheimnisse werden gelüftet, und das Versteckte kommt an den Tag.“
„Und was ist dann?“
„Dann… dann… ach, das fragst du am besten deinen Papa!“
„Aber der sitzt doch unten in der Bibliothek!“
„Frag ihn morgen. Jetzt wird geschlafen. Hast du dein Traumwasser getrunken? Schön, dann deck dich jetzt zu. So. Gut.“
Sie gab der Kleinen einen Kuss auf ihre Stirn, die nach Tallilien duftete.
„Gut’ Nacht, Mama!“
„Gute Nacht, mein Liebes.“
Sie stand auf und löschte die Lampe. Das Zimmer war im Dunkeln eine behagliche Zauberhöhle. Nichts konnte hier eindringen, das wusste sie. Sie dankte wemauchimmer dafür, dass die Kleine keine Albträume hatte. Als sie die Treppen des Turms hinunter stieg, überkam sie eine Vorahnung. Etwas würde geschehen. Sie wusste nicht was, aber es würde ihr Leben verändern. Das spürte sie. Unten stand sie am Fenster der Empfangshalle und schaute durch das kühle Glas auf den See hinaus.
Was auch immer geschehen würde, es würde über den See kommen.
Im Ofen prasselte das Feuer, draußen prasselte der Regen. Das Dach des Tinkerwagens war dicht, frisch geteert vom Altfuchs und seinem Sohn. Sie drückten sich in der Enge zusammen und sangen Lieder. Sonst säßen sie draußen unterm Sternenhimmel am Feuer, aber der Sommer war für ein paar Tage ins Wasser gefallen.
Sie hatten dem Pony einen trockenen Unterstand gebaut für die Nacht. Der Lagerplatz an dem kleinen Fluss war ideal, die Landstraße nicht weit weg, und trotzdem würde sie hier niemand stören.
„Sing uns das alte Lied vom Tempel des Königs“, sagte der Kleine von der Silberfähe. „Das mag ich so gern.“
„Wir singen es alle“, sagte der Altfuchs und spielte ein paar Töne auf seiner Gitarre.
„Den Text kennt ihr?“
„Jaaa!“
Sie sangen, andächtig und ehrfurchtsvoll, denn das Lied vom Tempel des Königs war nicht nur ein Lied, sondern eine Art von Beschwörung. Indem man es sang, gab man den alten Sagen Recht und bezeugte den Glauben, dass es den König gab. Die Tinker verehrten den König, auch wenn sie ihn noch nie gesehen hatten. Viele sagten, er herrsche immer noch, nur jetzt im Verborgenen.
Das Jahr des Fuchses, die eiserne Glocke, der starke junge Held vom Sonnenaufgang. Dann wurde die Musik wilder und der Gesang eindringlicher. Vom Zauberkreis war die Rede, in den der Held trat. Von seiner zitternden rechten Hand, die das Geheimnis enthüllte. Der Alt-Alte sang: Himmel, hilf! und der Tag brach eben an.
Der Altfuchs spielte noch ein paar Takte und ließ die Melodie ausklingen.
Jeder saß da, in seinen Träumen versunken. So erging es ihnen immer, wenn sie das Lied vom Tempel des Königs sangen. Bilder stiegen auf in ihren Seelen, werweißwoher. Ihr Blick reichte in ferne Welten und vergangene Reiche, sie sahen den König durchs blühende Land reiten, sahen Frühling und Herbst, Sommer und Winter kommen und gehen, träumten sich jeder ein kleines Stück Sehnsucht und Paradies zusammen.
Nur Zinfandel nicht.
Er war der Sohn des Silberfuches, des einen Sohnes vom Altfuchs. Als die letzten Töne verklangen, lachte er sein meckerndes Lachen, das ihm den Spitznamen Ziege eingebracht hatte.
„Was meckerst du so?“, blaffte ihn seine Mutter, die Silberfähe, an.
„Das sind Märchen für Kleinkinder“, sagte er und duckte sich, weil er die ausholende Hand seines Vaters sah. Der Schlag ging ins Leere, Zinfandel meckerte.
„Du hast keine Ehrfurcht vor niemandem“, seufzte die Rotfähe, seine Tante.
„Lass ihn doch! Wenn er nicht an den König glaubt, ist das seine Sache“, sagte der erwachsene Sohn der Rotfähe, sein Vetter.
„Du verteidigst ihn immer, Weißrute“, murrte der Altfuchs. „Das ehrt deinen Familiensinn, aber es geht nicht an, dass er mit unserer Sippe herumzieht und das Alte schlechtmacht.“
„Sag, Ziege“, schaltete sich seine Base ein, die Gescheckte, „spürst du denn nicht auch diese unbestimmte Sehnsucht in dir aufsteigen, wenn du das Lied hörst? Siehst du nicht die Bilder, die es heraufbeschwört?“
„Das ist kein Beweis“, knurrte Zinfandel und duckte sich in seiner Ecke zusammen, nun, da wieder die ganze Sippe gegen ihn war. Immer hackten sie auf ihm herum. Immer machten sie ihm Vorschriften und sagten ihm, was er zu tun und zu denken hatte.
„Das ist bloß allgemeine Befindlichkeit.“
„Wie er redet!“, klagte die Silberfähe.
„Wie ein Magister! Das ist das neumodische Zeug, dass er in den Städten gelernt hat. Davon kommt nichts Gutes.“
„Es kommt das eine Gute“, sagte Zinfandel trotzig, „dass man seinen eigenen Verstand gebraucht.“
Wieder holte der Silberfuchs zum Schlag aus, und diesmal traf er. Es klatschte, Zinfandel rieb sich seinen Nacken.
„Aua!“
„Uns allen, bis auf Ziege vielleicht, hat es sehr gut getan, das Lied zu singen“, sagte Weißrute begütigend. „Ob wir nun daran glauben oder nicht, der Glaube an den König macht uns als Tinker aus. Er gehört zu uns wie der Wagen und das Pony und das Gemeine Wegerecht, das der König uns verliehen hat.“
„Wahr, wahr“, stimmte die Altfähe zu.
„Und was passiert eigentlich, wenn wirklich einmal die Glocke anfängt zu läuten?“, fragte der Kleine von der Silberfähe. Er hieß F-U-X, weil er so gern Wörter buchstabierte.
„Das fragt man nicht!“, fuhr ihn seine Mutter an.
„Lass Kinder fragen!“, entschied der Altfuchs. „Sie wissen noch wenig vom Jahr des Fuchses, und woher sollen sie’s erfahren, wenn sie nicht fragen dürfen?“
„Das ist doch nur eine Sage von vielen“, erklärte der Rotfuchs, ein besonnener, etwas bequemer Mann. Die Rotfähe schaute ihn misstrauisch an.
„Lass mich doch auch etwas sagen“, meinte er verteidigend zu ihr.
„Ich sag ja gar nichts.“
„Ich meine nur, da wird vom König erzählt, von seiner Rückkehr eines Tages. Das darf man nicht wörtlich nehmen. Wir wissen, dass er da ist, auch wenn wir ihn nicht sehen.“
„Du meinst, den starken jungen Held vom Sonnenaufgang wird es gar nicht geben? Und der Tempel des Königs wird nicht entdeckt werden?“
„Vielleicht“, murmelte sein Onkel und hatte das Gefühl, für heute Abend genug gesagt zu haben.
„Er wird eines Tages entdeckt werden“, sagte der Silberfuchs, „nur weiß keiner, wie und von wem. Eines Tages wird der König zurückkehren, aber das ist noch sehr lange hin.“
„Warum horcht ihr eigentlich nicht den ganzen Tag in die Welt hinaus“, meckerte Zinfandel dazwischen, „um die Zeichen eures Königs zu entdecken? Wenn ihr schon glaubt, dass er regiert? Warum versucht ihr nicht, seinen Willen für die heutige Zeit herauszufinden, warum lebt ihr nicht ständig in seiner Gegenwart, wenn ihr doch daran glaubt? Das wäre doch ein Grund zur Freude! Stattdessen zieht ihr schwermütig und griesgrämig durchs Land und betrauert die Vergangenheit. Das ist es, was mich am König stört.“
Bevor er wieder einen Schlag ins Genick bekam, drängte er sich durch die Sitzenden hindurch und öffnete die Tür des Wagens. Draußen rauschte der Regen. Es war kühl und unwirtlich. Er warf die Tür hinter sich zu und ging zum Fluss.
Das Rauschen des Regens verschmolz mit dem Strömen des Flusses. Am Ufer stand der kleine Schrein, den sie dem König aus Steinen gebaut hatten. Unter dem großen flachen Deckstein brannte trüb ein Glaslicht, daneben lag ein Sträußchen mit Butterblumen und Tausendschön.
Er starrte wütend darauf und versetzte ihm einen Tritt. Die Seitenwände kippten weg, der Deckstein fiel herab, das Licht erlosch, Glas splitterte.
Durchnässt und unzufrieden schaute er auf sein Werk. Dann ging er zu dem Verschlag, in dem das Pony stand.
Er redete ihm ruhig zu, als er unter die Plane schlüpfte, streichelte seine Mähne, tätschelte ihm den Hals. Das Pony schnorchte leise.
„Ihr habt ja alle keine Ahnung“, murmelte er vor sich hin. „Eines Tages kommt tatsächlich ein starker junger Held und errichtet seine Herrschaft, und dann steht ihr da mit euren verkrusteten Ansichten vom König und eurem nutzlosen Leben. Mit euren Sehnsüchten und Bildern von einer heilen Welt. Dann wird die neue Welt tatsächlich kommen, und ihr werdet zittern und euch wünschen, dass alles beim Alten geblieben wäre.“
Er rieb die feuchten Flanken des Ponys mit einer Handvoll Heu ab. „Das Alte und das Neue“, seufzte er, „das ist nämlich nicht so einfach.“
Er fragte sich im Stillen, warum er den König so hasste und den Glauben der Tinker an ihn so verabscheute. Weil ich darin keinen Platz habe, sagte er sich. Aber gab es im Jahr des Fuchses denn überhaupt einen Platz für ihn?
In den Felsklausen wurde es früher dunkel. Die Höhlen waren in den Sandstein gehauen, die Häuser in Nischen und Überhänge gebaut. Mächtige Korkeichen klammerten sich in den Fels und verbargen das Kloster. Ein starker, gleichmäßiger Regen fiel. Der Erzadept entzündete die Lampe und trat ans Fenster. Auf dem Schreibpult waren Pergamentrollen ausgebreitet und alte Folianten aufgeschlagen.
Davor saß sein Ratgeber und hatte die Hände im Schoß gefaltet. Er blickte auf die Papiere auf dem Tisch und schüttelte den Kopf.
„Es regnet, als wollte es die ganze Welt ertränken“, sagte der Erzadept.
„Meint Ihr wirklich?“, sagte der Ratgeber.
„Das ist nur so ein Spruch. Aber manchmal…“
Er wandte sich vom Fenster ab und trat zum Schreibpult. Er fuhr mit der Hand durch die Papiere, dass es raschelte.
„Die Leute haben Angst, Eure Erhabenheit“, sagte der Ratgeber. „Es gibt keinen Grund, das Jahr des Fuchses ist sicher, aber sie haben Angst. Albträume sind ein weit verbreitetes Übel, manche haben Gesichte und Erscheinungen.“
„Ich weiß, Ratgeber. Ich selbst habe sie manchmal.“
„Allgemein herrscht der Eindruck, dass an der Welt etwas fehlt. Ihr wisst, was ich meine.“
„Ich weiß, Ratgeber, ich weiß. Die Metafüsische Lücke wird es genannt in unserem Orden. Ein alter Hut im Grunde. Aber wir haben ihnen Hoffnung zu geben.“
„Haben wir?“
„Dazu ist vor Zeiten der Orden gegründet worden, Bruder Ratgeber. Das wisst Ihr. Um das Andenken des Königs zu bewahren und zu fördern.“
„Die Sage vom Tempel des Königs geht wieder verstärkt um. Für manche ist es nur altes Spruchgut, Weistümer, die es aus Ehrenpflicht zu bewahren gilt. Aber viele nehmen sie auch ernst und hängen ihren Glauben daran.“
„Ja, ich weiß“, sagte der Erzadept. „Der sogenannte neue Königsglaube. Das ist nicht in unserem Sinne. Obwohl es der Glaube ist, den wir fördern wollen, fördern und lenken. Um das Jahr des Fuchses zusammenzuhalten.“
„. Wir sind die Bewahrer, Eure Erhabenheit.“
„Wir sind die Hüter. Wir legen die Schriften aus. Die Leute fragen uns, was sie über bestimmte Dinge denken sollen, und wir lehren sie. Ein einfaches Geschäft wie das Katzenmachen.“
„Eure Erhabenheit?“, fragte der Ratgeber verständnislos.
„Nur ein Spruch. Ich mache heute gern Sprüche.“
„Ihr seid unser Meister, seit dreißig Sommern.“ Der Ratgeber verneigte sich devot.
Der Erzadept gab einen spöttischen Laut von sich.
„Seit dreißig Sommern! Das ist auch so etwas. Seit unausdenklichen Sommern gibt es nichts als Sommer. Früher, in der mythischen Vorzeit, heißt es in den Sagen, rechnete man in Jahreszeiten, aber die gibt es im Jahr des Fuchses nicht. Die Zeit steht still seither, Bruder Ratgeber. Alles läuft ab wie ein Uhrwerk, aber ohne Ziel, ohne Sinn. Leben, Sterben, Zeugen, Häuser bauen, Geschäfte treiben –wozu? Die Leute verlangen eine Antwort!“
„Haben wir sie nicht, Eure Erhabenheit?“
„Wir haben sie, natürlich. Offiziell. Die Sagen und das Lied vom Tempel erzählen von einem Goldenen Zeitalter, das es einmal gab, und halten so die Hoffnung wach, dass es dermaleinst zurückkehren wird. Das ist unsere Antwort.“
„Sie reicht dem Volk aber nicht“, wandte der Ratgeber ein. „Es hat den Königskult geschaffen, den alten Königsglauben. Dass der König aus dem Verborgenen das Jahr des Fuchses beherrsche.“
„Auch das ist nicht ganz in unserem Sinne, nützt uns aber. Wir haben es toleriert, und wir werden es weiter tolerieren. Trotz der abergläubischen Auswüchse.“
Der Erzadept setzte sich auf den Stuhl hinter dem Schreibpult und legte seinen Kopf in beide Hände. Der Ratgeber blickte zu Boden.
„Wir sind die Adepten“, fuhr der Meister fort. „Wir haben Antworten zu geben. Aber im Grunde gibt es keine Antworten. Wir haben vielleicht nicht einmal die richtigen Fragen. Was es gibt, ist Politik, Ordenspolitik. Wisst Ihr, Bruder Ratgeber, im Grunde weiß ich selbst nicht, was ich glauben soll. Ich halte mich an die offizielle Lehrmeinung, aber innen drin“, er legte die Hand auf die Brust, „tief drinnen, da… manchmal…“ Er verstummte.
„Die Leute sagen, es sei die Zeit gekommen, in der sich etwas bewegen wird“, begann der Ratgeber vorsichtig. „Die Leute meinen –“
„Die Leute reden viel. Wir, wir müssen ihnen sagen, was sie reden sollen! Wir sagen nicht: Lauscht, ob ihr eine Glocke hört! Schaut, ob ihr einen Helden seht! Erzählt die Sage, bis es soweit ist! Das dürfen, das können wir nicht sagen.“
„Ich weiß, Eure Erhabenheit. Aber wenn nun die Sage vom Tempel wirklich prophetisch wäre?“
„Dann würde etwas geschehen, das die ganze Welt verändert. Wenn der König aus der Verborgenheit zurückkehren würde, dann würde nichts mehr so sein wie vorher.“
„Das habe ich noch nicht bedacht“, gab der Ratgeber zu.
„Ich habe den literarischen Gehalt der Sage eingehend studiert. Das Lied, auf dem die Sage beruht, bekundet es klar: Die Antwort wird gefunden werden, alle werden im Kreis vereint sein, der neue Tag bricht an und das letzte Geheimnis wird gelüftet. Es wird alles an den Tag kommen, alles, was jeder getan, gesagt, gefühlt, gedacht hat. Auch wir werden uns dem Licht stellen müssen. Es würde das Ende unseres Ordens sein. Versteht Ihr das, Bruder Ratgeber?“
„Ich denke schon, Eure Erhabenheit.“
„Lange Jahrhunderte haben wir die Förderung der vielen Sagen des Königs betrieben, ihre Verbreitung unterstützt, ihren Sinn ausgelegt. Jetzt, wo manche soweit sind, an die Sage vom Tempel zu glauben, jetzt müssen wir dem entgegentreten. Wir müssen die Auslegung vorgeben. Wir haben die Deutungshoheit. Wir müssen alles tun, damit das Jahr des Fuchses bleibt, was es immer war.“
„Sind das Eure Anweisungen, Eure Erhabenheit?“
Er schaute auf, die Augen müde, die Hände noch an den Wangen, als brauchten sie Liebkosung.
„Ja, das sind meine Anweisungen. Macht die Sage vom Tempel zu einem Mythos! Verharmlost sie! Entlarvt sie meinethalben als Märchen! Macht sie zum Volkslied, auf das man gedankenlos tanzt! Tut alles, damit die Leute den König vergessen!“
„Den König vergessen? Verstehe ich richtig, Eure Erhabenheit?“
„Jenen König, der von unseren Altvorderen vertrieben worden sein soll, der zurückkehren, der alles umstürzen und neu machen soll. Ich will nur noch den König haben, der in grauer Vorzeit regiert hat und dem das Jahr des Fuchses gedenkt. Einen König, der eine unbestimmte Hoffnung darstellt. Einen König, der uns nicht stört.“
„Ich verstehe, Eure Erhabenheit.“
Der Ratgeber erhob sich und verbeugte sich.
„Entlasst Ihr mich hiermit?“
Der Erzadept winkte mit der Hand.
Als der Ratgeber gegangen war, seine Schritte draußen im Felsgang verhallten, starrte der Erzadept in die Flamme der Lampe. Jetzt hörte er wieder das stetige Rauschen des Regens. Es schien ihm wie ein gleichmütiger Widerspruch zu dem, was er in sich fühlte, eine beharrliche, leise Stimme, die im Hintergrund flüsterte und unausweichlich heraufbeschwor, was niemals kommen durfte.
„Himmel, hilf!“, flüsterte er vor sich hin.
Zweites Kapitel:Die Straße der Träumer
Ein Sonnenstrahl fand den Weg unter den Baumschatten und kitzelte ihn an der Nase. Er musste niesen und erwachte. Erstaunt blickte er sich um.
Er war weniger erstaunt, wo er sich befand – er war vor allem darüber erstaunt, dass es ihn gab. Die Sache war nämlich die, dass er kein Gedächtnis besaß, oder genauer: dass sein Gedächtnis nur vom Morgen bis zur Nacht reichte. Am Morgen – so einem wie diesem, einem schönen, kühlen Sommermorgen mit der Luft vom Sonnenlicht trunken, dem Zwitschern der Vögel und dem Duft nach Wald und Gras – wusste er nicht mehr, wie er am Abend hierher gekommen war. Er wusste nicht mehr, dass es ein Gestern gegeben hatte, ja, er merkte oft nicht einmal, dass er überhaupt etwas vergessen hatte. Das war das Schlimmste.
Indes machte es ihm keinen Gram. Er wunderte sich nur, Morgen für Morgen, wenn er wach wurde und sich fragte, was das wohl alles sei und wohin das führen wollte. Das Vergessen war so vollständig, dass er anfangs dachte, er sei aus einer anderen Welt hier herübergeholt worden, von einem Augenblick zum anderen, und sehe sich nun Aug in Auge mit einer fremden Umgebung. Da er sich aber an keine andere, vorherige Welt erinnern konnte, folgerte er, dass er sich gestern schon hier befunden haben musste. Allmählich glaubte er daran, dass es ihn nicht nur den Tag lang gab, an den er sich erinnern konnte, sondern dass er eine Existenz hatte, die sich über längere Zeit hinweg erstreckte.
Zudem betrachtete er sein Bild im Spiegel eines Sees und sah, dass er jung war, bartlos und schlank und gesund. Ein junger Kerl im besten Alter, wie ihm schien. Woher wusste er das?
Er stellte fest, dass er doch manche grundlegenden Dinge nicht vergaß. Auch praktische Fertigkeiten und Wissen vergaß er nicht: wie man ein Feuer machte, wo man Wasser fand, welche Früchte und Beeren, Pilze und Nüsse essbar waren.
Das alles reifte in ihm zu der Erkenntnis, dass er jemand war, der nur am Mangel des Erinnerungsvermögen litt, nicht aber an einem grundsätzlichen Zweifel am Dasein selbst.
Im Übrigen war er nicht philosophisch veranlagt. Er stand auf, rieb sich den Schlaf aus den Augen, betrachtete verwundert die Feuerstelle unter dem Baum, an der er offensichtlich die Nacht verbracht hatte, und entdeckte den ledernen Beutel, von dem er plötzlich wusste, dass es sein Felleisen war. Neugierig, wie jeden Morgen, stöberte er darin herum und fand folgendes vor:
ein Messer
Zunderzeug
einen Eisentopf
eine Blechtasse
einen Blechlöffel
einen warmen, regendichten Mantel
Nähzeug
ein Knäuel Hanfschnur
etliche nützliche Kleinigkeiten.
Er stand auf und schaute an sich herab. Er trug:
Beinlinge aus grünem Leder
eine grüne Bluse
ein grobwollenes braunes Wams
einen Gürtel mit silberner Schnalle
Stiefel.
Darunter, er schaute nach,
– eine schenkellange Unterhose.
Er wusste, was ein Mann war, und erkannte, dass er einer war. Er wusste natürlich auch, was Frauen waren, obwohl er noch keiner begegnet war.
Oder doch?
Die Gegend, in der er erwachte, war menschenleer. Das Bild der Welt, das er in seinem Kopf fand, zeigte ihm einen endlosen, grüngoldenen Sommer, in dem keine Gefahr drohte, die Tiere zutraulich waren und ein warmer Ton von Zuneigung und Fürsorge durch das Erdreich ging. Anderen Menschen war er bisher nicht begegnet.
Oder doch?
Wenn ja, würde er sich nicht erinnern.
Das hieß, er konnte sehr wohl Menschen begegnet sein, oder Frauen, oder in dieser Beziehung nicht so unschuldig sein, wie er sich fühlte.
Das war ein seltsamer Gedanke.
Noch seltsamer war die Frage, wer er war.
Er wusste von keinem Namen, der ihm zugehörte. Er war einfach er. Wenn es nach ihm ginge, konnte das so bleiben, aber manchmal, wenn er den Dingen um sich her, den Blumen, den Bäumen, den Vögeln Namen gab, hatte er das Bedürfnis, sich selbst auch so nennen zu können: irgendein Wort aussprechen und wissen: Das bin ich. Jetzt ist von mir die Rede. Ein Name war wichtig.
Daran erkannte er erstens, dass er die Sprache und die Wörter von Morgen zu Morgen nicht vergaß. Und zweitens, dass er nicht wissen konnte, ob er sich nicht schon längst einen Namen gegeben hatte, ihn aber immer vergaß, sich jeden Morgen dieselbe Frage stellte und jeden Morgen zum selben Ergebnis gelangte. Wenn ja, dann war das äußerst lästig und mühsam.
Er blickte über der Wiese hin, die sich vom Waldrand an senkte, sah einen Greif segeln, mit steifen Schwingen lavierend, spähend ins Gras nach Beute. Dann schwang der Vogel wieder auf, gewann Höhe und kreiste im dunstblauen Himmel. Er schrie, ein katzenartiger Schrei, der ihm eine Gänsehaut machte.
Peregrin, dachte er plötzlich.
Das ist ein schöner Name. Ich könnte mich Peregrin nennen. Das ist der Vorteil, wenn man ohne Vergangenheit ist. Ganz frei in einer freien Welt. Niemand hat ein Anrecht auf mich, niemandem bin ich verpflichtet, nur weil ich einen Namen trage – nur ich selbst gebe mir eine Identität.
Nur, fragte er sich, was kann ich tun, damit ich ihn nicht wieder vergesse?
Obwohl er wie gesagt nicht philosophisch veranlagt war, kam ihm der Gedanke des Niederschreibens. Er könnte doch einfach ein Stück Papier – hatte er eins? – nehmen und mit einem Griffel – hatte er einen? – oder einer Feder – hatte er eine? – den Namen aufschreiben. Dann würde er ihn morgen finden und wieder wissen, wie er sich genannt hatte.
Aber er ahnte nicht, welche philosophischen Komplikationen er damit heraufbeschwor.
Wenn er den Namen aufschreiben könnte, würde er ihn morgen in seiner Hose finden und zunächst nicht wissen, was es damit auf sich hatte. Er würde einen Namen finden und nicht wissen, wer oder was damit gemeint war. Wenn er nun aufschriebe: Ich bin Peregrin, wüsste er dennoch nicht, wer dieser Ich war. Er fände einen Zettel von einem Jemand, der von sich in der ersten Person schrieb, und hätte keinerlei Hinweis darauf, dass er selber damit gemeint war. Die Frage war also: Wie konnte er sich selbst eine Botschaft schicken, damit er wusste, dass er jener Ich war, der da schrieb?
Er hatte noch nie geschrieben, fiel ihm ein. Er wusste nicht, wie seine Schrift aussah – obwohl er überzeugt war, schreiben zu können, genauso wie lesen –, sodass er seine Handschrift auch nicht wiedererkennen würde. Zudem würde er das vielleicht vergessen haben. Und zudem: Wer sagte ihm, dass er diese Überlegungen nicht schon einmal oder öfter oder jedesmal angestellt hatte, sich einen Zettel geschrieben und ihn dann achtlos weggeworfen hatte, weil er seine Bedeutung vergessen hatte?
Und wer sagte ihm, dass er nicht gestern Abend diese Überlegungen angestellt und sich einen Zettel geschrieben hatte?
Fieberhaft begann er, in den Taschen seiner Hose zu suchen, im Felleisen, in seiner Weste, überall. Er fand keinen Zettel. Was nichts besagte.
Aber, überlegte er: Wenn ich mit meinen Überlegungen so weit gekommen bin heute Morgen, dann stehen die Chancen gut, dass ich auch morgen so weit gelangen werde. Und dann würde ich die Bedeutung des Zettels erkennen, wenn ich mir einen geschrieben hätte. Also wäre es durchaus sinnvoll, dachte er, wenn ich mir nun einen Zettel schreiben würde. Allerdings müsste ich diesen Aufwand jeden Morgen betreiben und mich jeden Morgen daran erinnern, dass ich Peregrin heiße, und jetzt qualmte ihm der Kopf vor der ungewohnten Anstrengung, und er gab auf.
Ach was, dachte er. Soll es gehen, wie es will.
Er beschloss, sich um das Frühstück zu kümmern, denn er hatte Hunger. Und wie von selbst kam ihm der Gedanke an Vogelnester in den Bäumen, an Bucheckern, die er sammeln konnte, oder an einen Fisch, den er fangen würde, wenn es in der Nähe einen Fluss gab.
So machte er sich auf den Weg, um herauszufinden, was die Gegend für ihn bereithielt.
Der Abend senkte sich über den Wald. Es war ein verwunschener Wald, die knorrigen Baumgestalten standen dicht wie Wächter, drinnen bildete das Zweigwerk Tunnel und Gewölbe, rotgolden vom Abendlicht.
Wie viele Tage vergangen sein mochten, konnte er nicht sagen. Die Frage kam ihm gar nicht, und sie hätte auch keinen Sinn ergeben, denn er wusste ja jeweils nur von einem einzigen Morgen. Er hatte aufgehört, sich über die Zeit Gedanken zu machen, und lebte im Augenblick. Mittags war er über eine Hochweide gegangen und hatte eine Herde Schafe entdeckt, aber keinen Hirten. Woher er wusste, dass zu einer Herde ein Hirte gehörte, hätte er nicht zu sagen gewusst. Zum Glück fragte ihn niemand.
Nun, am Abend, war er am bewaldeten Hang abgestiegen und auf eine Wacholderheide gestoßen. Von ihr aus hatte er einen Blick ins abendliche Tal. In den Kräutern und Moosen nistete noch die Wärme vom Tag, und als er ganz abgestiegen war, geriet er in einen Talwinkel und stieß auf den verwunschenen Wald.
Er stand am Rand und spähte hinein. Deutlich zeichnete sich ein Weg durch den Tunnel ab. Eine Art Straße, sie war gepflastert mit Katzenkopfsteinen und besaß ordentliche, mit langen Gneisquadern belegte Bankette. Er machte sogar einen ungepflasterten Streifen aus, der wohl ein Sommerweg sein musste, was im Jahr des Fuchses allerdings keinen Sinn ergab, da ja immer Sommer war.
Er wusste nicht, ob er die Straße betreten sollte.
Je tiefer die Sonne sank, desto verwunschener wurde der Weg. Golden leuchteten die Bäume, Licht rann an ihren borkigen Stämmen herab, Samenflocken und Sonnenstäubchen flirrten und tanzten, und hier und da im dunklen Unterholz entzündeten sich kleine Laternchen. Es schien Betrieb auf der Straße zu herrschen, obwohl er nichts ausmachen konnte als ein unbestimmtes Gewusel.
Indes sank die Sonne immer tiefer, und er brauchte einen Platz für die Nacht. Also setzte er seinen Fuß auf das Pflaster, drückte sich durch das Dickicht am Waldrand und richtete sich drinnen auf.
Es war still geworden.
Die Lichter, bis auf wenige einzelne, waren erloschen.
Er ging ein paar Schritte und stellte fest, dass die Straße sehr bequem war. Wenn er aufrecht ging, streiften seine Haare gerade die tiefsten Zweige. Zu beiden Seiten wuchsen die Bäume und das Strauchwerk so dicht, dass er kaum hätte ausbrechen können. Wer immer auf der Straße ging, konnte nichts als ihr folgen.
Er war ein Weilchen gegangen. Es war warm im Wald, die Luft roch nach Kraut und würzigem Laub, nach Honig und einer gewissen Schärfe, wie sie von kleinen Wesen kommt. Rings um ihn hob ein Flüstern und Summen an, manchmal vermeinte er im Dämmer winzige Augenpaare zu sehen, die ihn ehrfürchtig anstarrten. Schließlich blieb er stehen, stützte sich auf seinen Stab und rief mit gedämpfter Stimme:
„Hallo, ihr Gelichter! Was ist los mit euch? Warum versteckt ihr euch?“
„Hallo hallo hallo“, echote es von überall her.
„Ist denn abends kein Betrieb auf dieser wunderschönen Straße?“
„Hallo hallo hallo“, echote es wieder, und: „Betrieb Betrieb Betrieb“.
Er seufzte und setzte sich mit gekreuzten Beinen aufs Pflaster. Kurz war ihm unbehaglich, wie er so mitten auf der Straße saß, von jedem und allem gesehen, und wenn jetzt von fern eine Horde wilder Stiere herangerast käme, hätte er keine Chance zu entkommen.
„Hört mal, Gelichter! Ich werde euch nichts tun. Ich bin harmlos. Ich habe eure wunderschöne Straße gefunden und beschlossen, ihr einige Zeit zu folgen. Ich werde euch nicht stören. Ihr könnt wieder hervorkommen und euren Verkehr aufnehmen oder was ihr sonst des Abends auf dieser Straße treibt.“
Schweigen. Flüstern, Blätterrascheln. Ein Trippeln im Laub.
Dann trat ein kleines Männchen auf den Bordstein, sprang herunter und stellte sich vor ihn hin.
Es trug Blätter und Farnkraut als Kleidung und einen Blütenkelch als Hut. Es hatte menschliche Gestalt, aber einen nackten Schwanz und Nagezähne.
Es zitterte, sagte aber tapfer:
„Sieh an, ein Menschling!“
„Sieh an, ein Gelichter!“
„Es ist sehr selten, dass Menschlinge die große Straße finden. Du musst hochempfindsam sein und empfänglich für die feineren Sichtbarkeiten, vielleicht sogar für die Unsichtbarkeiten. Sonst wärst du nicht hier. Wer bist du?“
„Ich bin ich“, antwortete er und zuckte die Schultern. Dann fiel ihm etwas ein, er kramte in den Taschen seiner Hose und förderte einen zerdrückten Zettel zutage, den er auseinanderfaltete. Dort stand:
Du heißt Peregrin.PS: Mach dir keine Gedanken!
Er staunte. Er hatte keine Ahnung, wer ihm diesen Zettel geschrieben hatte, aber er freute sich darüber, dass es jemand war, der ihn offensichtlich kannte. Er fand, dass er dem Zettel ruhig glauben konnte, zumal der Schreiber seine desolate Erinnerungslage einzuschätzen wusste und ihm vorsorglich einen Rat gab. Dieses Ich, das ihn hier mit „du“ anredete, schien viel zu wissen. Es klang vertrauenswürdig, und die Schrift war angenehm und strahlte Zuverlässigkeit aus. Er beschloss also, dem Zettel zu vertrauen. Kurz kam ihm auch – trotz des Ratschlags – der Gedanke, dass er selbst sich diese Botschaft geschrieben haben könnte, aber er hatte keine Lust, das bis zum Ende durchzudenken.
„So wie es aussieht, heiße ich Peregrin“, sagte er also.
„So wie es aussieht, ist die Sache mit deinem Namen nicht sicher, Peregrin“, sagte das kleine Wesen, das mittlerweile sein Selbstvertrauen wiedergewonnen hatte. Hinter ihm wurden dichtgedrängt Augenpaare sichtbar, und ein paar Gesichtchen drängten sich ins goldene Licht, das über der Straße lag.
Es waren schon seltsame Geschöpfe, die hier wohnten.
„Ich will euch nicht stören“, beteuerte Peregrin. „Ich will nur dieser Straße nachziehen, um zu sehen, wohin sie führt.“
„Oho“, sagte das Wesen, „du willst die Große Straße gehen? Das ist ein mutiger Schritt. Du musst wissen, es handelt sich um die Große Straße, um unsere Straße, die Straße des Waldgelichters, die größte, die es gibt.“
„Nun, schön…“
„Wir sind auf ihr unterwegs von Ort zu Ort, verkehren auf ihr hin und her, machen Besuche, schauen auf sie hinaus sonntagnachmittags beim Kaffee und warten auf das, was entlangkommt. Und manchmal, an Tagen wie diesen, wo etwas Erstaunliches geschieht, äugen wir vorsichtig in die Ferne und versuchen herauszufinden, was sich uns nähert.“
„Ich bin gespannt“, sagte er und wusste nicht so recht, was der Zweck dieser Unterhaltung war. Brauchte er eine Erlaubnis? Einen Passierschein? Wollte der Wicht ihn vor Gefahren warnen?
„Du bist sehr empfänglich für die Unsichtbarkeiten, das spüre ich. Du fühlst die Kräfte und Regungen in der Welt wie ein Kind den Herzschlag der Mutter. Das ist sonderbar, wahrhaftig…“
Eigentlich hatte er keine Lust, sich irgendwelche Fremdbeurteilungen zu seiner Person anzuhören oder sich irgendetwas orakeln zu lassen. Davon, hatte er früh beschlossen – frühestens heute Morgen –, wollte er nichts halten.
Aber es hatte mit dem, was der Wicht sagte, schon seine Richtigkeit. Er spürte die unsichtbaren Fäden der Welt, wie sie sich hin und herspannen, wie sie alles durchwirkten, in allen Dingen waren, wie sich Kraft und Gegenkraft, Wirkungen, Geschehnisse und Gedanken hin und her tauschten – er spürte das feine Gewebe der Wirklichkeit, das ihn umgab. Es war, als hätte er eine Witterung für den Geruch von Gefahr, von Wunder, von Glück und von Gelingen. Immer wenn er an Wegscheiden zu wählen hatte, eine Wiese überquerte, einen Wald durchdringen wollte, von einem Hügel übers Land blickte, erwog ein anderer Sinn in ihm als der übliche tausend Dinge, die niemand sah und merkte, die ihm aber die Richtung wiesen, die er zu gehen hatte.
Seltsam genug, dass das kleine Wesen das erahnte.
„Weißt du“, sagte er, „ – wie heißt du übrigens?“
„Ich bin der Abrogans“, sagte der Kleine. „Man hat mich abgeordnet. Ich kenne die Regeln und Vorschriften. Ich wache über den Verkehr auf der Großen Straße.“
„Weißt du also, Abrogans“, fuhr Peregrin fort, „ich bin froh, eure Straße gefunden zu haben. Es ist doch mühsam, in freier Flur alle Nase lang entscheiden zu müssen, welchen Weg ich einschlage. So eine Straße, die hat einen Zweck und führt zu Orten, sonst wäre sie ja nicht gebaut, und das scheint mir doch komfortabler zu sein als Acker, Wiese und Wald.“
„Oho“, sagte das Männchen wieder. „Du wählst also die Straße der Träumer wegen deiner Bequemlichkeit? Das habe ich noch nie gehört.“
„Die Straße der Träumer?“
„Was ich sage! Nur der findet sie, der die Seele eines Träumers hat. Wahrträume, Fernträume, Tagträume, Visionen, Prophezeiungen, lauter so Zeug. Du bist hoch empfindsam und –“
„Das sagtest du bereits.“
„Jedenfalls findet nur ein Träumer die Straße der Träumer. Und natürlich muss er ihr folgen.“
„Aber wohin führt diese Straße?“
„Was du hier vor dir siehst, ist nur das, was von ihr sichtbar ist. Ihre Spur durchzieht die Erde wie eine Silberader im Gestein, wie ein Pilzfaden den Waldboden. Dieser Spur wirst du folgen können, auch ohne Pflaster und Bankette, wenn du gelernt hast, auf der Straße der Träumer zu gehen.“
Er nickte beeindruckt. Das klang interessant.
„Ich fürchte nur, morgen früh habe ich alles wieder vergessen. Ich leide nämlich“, sagte er bekümmert und griff sich an den Kopf, „unter… äh… gewissen Konstanzdefiziten, wenn du verstehst, was ich meine.“
„Das geht mich nichts an“, sagte Abrogans und wandte sich ab. „Auf der Straße der Träumer wirst du bald wissen, wo du bist, und falls du es nicht behalten kannst, gibt es immer wieder Leute, die es dir in Erinnerung rufen. Wir sind ja keine Unmenschlinge.“
Er kletterte den Bordstein hinauf, verbeugte sich noch einmal, ringsum ertönte wie ein Regenschauer das Applaudieren winziger Pfotenpaare, und dann war er verschwunden.
Indes belebte sich die Straße wieder, das Gewusel kehrte zurück, er sah wunderliche Geschöpfe aus dem Dickicht treten und ihren Angelegenheiten nachgehen, und da ihn niemand weiter beachtete, beschloss auch er, seinen Weg fortzusetzen.
Er ging noch bis in die blaue Dunkelheit hinein, die auf der Straße der Träumer von tausenden winziger Lichter erhellt war. Er war guter Hoffnung, einen anständigen Übernachtungsplatz zu finden.
Drittes Kapitel:Zurück zu den Quellen!
Gevatter strich sich über seinen Bart. Was seine Freunde Bär und Jungspund ihm hier vorschlugen, war doch sehr erstaunlich. Er nahm einen Zug aus seiner Pfeife, der Tabak aus Himbeerblättern roch süß und grün, und brummelte: hm hm hm.
Eigentlich hatten sie Karten spielen und den langen Sommerabend in vergnügter Gemeinschaft verbringen wollen. Nun fing Bär mitten im schönsten Null-Offen mit diesem Abend an, an dem sie über die Sage vom Tempel des Königs gesprochen hatten.
„Und vom Uhrenbaum“, warf Gevatter ein.
„Ja, aber der tut nichts zur Sache. In Wahrheit ist es so, dass mir die Geschichte vom Tempel nicht mehr aus dem Kopf geht.“
Bär rieb sein stoppeliges Kinn – alles an ihm war stoppelig und pelzig – und schaute Jungspund hilfesuchend an.
„Wir haben uns gedacht, es könnte doch sinnvoll sein, sich einmal mit der Zeit zu beschäftigen, in der der König herrschte“, sprang Jungspund ein.
„Das ist eine Sage“, entgegnete Gevatter missmutig, „eine Urzeit, von der wir nichts wissen.“
„Aber das ist es ja gerade“, sagte Bär. „Niemand weiß etwas darüber. Alle erzählen nur die Sagen. Aber irgendwo müssen die Sagen ja herkommen, ich meine, es muss doch Schriften geben, Urkunden, die darüber Auskunft geben.“
„Es gibt nur Abschriften, und die sind den Adepten längst bekannt“, sagte Gevatter und sog an seiner Pfeife. Zu allem Ärger war sie ausgegangen.
„Mitnichten“, meldete sich Jungspund wieder zu Wort. „Ich habe gehört, dass es durchaus Quellen aus jener Zeit geben könnte, alte Berichte…“
„Quellen?“, fragte der kleine Troll dazwischen. „Gehen wir auf Wassersuche?“
„Das sagt man so“, meinte Bär.
„Was genau meinst du?“, fragte Gevatter scharf.
„Ich habe von drei Büchern gehört, die –“
„Das ist bloß eine Sage, nein: ein Märchen. Keiner hat die Drei Bücher je gesehen.“
„Hat sie je einer gesucht?“
„Das zwar nicht. Aber ich verstehe nicht, wieso ausgerechnet du, Jungspund“, sagte Gevatter, „dich für so altes Zeug interessierst, da du doch vom König gar nichts hältst!“
„Das ist nicht wahr! Ich sage nur, dass man die Sagen nicht wörtlich nehmen darf. Dass wir es sind, die das Heft in die Hand nehmen müssen. Und das ist noch immer meine Meinung. Gerade deshalb will ich ja herausfinden, wie diese Urzeit wirklich aussah. Und wie und warum sie endete.“
„Der König wurde vertrieben, der Tempel ging verloren, der Sommer stand still. Seither haben wir das Jahr des Fuchses. Das ist alles.“
„Woher willst du das wissen?“
Gevatter dachte nach.
„Hm“, sagte er, „ich gebe zu, ich kenne dazu nur die alten Sagen. Aber es ist doch das, was alle wissen. Wieso soll es falsch sein?“
„Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich meine nur, es gibt einige unbeantwortete Fragen. Wer genau hat den König vertrieben? Wieso hat er sich überhaupt vertreiben lassen? Wie hat die Regentschaft des Königs genau ausgesehen? Welche Bedingungen haben geherrscht? Versteh mich nicht falsch: Ich glaube nicht, dass es dieses Goldene Zeitalter je gegeben hat. Aber Menschen erdenken sich es als ihre Hoffnung. Es ist eine Utopie, versteht du? Darauf, was Menschen seit Urzeiten erhoffen, können wir heute aufbauen, um eine neue Welt zu schaffen.“
„Das sind nicht meine Gründe, Gevatter“, sagte Bär. „Aber ich möchte auch mehr über die Zeit des Königs erfahren. Und ich möchte wissen, was es mit der Sage vom Tempel auf sich hat. Ob es tatsächlich eine Prophezeiung sein kann oder nicht.“ Er brummte verlegen.
„Aber wenn sich irgendwo solche alte Schriften finden lassen, dann im Zentralarchiv des Adeptenhofes in Darkheim“, sagte Bär bestimmt und schlug mit der Hand auf den Tisch. Der Troll fuhr zusammen. Die Karten flogen durcheinander, und obenauf blieb die Karte des Bibliothekars liegen, die Zehn der Weinblätter.
Gevatter sah es und rang mit sich. Er achtete auf Zeichen, aber auch auf das, was ihm seine Vernunft gebot. Und seine Vernunft gebot ihm, die Finger von waghalsigen Unternehmen und Reisen mit unsicherem Ausgang zu lassen.
„Was soll schon passieren?“, sagte Jungspund obenhin.
„Auf dem Weg lauern tausend Gefahren“, sagte der Troll mit zitternder Stimme.
„Im Jahr des Fuchses? Wohl kaum“, dröhnte Bär.
„Aber dort draußen gibt es Drachen und Räuberbanden und Unholde und Trolle – verzeiht, ich meine meine grobschlächtigen Verwandten – und Zauberer und Faune und Elfen…“
„Die sind allerdings eine Gefahr – für jeden Mann, der seine Eier am richtigen Platz hat“, lachte Bär und schlug mit der Hand auf den Tisch. Der Troll fuhr zusammen.
„Aber was so eine Reise kostet!“, sagte Gevatter.
„Wir können ja unterwegs ein paar Rätsel lösen, Schätze finden und Jungfrauen befreien – nur um unsere Investitionen zu amortisieren.“
„Was bitte?“, fragte der Troll.
„Seit Jungspund bei den Roten in der Stadt verkehrt, kommt seine Sprache auf Stelzen daher“, meinte Gevatter zu Bär.
„Was verschlägt’s! Kommst du mit, Gevatter? Wir brauchen deine Erfahrung und deine Autorität, damit man uns im Adeptenhof überhaupt anhört.“ Bär schaute ihn herausfordernd an.
Schließlich ließ er sich breitschlagen. Er hatte weiter seine Einwände, aber vernünftige Einwände allein sind noch kein Grund, eine Sache nicht zu wagen. Er gab zu bedenken, dass die Reise Vorbereitungen nötig machte, dass sie Proviant und einen Wagen bräuchten, wenn sie nicht Wochen unterwegs sein wollten. Der kleine Troll war begeistert, wenn er auch sich vor dem Unbekannten fürchtete.
Bär schlug wieder auf den Tisch und rief: „Endlich werden Taten getan!“
„Und nicht nur Worte gewortet“, grinste Jungspund.
„Können wir dann weiter Karten spielen?“, fragte Gevatter und räumte das verstreute Blatt zusammen.
„Nein, denn es ist noch viel zu tun“, sagte Jungspund entschlossen. „In drei Tagen wollen wir aufbrechen. Jeder geht jetzt nach Hause und besorgt seine Angelegenheiten. Gevatter sorgt für den Wagen, Bär für Reiseproviant, ich erkundige mich nach dem Weg, den wir nehmen, und Troll – ja, was machst du?“
„Ich verkrieche mich im Bett und träume uns was Schönes.“ Er strahlte.
„Tu das“, sagte Gevatter großzügig. „Das können wir alle gebrauchen.“
„Mume“, sagte Mayfair zu der rundlichen Dame, die im blauen Leinenkleid neben ihr auf der Kaimauer stand, „Mume, für wen träumt man eigentlich?“
„Mein kleiner Schatz, für die anderen Menschen natürlich. Man träumt, damit es ihnen wohl ergeht oder dass ihnen ein Vorhaben gelingt.“
Mayfair mochte die Stimme ihrer Mume. Sie klang melodisch wie ihr Glockenspiel, auf dem sie das Lied jetzt schon spielen konnte, und hatte etwas, was ihr Zutrauen und Geborgenheit gab. Sie sang das Lied ständig vor sich hin, summte es selbstvergessen, wenn sie allein war oder an der Hand der Mume ging. Die hatte es ihr beigebracht, hatte es ihr vorgesungen, und es war das Schönste, was sie je gehört hatte.
Das grüne Wasser schlug an die tangbewachsene Kaimauer und goldene Kringel tanzten in der Tiefe. Hier konnte sie stundenlang sitzen und über den See schauen, über den glatten Spiegel, der das Bild der Hänge zurückwarf, bis hinüber zum anderen Ende, das man im Dunst nicht sehen konnte. Der Wind fiel von den Bergen auf den See hinab, jagte Glanzschauer über die Fläche und ließ die Mimosen und Platanen an den Ufern flüstern.
„Ich glaube“, sagte Mayfair versonnen, „ich träume für mich selbst.“
„Das ist aber nicht fein“, sagte die Mume, die nicht richtig zuhörte.
„Ich kann nichts dafür. Vielleicht träume ich auch für die ganze Welt. Stell dir das vor!“
„Ja ja, Träumen ist eine gute Sache.“
Mayfair mochte ihre Träume. Sie waren wunderschön, und sie spürte, dass sie ihr Glück bringen würden. Sie ließen ein warmes Licht in ihrem Leben scheinen, nach dem sie sich sehnte. Der Tempel auf dem Berg, wo der Blick bis hinter den Horizont geht. Der Prinz aus dem Sonnenaufgang. Die Lösung aller Rätsel, die Sprengung aller Bande, die Antwort auf alle Fragen.
Sie war zwar erst ein Kind und verstand kaum, was sie da ersehnte oder glaubte; aber sie war bis ins Tiefste davon ergriffen.
„Siehst du“, sagte die Mume und zeigte mit der Hand auf die Südhänge des Sees. „Dort wächst der Wein deines Vaters. Das Gäu ist berühmt für diesen Wein. Dein Vater sorgt eigenhändig dafür, dass er wächst und richtig gepflückt und ausgebaut wird.“
„Federweiß, nicht wahr?“
„Du bist klug, mein Schatz. Dein Vater, der gnädige Herr, schätzt sich manchen vollen Fasses eines guten Jahrgangs in seinem Keller glücklich.“
Wenn die Mume so vornehm redete, hörte Mayfair weg. Sie dachte stattdessen an den Federweiß; sie mochte den Wein sehr, er war süß und leicht und stieg ihr ein wenig zu Kopf, so als ob ihre Gedanken auf Schmetterlingen säßen und durch die Luft flatterten. Mutter war dagegen, aber Vater ließ sie immer einen Schluck kosten.
Wolken zogen über den Uferhängen herauf, sie wanderten über den See und tauchten kurzzeitig das Schloss und den Hafen in kühlen Schatten. Die aufragenden Zypressen wirkten nun wie schwarze Monolithen, die streng ihr Zuhause bewachten.
Am anderen Ende des Sees lag die Stadt. Man fuhr einen halben Tag, Mayfair war einmal mitgefahren mit dem Vater, der dort Verhandlungen zu führen hatte.
„Dort draußen kommt ein Schiff“, sagte Mayfair.
Die Mume strengte ihre Augen an und meinte: „Du hast recht.“
„Alles, was zu uns kommt, kommt über den See, nicht wahr?“
„Alles kommt über den See, mein Schatz. Die ganze Welt, das ganze Jahr des Fuchses kommt über den See.“
Schon manches Mal hatte Mayfair am Hafen die Schiffe angeschaut, Schiffe, die Hölzer und Stoffe und Gewürze brachten, aber auch Menschen. Im Hafen wurde die Ladung gelöscht, lange Kranarme ragten in den Himmel, Taue spannten sich, es roch nach Fisch und Teer und dem Holz der Schiffe.
„Über den See kommt mein Schicksal“, sagte sie plötzlich.
Das hätte die Mume aufhorchen lassen, hätte sie zugehört. Aber sie war ganz eingenommen vom Anblick des Schiffes, das sich näherte. Die Segel waren gerefft, nur das Vorsegel bauschte sich und grüßte als zinnoberroter Fleck herüber.
„Muss ich einmal von hier weg, Mume?“, fragte sie und wurde auf einmal traurig. Tränen stiegen ihr in die Augen, sie schluckte schwer.
„Von hier weg? Aber Schätzchen, das hat noch Zeit.“
„Warum muss ich von hier weg?“
„Weißt du, du bist die Tochter eines Aldermanns. Du musst lernen, dich zu benehmen und zu reden und dich anzuziehen, wie es einer Aldertochter gebührt.“
„Das lehrt mich die alte Gouvernante!“
„Das lehrt dich das Frollein, ganz recht. Aber später, wenn du größer wirst, musst du auf eine besondere Schule gehen, wo lauter solche Töchter sind wie du. Da kannst du viel mehr und besser lernen. Verstehst du?“
„Und sucht Papa für mich dann einen Bräutigam?“
Die Mume musste lachen. „Ja, das tut er. Aber das ist noch lange hin.“
„Warum muss ich überhaupt heiraten?“
„Weißt du, die Aldermänner im Jahr des Fuchses wohnen alle ganz weit voneinander, und jeder hat ein Schloss oder eine Burg und viel Land drumherum. Die Aldermänner müssen zusammenhalten, weil ja der König nicht mehr da ist, um das Land zu regieren. Und damit sie das können, heiraten ihre Söhne und Töchter untereinander, sodass alle Aldermänner dann zur gleichen Familie gehören.“
„Ist es das, was Papa immer die Häuser nennt?“
„Ich bewundere deine Klugheit, mein Schatz! Ja, ein Haus ist eine Familie des Adels, und je enger die Häuser miteinander verbunden sind, desto kleiner ist die Gefahr, dass sie sich streiten und es Krieg gibt.“
„Was ist Krieg, Mume?“
„Etwas ganz Schlimmes, wo Dörfer verbrennen und Menschen totgehauen werden. Aber hab keine Angst, das hat es seit sehr langer Zeit nicht mehr gegeben.“
Mayfair ließ sich das Gehörte durch den Kopf gehen. Sie musste also ihr Zuhause verlassen, damit es keinen Krieg gab. Nun, das schien ein guter Zweck zu sein. Aber insgeheim fühlte sie, dass alle diese Gründe – Erziehung, Heirat, Krieg – nicht ausreichten, um sie von hier fortzubringen. Nein, aus einem viel tieferen Grund würde sie eines Tages von hier weggehen.
Sie spürte eine Sehnsucht in sich, die nichts mit irgendetwas zu tun hatte, was es im Jahr des Fuchses gab. Ihre Sehnsucht richtete sich auf das, was sie in ihren Träumen sah, auf die Sage vom Tempel des Königs. Dieser Traum kam nicht aus dem Jahr des Fuchses. Er kam aus einer fernen Zeit, als der König noch da gewesen war, aus einer anderen Welt, die schöner gewesen war als alles, was man sich im Jahr des Fuchses vorstellen konnte. Vielleicht kam er vom König selbst, der nicht tot oder verloren gegangen war, sondern der irgendwo im Verborgenen saß, jenseits der Welt, und alles sah, was sich hier zutrug.
Sie wünschte sich im tiefsten Inneren kein Leben als vornehme Dame, keinen Bräutigam und kein sorglose Bequemlichkeit. Das alles kannte sie, und es war ihr nicht wichtig. Wonach sie sich sehnte, das hätte sie nicht in Worte fassen können. Sie wusste nichts von der Metafüsischen Lücke, von der die Adepten sprachen, aber sie spürte, dass die Welt nicht vollständig war. Nur der König hatte sie vollständig gemacht, vor tausend Sommern, und nur die Heimkehr des Prinzen würde sie wieder ganz und heil machen.
Anfangs hatte sie Mama viel davon erzählt, aber im Grunde verstand ihre Mutter sie nicht. Papa hörte ihr lächelnd zu, doch vergötterte er seine Tochter viel zu sehr, als dass er sie ernst genommen hätte. Mit den Jahren hatte sie aufgehört, von ihren Träumen zu erzählen. Nur ihrer Mume vertraute sie sich an und war mit ihr einig, dass das Lied ihre geheime Hymne war.
„Ja“, sagte sie leise, und Tränen stiegen ihr in die Augen, „ich werde eines Tages von hier fortgehen müssen.“
„Wir alle müssen eines Tages gehen“, sagte die Mume zerstreut. Das Schiff war näher gekommen, man sah die beiden Masten und das feine Spinnennetz der Takelage.
Mayfair würde sich eines Tages entscheiden müssen. Zwischen dem geplanten, geordneten Verlauf ihres Lebens und ihrer Sehnsucht. Sie konnte diesen Tag schon sehen, verschwommen und im Nebel der Möglichkeiten. Sie fühlte das Leid, den Verlust, den Abschied, sie fühlte die Einsamkeit, die das bedeuten würde, aber auch die tiefe Freude und Gewissheit, den richtigen Weg einzuschlagen. In Zeiten kindlicher Unbeschwertheit vergaß sie es und lachte, spielte, fühlte sich geborgen und beschützt. Aber in manchen Augenblicken, wenn sie allein war, fiel ein Schatten auf ihre Seele.
Sie fühlte die Last dumpf auf ihrem Herzen. Sie seufzte tief.
„Was seufzt du denn, mein Goldstück? Ist dir zu heiß? Hast du Durst?“
„Ich bin schon ein armes, seltsames Mädchen“, sagte sie traurig.
Die Mume brach in ein schallendes Gelächter aus. „Du bist ein altkluges, selbstmitleidiges Gör, und gewitzt dazu“, lachte sie und Mayfair musste, obwohl ihr noch die Tränen in den Augenwinkeln saßen, mitlachen, ob sie wollte oder nicht.
„Siehst du, Mume“, lachte Mayfair, „das geht so hin und her bei mir. Mal bin ich traurig, und dann lache ich gleich wieder.“
„Du bist wie das Wetter über dem See“, sagte die Mume und knuffte sie herzlich. „Wir alle haben dich lieb.“
„Ich hab euch auch lieb“, sagte Mayfair.
Euch, dachte sie, – und den Prinzen.
Der Erzadept saß am großen Pult unten in den Kavernen der Bibliothek und las. Es war still hier unten, die Lampe warf einen flackernden Schein, nur ab und zu war das Rascheln des Pergaments beim Umblättern der Seiten zu hören.
Loyola, der Erzadept des Ordens in den Felsenklausen, hatte angewiesen, nicht gestört zu werden. Er las und las. Die Geschichte des Ordens, seit jener Zeit, als er gegründet worden war. Im Anfang seiner Studien an der Akademie in Hohenlohe hatte er wie jeder Student diese Geschichte gelernt. Das war dreißig Sommer her und länger. Zeit, die Kenntnisse noch einmal aufzufrischen.