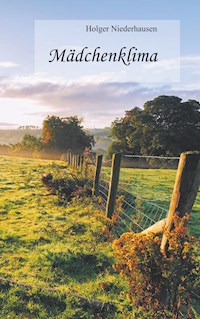Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Joachim Bauer ist Mitte vierzig, als er aus einem trostlosen Leben als Buchhalter und Familienvater langsam aufwacht. Seine Ehe ist am Ende, eigentlich schon seit Jahren. Seine erste freie Handlung ist das Nachdenken auf einer Parkbank. Als er sich in eine junge Studentin verliebt und sie kennenlernen darf, steht er vor entscheidenden Fragen nach der Zulässigkeit, Qualität und Zukunft seiner Liebe und Empfindungen ihr gegenüber. Immer mehr bilden diese Fragen und aufsteigende spirituelle Fragen eine unauflösliche Einheit, und immer mehr sieht er sich vor einen inneren Kampf gestellt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Menschenwesen hat eine tiefe Sehnsucht nach dem Schönen, Wahren und Guten. Diese kann von vielem anderen verschüttet worden sein, aber sie ist da. Und seine andere Sehnsucht ist, auch die eigene Seele zu einer Trägerin dessen zu entwickeln, wonach sich das Menschenwesen so sehnt.
Diese zweifache Sehnsucht wollen meine Bücher berühren, wieder bewusst machen, und dazu beitragen, dass sie stark und lebendig werden kann. Was die Seele empfindet und wirklich erstrebt, das ist ihr Wesen. Der Mensch kann ihr Wesen in etwas unendlich Schönes verwandeln, wenn er beginnt, seiner tiefsten Sehnsucht wahrhaftig zu folgen…
Gott ist die Liebe;
und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott
und Gott in ihm.
1. Joh. 4, 16
Scheinbar plötzlich war die Veränderung eingetreten. Joachim Bauer, ein Mann von Mitte vierzig, hatte sich an einem Samstag im Mai auf eine Parkbank gesetzt, und schon dies war ein Teil der Veränderung gewesen.
Eigentlich war er auf dem Weg zum Markt gewesen. Jede zweite Woche war dies seine Aufgabe, der Wochenendeinkauf. Der Markt lag gleich hinter dem Park, von seinem Platz aus konnte man die ersten Stände bereits sehen.
Später würde er noch oft an diesen Tag zurückdenken und sich jedes Mal fragen, warum er sich auf die Bank gesetzt hatte. Es war etwas Merkwürdiges – jahrelang geht man eine bestimmte Strecke, ohne sich jemals auf diese Bank zu setzen… und plötzlich setzte man sich.
Bauer war tatsächlich kein Mann, der sich auf Parkbänke setzte. Nach seiner Ausbildung zum Buchhalter hatte er nun vierundzwanzig Jahre in diesem Beruf gearbeitet, bei drei verschiedenen Firmen, und er hatte jede seiner Pflichten ernst genommen. Das Sitzen auf Parkbänken gehörte nicht dazu. Also hatte er dies auch nie getan.
Aber dann, an diesem dritten Samstag im Mai, saß er auf einmal auf dieser Bank. Später, im Rückblick, kam ihm alles ein wenig wie ein Traum vor. Als er sich am Abend desselben Tages an diese Momente zurückerinnerte, meinte er, noch einmal genau jenes Gefühl zu spüren, das er hatte, als er vor der Bank stand und, wie von einer unbekannten Macht berührt, nicht weiterging, sondern sich hinsetzte. Es war ein Gefühl wie eine flüchtige Traurigkeit, flüchtig und doch uralt-schwer. Er hatte sich hingesetzt und im Sich-Setzen eine große Müdigkeit empfunden. Dann hatte er alles aus einer neuen Perspektive gesehen – aus der Perspektive einer Parkbank und aus der Perspektive dieser Müdigkeit, die sein Leben verändern sollte.
Gleichsam benommen von dem neuen Zustand, in dem er sich befand, blickte er auf die Welt, die ihn umgab, und nahm alles auf einmal seltsam unwirklich wahr. War es die Welt, die unwirklich wurde, oder war es sein eigenes Leben und er selbst, die unwirklich wurden?
Er erinnerte sich noch an das Lachen der beiden Mädchen, die an ihm vorbeigegangen waren, in ausgelassenem Gespräch. Dann war eine alte Frau gefolgt, einen Rollwagen vor sich her schiebend. Und dann noch viele andere Menschen. Er hatte all diese Menschen an sich vorübergehen sehen und ihnen ins Gesicht geblickt, als würde er dort etwas suchen. In Wirklichkeit jedoch war er dabei, sich darüber klarzuwerden, was er selbst hier eigentlich tat.
Er hatte nicht gewusst, wie lange er dort gesessen hatte. Erst als er vom Markt zurückgekehrt war, hatte er wieder auf die Uhr gesehen. Eine halbe Stunde etwa musste es gewesen sein. Diese halbe Stunde war es, die ihn eigentümlich sanft, aber unwiderruflich aus seinem bisherigen Leben und Sein hinauswarf. Denn genau dies geschah, als er die Menschen an sich vorübergehen sah. Er begann zum ersten Mal zu sehen – die Menschen, die Welt, den Gang der Welt, an ihm vorbei… Er saß da, und die Welt ging weiter, ohne ihn, der einfach da saß und all dies registrierte.
Die Mädchen – waren nicht Teil seines Lebens. Die alte Frau – auch nicht. Die anderen Menschen – auch nicht. Und er? Was war eigentlich sein Leben? Sein Leben lief an dem Leben all dieser Menschen ebenfalls vorbei. Unbeteiligt. Einfach so. Leben neben Leben, ohne Zusammenhang, ohne Begegnung, ohne Wichtigkeit.
Er erinnerte sich im Rückblick auch, wie er in diesem Moment einmal kurz gelächelt hatte – wie man lächelt in einem kurzen Bedauern über etwas, was so ist, wie es ist, ohne dass man es ändern kann. Die Menschen waren weiter an ihm vorbeigegangen, jeder für sich, manche zu zweit, manche auch zu dritt, zu viert, aber sie alle für sich, und er, er, ganz allein. Was machte es, wenn man die Marktfrauen oder auch -männer vom Sehen her kannte und grüßte? Sie waren fremd und blieben es. Und die Kollegen auf der Arbeit? Sie nicht ganz ebenso? Hier hatte er noch einmal gelächelt, wie um etwas zu verabschieden, das schon vor langer Zeit verloren gegangen war, dessen Verlust er aber erst jetzt bemerkte. Oder wie staunend darüber, dass Hülle um Hülle von seinem bisherigen Leben abfiel, während ein neues Leben hervortrat, das aber nichts anderes als das alte war, nur dass er jetzt bemerkte, wie es wirklich aussah.
Müde und doch auch seltsam leicht stand er schließlich wieder auf und dachte: ‚Alle Menschen gehen aneinander vorbei…’. Mit diesem Gedanken ging er zum Markt und tätigte die üblichen Wochenendeinkäufe. Mit diesem Gedanken kam er nach Hause. Mit diesem Gedanken lebte er die nächsten Wochen. Und inmitten dieses Gedankens erwachte leise eine Sehnsucht.
*
‚Wo warst du so lange?’, hatte seine Frau gefragt, als er zurückgekommen war. Er hatte genau gewusst, dass sie keine wirkliche Antwort erwartete – dass sie eigentlich nur ärgerlich war oder, vielmehr, eine Möglichkeit sah, wieder ärgerlich zu werden.
Einen Moment lang hatte er überlegt, ob er wahrheitsgemäß sagen sollte, dass er auf einer Parkbank gesessen habe, aber in demselben Moment hatte er gewusst, dass sie nichts begriffen hätte – und auch nichts hätte begreifen wollen. Daher schwieg er einfach nur, wie so oft.
Seine Frau hatte aber auch das nicht durchgehen lassen. Mit irgendeiner kränkenden Bemerkung hatte sie darauf hingewiesen, dass man doch unmöglich so lange zum Einkaufen brauchen könne – und schließlich hatte er doch erwidert, dass er sich auf eine Parkbank gesetzt hatte.
Auch diesen Blick seiner Frau, der daraufhin folgte, würde er nicht mehr vergessen. Ungläubig staunend war ihr die Sprache weggeblieben, und dann hatte sich dieses Schweigen in jenes hässliche Lästern verwandelt, das er so an ihr hasste. Ganz langsam hatte sich das ungläubige Staunen in jenes langgezogene, betonte ‚Du’ verwandelt, das dann folgte: ‚Du…? Du hast auf einer Parkbank gesessen?’ Und in ihrem abschätzigen Lächeln lagen die Worte: ‚Da lachen ja die Hühner!’ Dass sie sie nicht aussprach, machte es fast nur schlimmer.
Schweigend hatte er die Einkäufe ausgepackt und in den Kühlschrank geordnet, während er ihre Blicke in seinem Rücken spürte. Dann war er in sein Arbeitszimmer gegangen.
*
Nun saß er wiederum hier auf seinem Stuhl und hatte sich alles noch einmal in Erinnerung gerufen. Er wusste selbst nicht genau, warum er das getan hatte. War es, um sich selbst zu quälen? Aber irgendwie war er für diesen Tag gerade dankbar. Warum eigentlich? Dieses Rätsel begleitete ihn in der nächsten Zeit…
Joachim Bauer führte eine gewöhnliche Ehe. Seine Frau arbeitete als Verkäuferin in einer Konfektionsabteilung. Sie hatten zwei Kinder bekommen, ein Junge und ein Mädchen, die jetzt sechzehn und dreizehn Jahre alt waren. Über den Jungen hatte er längst jede Autorität verloren, auch von seiner Frau ließ dieser sich nicht mehr allzu viel sagen, und auch das Mädchen ging bereits immer mehr seine eigenen Wege.
Bis zu jenem Samstagvormittag, bis zu jenem Abschnitt seines Lebens, der mit dem Sich-Setzen auf die Parkbank begonnen hatte, hatte er gedacht, dass das alles so sein müsse – dass es normal sei. Auch jetzt noch glaubte er nicht, daran irgendetwas ändern zu können. Aber ob seine Ehe nun gewöhnlich war oder nicht, sein Leben war es ab diesem Moment nicht mehr.
Für Joachim Bauer hatte jener Prozess begonnen, der noch das scheinbar gewöhnlichste Leben zu etwas Einzigartigem machte. Dieser Prozess bestand in dem, was man Selbsterkenntnis nennen konnte. Joachim Bauer begann, sein eigenes Leben anzuschauen und sich auf eine Suche zu machen: die Suche nach dem, was eigentlich er selbst war – und was er sein wollte.
Diese Suche bestand zunächst aus einem unveränderten Durchlaufen der immer gleichen Stationen: Weg zur Arbeit, Erledigen der täglichen Aufgaben, Rückweg nach Hause, Ertragen der Bemerkungen seiner Frau und Hinnehmen dessen, was die ‚Kinder’ taten oder nicht taten, noch etwas Arbeit zuhause, dann einen Roman oder Krimi lesen, vielleicht fernsehen, schließlich schlafengehen.
Die meisten dieser Stationen seines Lebensalltages änderten sich nicht im Geringsten. Das, was sich änderte, war er. Und auch er änderte sich eigentlich zunächst nicht. Was sich änderte, war sein Erleben dieser ewig gleichen Stationen. Was sich änderte, war sein Leiden daran – dies war etwas wirklich Neues. Vielleicht noch nicht einmal das Leiden selbst, aber das immer mehr wachsende Bewusstsein von einem Leiden. Bewusstes Leiden – dies war das Neue.
*
Er und seine Frau Felicia hatten sich nicht mehr viel zu sagen. Meistens war sie es, die sprach. Sie kommentierte sogar das, was sie im Fernsehen sah. Als wieder einmal eine Talkshow lief und einer der Gäste, ein noch relativ junger Mann, eine bestimmte Position vertrat, sagte sie in ihrer üblichen Weise:
„Können die nicht endlich mal aufhören, Linke einzuladen!?“ Er selbst hatte für linke Positionen auch nicht viel übrig, aber diesmal störte ihn ihre Bemerkung noch mehr als sonst. So erwiderte er:
„Wenn es keine gegensätzlichen Positionen gibt, kann man keine Talkshow machen.“
Ohne die Augen vom Apparat zu wenden, sagte Felicia:
„Die können meinetwegen die gegensätzlichsten Positionen nehmen, nur eben keine linken!“
Einmal mehr ergab er sich ihrer ureigenen Logik, die er nicht verstand, und schwieg.
Als die Talkshow vorbei war und die Werbung lief, sagte Felicia, ohne ihn anzusehen:
„Das Rohr unter dem Waschbecken tropft. Rufst du die Verwaltung an?“
Fragen dieser Art waren bei ihr keine Fragen, sondern Aufforderungen.
Auch das Leiden daran war ihm nun bewusst. Er konnte auf einmal keine Antwort über die Lippen bringen.
„Joachim?“
Nun schaute sie ihn an. Sein Name, mit diesem bestimmten Nachdruck gesprochen, nur dieses eine Wort – auch das war etwas, woran er schon so lange gelitten hatte. Nun wurde ihm auch dies voll bewusst. ‚Joachim?’ Es war immer wie das Unterstreichen dessen, was sie zuvor jeweils gesagt hatte. Ganz klar wurde ihm dies erst, als er an diesem Abend noch einmal darüber nachdachte. Sein Name wurde tatsächlich einfach als bloße Unterstreichung benutzt. Noch einmal verbesserte er sich und fasste den Mut, zu denken: missbraucht. In dem Moment auf der Wohnzimmer-Couch sagte er jedoch nur:
„Ja.“
Er würde die Verwaltung anrufen, wie er es immer tat. Sie sagte, was zu tun war – und er tat es.
*
Er begann, sich auf die Wochenendeinkäufe zu freuen. Er übernahm sie sogar freiwillig jede Woche. Immer bevor er dann auf den Markt ging, setzte er sich auf jene Parkbank. Am frühen Vormittag war sie meist noch ganz unbesetzt, und selbst wenn schon jemand da saß, war sie groß genug für zwei Menschen und genügend Abstand.
Dies wurde für ihn der schönste Moment der ganzen Woche. Und schnell begriff er auch, warum dies so war. Hier auf dieser Parkbank war er eigentlich das einzige Mal wirklich allein, wirklich für sich allein.
Hatte er hier nicht gerade zum ersten Mal erlebt, dass die Menschen immer allein waren? Doch es war ein Unterschied, ob man allein war und es doch nicht sein durfte, sondern sich mit einem ganzen Leben herumtrug, das letztlich von Anderen bestimmt wurde – oder ob man für einen Moment wirklich allein sein durfte, einfach nur ganz allein. Selbst zuhause in seinem Arbeitszimmer war er nicht allein – er war umgeben von einer Wohnung, in der er nicht allein war, von einem Leben, in dem er nie allein war. Hier draußen war er umgeben von Menschen – aber von Menschen, die ihn allein ließen, die nichts von ihm wollten, nichts von ihm forderten, nichts von ihm dachten. Diese Menschen, die hier an ihm vorbeigingen, ließen ihn frei und so, wie er war. Dieses Erleben begann er immer mehr zu suchen, Woche für Woche… Eine Suche nach Momenten der Freiheit, der Ruhe. Er war so müde…
*
Es dauerte einen ganzen Monat, bis er sich einen neuen Schritt eroberte: Er ging nach Feierabend noch einmal spazieren.
Als er diesen Schritt geschafft hatte, fragte er sich, warum er dies nicht schon früher gewagt hatte.
Aber er konnte sich auch die Antwort geben. Er tat es auf derselben Bank, zu der er auch diesmal seine Schritte gelenkt hatte. Die Sonne schien noch warm in seine Augenwinkel. Wann hatte er zuletzt bemerkt, wie gut das tat? Mit einem freudigen Erstaunen bemerkte er auch, dass dieselbe Sonne, die ihn am Vormittag von links begrüßte, nun ihren Tagesgang beendete, ihn aber immer noch von der anderen Seite wärmte.
Warum er dies nicht schon früher gewagt hatte, darauf gab es zwei Antworten, die sich zu einer einzigen verbanden. Das eine waren die gehässigen Bemerkungen seiner Frau, die ihn auch dann noch verfolgten, als er die Tür hinter sich zugezogen hatte. Er hörte noch immer jedes Wort.
‚Ich gehe noch einmal spazieren.’
‚Was tust du?’
‚Ich gehe noch einmal spazieren.’
‚Was ist das jetzt? Du sagst das, als ob du das jeden Abend tust!’
‚Nein, ich tue es jetzt zum ersten Mal.’
‚Was sind das für neue Moden? Na ja, du wirst schon einen Grund dafür haben.’
Sie hatte es wieder auf ihre abschätzige Weise gesagt. Unschlüssig war er noch stehengeblieben, als würde er glauben, dass sie noch etwas anderes sagen würde, etwas Netteres.
‚Geh ruhig’, hatte sie daraufhin gesagt. ‚Meine Erlaubnis hast du – falls du die brauchen solltest.’
Wortlos war er daraufhin gegangen. Er hätte es wissen müssen…
Diese Bemerkungen waren das Eine, was ihn bis dahin gehindert hatte. Als sie dann aber einmal gefallen waren, merkte er, wie sie ihn nicht wirklich trafen. Er hatte gemeint, er würde sich eines solchen albernen Spazierganges daraufhin sehr schämen – in Wirklichkeit war es nun umgekehrt: Im Innersten schämte er sich dafür, so etwas nicht viel eher getan zu haben.
Dafür hatte es jedoch noch ein zweites Hindernis gegeben. Er hatte bisher nie etwas getan, was scheinbar sinnlos war. Spaziergänge, einfach auf einer Bank sitzen, am Vormittag oder am Abend, das war für ihn bisher nicht einmal im Bereich des Vorstellbaren gewesen. Er hatte es buchstäblich als sinnlos angesehen, als Zeitverschwendung. Bis vor wenigen Wochen hätte er dabei unabweislich das Gefühl gehabt, irgendeine Pflicht zu versäumen, sich irgendeiner unverzeihlichen Faulenzerei schuldig zu machen.
Die spitzen Bemerkungen seiner Frau schlugen also in die gleiche Kerbe, die ihn selbst bisher daran gehindert hatte. Und doch hatten sie ihm diesmal sogar geholfen, sein Vorhaben wahrzumachen. Er hatte gedacht, dass sie seine Scham über sich selbst verdoppeln würden – und war überrascht, als sich stattdessen seine Gleichgültigkeit gegenüber den immer gleichen Bemerkungen verdoppelte und sein Mut sich so sogar vergrößerte…
Und dann hatte er allein seinen ersten wirklichen Spaziergang seit vielleicht Jahrzehnten gemacht, und dieser hatte ihn wiederum bis zu ‚seiner’ Bank geführt.
Hier saß er nun also und genoss die Abendstimmung. Er fühlte das Belebende, das von diesem Spaziergang ausging, und wusste nicht, woher dies kam. Konnte es sein, dass ein einfacher Spaziergang nochmals so viel wohler tat als derselbe Gang, wenn er vor dem Markteinkauf lag? Es war, wie wenn für Momente eine unerträgliche Last von einem genommen wurde und man frei atmen konnte – freier, als man es je zuvor gekannt hatte.
Dieses Gefühl verwirrte ihn, zumal jene innere Müdigkeit, die er nun so stark kennenlernte, auch nicht wich, vielleicht sogar ebenfalls noch stärker erlebbar wurde. Woher kam dann dieses belebende, freie Gefühl?
Nur ganz langsam realisierte er, dass es mit der Tatsache zu tun haben musste, dass niemand ihm diesen Spaziergang vorgeschrieben hatte und dass auch niemand ihn daran hatte hindern können; dass es sein ganz eigener Entschluss und seine ganz eigene Durchführung gewesen war. Es musste daran liegen – und doch stand er fast ungläubig vor dieser Tatsache…
Er schloss die Augen und sog die abendliche Frühsommerluft einmal tief durch die Nase ein. Dann öffnete er die Augen wieder und fühlte von neuem ein ungekanntes Glück. Was tat er nun nicht alles zum ersten Mal!
Und tatsächlich, der Sommer hatte gerade begonnen. Wie schön war es, die laue Luft zu genießen – einfach nur hier zu sitzen und die warme Luft auf dem Gesicht zu spüren, zu riechen. Ein wenig die Menschen zu beobachten, wie sie vorübergingen, und einfach nichts weiter zu tun – nur dazusitzen und zu schauen…
Doch wenn er dann wieder an die Rückkehr dachte, stieg unmittelbar wieder die ganze Müdigkeit auf. Es war, wie wenn eine innerliche Dämmerung alle Sonnenwärme verschluckte, obwohl draußen die Sonne noch immer schien.
Gedankenverloren schaute er noch immer auf die vorbeigehenden Menschen, gerade lief ein junges Paar mit einem Kinderwagen vorbei, neben dem ein etwa fünfjähriger Junge an der Hand der Mama ging… Noch etwa fünf Minuten hielt er so aus. Dann erhob er sich seufzend und machte sich auf den Rückweg. Obwohl zuhause wirklich nichts auf ihn wartete, sorgte eine alte Gewohnheit dafür, dass er das stille Glück der abendlichen Bank nicht mehr weiter ausdehnen konnte. Das Leben der Pflicht rief, gleichsam aus Prinzip.
*
Als er wieder nach Hause kam, hatte er dennoch die winzige Hoffnung, dass sein nicht allzu langes Ausbleiben vielleicht doch noch irgendeine Anerkennung finden würde. Stattdessen wurde er von einer neuen Spitze seiner Frau empfangen. Felicia sagte:
„Na, wie war dein Spaziergang?“
Er versuchte, den herabsetzenden Ton zu überhören, und erwiderte wahrheitsgemäß:
„Schön.“
„Und was soll das jetzt werden? Wird das gerade eine neue Gewohnheit, deren Entstehung wir beiwohnen dürfen – oder was ist das?“
Müde gewahrte Joachim Bauer, dass seine Frau auch jetzt keine Gelegenheit ausließ, ihn leise zu demütigen. Er wusste nicht, was er darauf antworten sollte, und so ließ er es einfach. Wortlos ging er in sein Arbeitszimmer.
Es war für ihn ein Glück, dass seine Frau nicht durchgehend so war. Es gab Tage, in denen die Begegnungen und die Mahlzeiten erträglich abliefen.
Dann schöpfte er immer wieder die Hoffnung, dass es doch wieder besser werden würde – und wurde dennoch stets von neuem enttäuscht, wenn die nächste Bemerkung seiner Frau kam, die ihn nicht einmal mehr wirklich verletzte, die aber seiner Müdigkeit ein neues Bleigewicht hinzufügte…
Sehr bald hatte er den täglichen Abendspaziergang wirklich zu einer neuen ‚Gewohnheit’ gemacht. Und doch wurde es für ihn niemals wirklich eine Gewohnheit, nach dem Abendessen noch einmal hinauszugehen; immer war es eine Art Geschenk, eine voll bewusst erlebte Befreiung, den Weg Richtung Park einzuschlagen und sich auf die Bank zu setzen, um hier für eine halbe Stunde oder länger zu verweilen. Sehr bald machte es ihm nichts mehr aus, die Zeit weiter auszudehnen. Er sehnte sich so sehr nach Ruhe – und hier, in diesen Momenten auf der Bank, da fand er die Ruhe, die er so sehr suchte.
Und doch machte er sich in diesen Stunden, die er hier zubrachte, immer wieder Gedanken über die Zukunft. Zwar hatte er hier die völlige Ruhe, um nachzudenken, aber seine Gedanken ließen ihm dann doch wiederum keine Ruhe. Er sah keine Möglichkeit, demjenigen zu entrinnen, was ihn so müde machte. Der Gedanke an Scheidung tauchte nur einmal fern am Horizont auf – und wurde sofort wieder beiseite geschoben. Man hatte doch trotz allem Verantwortung…
*
Nach und nach hörten die Bemerkungen seiner Frau über die Abendspaziergänge auf – oder vielmehr, diese wurden so sehr Teil des übrigen Lebens, dass sich ihre Bemerkungen nur noch in demselben Maße gegen sie richteten wie gegen alles Übrige.
Dafür entlud sich eines Abends ein anderes Gewitter. Es begann damit, dass sie sagte:
„In Maikes Zimmer sind an der Decke ein paar Flecken. Wahrscheinlich irgendein Wasserschaden von oben. Klärst du das morgen mal?“
Es war wieder wie immer gesprochen. Ihm kam es sogar so vor, als würde es immer schlimmer. Mit der gleichen Emotionslosigkeit konnte man auch irgendeinen Schalter in einer Fabrik umlegen. Er fragte sich, warum sie dies dann nicht selbst tun konnte. Er stellte die Frage.
Daraufhin schaute sie ihn erst richtig an und sagte wütend:
„Wie bitte? Willst du etwa jeden Tag die Wäsche waschen und aufhängen? Oder Staub wischen? Denkst du, du wirst benachteiligt? Oder was ist das Problem!? Was ist das Problem, einen Anruf zu machen, der vielleicht zwei Minuten dauert?“
Er wurde von dieser Reaktion völlig überrascht. Bei ihrer Antwort fühlte er sich wieder im Unrecht. Und doch war es ihm nicht um die zwei Minuten gegangen, sondern um etwas ganz anderes.
Betroffen stand er auf und ging hinaus. Er hatte heute Abend schon seinen Spaziergang gemacht. Nun aber ging er zum zweiten Mal hinaus.
Mitten auf der Bank saß eine junge Frau. Beim Näherkommen sah er, dass sie einen Bürstenhaarschnitt hatte und einen grünen kurzen Rock mit Netzstrumpfhosen und hohen Stiefeln trug. Enttäuscht über die Besetzung seiner Bank wollte er schon weitergehen, doch dann siegte sein Bedürfnis, hier zu sitzen, und er setzte sich an das äußere Ende der Bank. Die Frau sah ihn kurz an und rückte etwas nach rechts. Ihr Gesicht war nicht so wild, wie ihr Äußeres vermuten ließ.
Er dachte an die Konfrontation von eben. Noch immer hörte er die Worte seiner Frau. Was war das Problem, einen zweiminütigen Anruf zu machen? Jetzt erst wurde ihm klar, dass er diese Frage auch ihr selbst hätte stellen können. Für ihn ging es überhaupt nicht um die Zeit, sondern um die Emotionslosigkeit, mit der sie solche Dinge aussprach. Hatte er wirklich die Pflicht, dies zu ertragen, nur weil sie dafür die Wäsche wusch?
Er stellte sich vor, wie er selbst die Wäsche waschen würde. Doch dieser Gedanke hatte etwas Unangenehmes. Er hatte nicht das Bedürfnis, in die Geheimnisse einer Waschmaschine einzudringen. Vielleicht war es letztlich ganz einfach, dennoch hatte er immer eine Art leisen Horror vor Maschinen aller Art, deren Funktionsweise und Bedienung er nicht verstand. Und Felicia brächte es fertig, es ihm nicht einmal zu erklären. Selbst eine demütigende, aber verständliche Erklärung würde er ja noch ertragen…
Er seufzte. Die Frau stand auf und ging. Hatte er sie vertrieben? Das hätte ihm leidgetan. Andererseits freute er sich, nun wieder allein zu sein. Er schaute ihr kurz nach. Seltsam, was die jungen Menschen heute manchmal trugen. Was wollte man damit eigentlich?
Als er wieder nach Hause kam, wurde er von Felicia erneut empfangen:
„Gehst du jetzt allen Auseinandersetzungen so aus dem Weg!?“
Wieder fühlte er eine Art Scham, obwohl er wusste, dass ihr Verhalten nicht richtig war.
„Und?“, setzte sie nach, „machst du es nun oder nicht?“
Sie meinte den Wasserschaden.
„Ich mache es“, sagte er.
„Na gut!“, sagte sie scharf.
Er hatte noch sagen wollen: Das ist nicht das Problem. Sogar die Frage nach der Waschmaschine hatte er noch stellen wollen. Doch ihre scharfe Antwort saugte ihm einmal mehr jeden Impuls dazu aus, und übrig blieb wieder einmal das Bedürfnis, nur so viel zu sagen wie unbedingt nötig. Ein weiteres Bleigewicht kam zu den ungezählten übrigen hinzu…
Am nächsten Abend war seine Bank wieder besetzt. Wieder war es dieselbe junge Frau, sie trug auch fast dieselbe Kleidung.
Wieder setzte er sich an den äußeren Rand, und auch diesmal rückte die Frau ebenfalls etwas zur Seite. In dem kurzen Moment, als sie sich anschauten, sah er jedoch, dass sie enttäuscht war, wiederum nicht allein hier sitzen zu können. Und obwohl es ihm ähnlich ging, fühlte er sich auch jetzt wieder ein wenig schuldig. Mit welchem Recht betrachtete er diese Bank eigentlich als die seine?
Die Sicherheit, dass die junge Frau im nächsten Moment aufstehen und gehen würde, und seine eigene Ratlosigkeit über sein trostloses Leben veranlassten ihn zu einer völlig ungewöhnlichen, fast spontanen Handlung. Müde fragte er:
„Was kann man tun, wenn man es einem Menschen in nichts Recht machen kann?“
Er hatte die Frage gestellt, ohne die junge Frau anzusehen, fast wie zu sich selbst. Und doch hatte er dies nicht aus Missachtung getan, wie Felicia, sondern um ihr so wenig wie möglich nahezutreten.
Nun sah die Frau jedoch ihn an, und auch er wendete ihr nun den Blick zu. Die überraschten Augen machten das Gesicht der jungen Frau noch sympathischer, als es trotz des Bürstenhaarschnitts bereits war.
„Was meinen Sie?“, fragte sie. „Haben Sie das gerade mich gefragt?“
„Ja“, gestand er. Und dann sagte er wahrheitsgemäß:
„Ich wollte Sie nicht… vertreiben.“
Sie lächelte.
„Nein, keine Sorge.“
Es dauerte einen Moment, bis er ihre Gedanken verstand.
„Nein“, verbesserte er sich. „Ich meine, ich dachte, Sie würden im nächsten Moment gehen. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich wohl diese Frage gestellt…“
Nun brauchte sie einen Moment, um zu verstehen.
„Ach so!“, lachte sie dann. „Wirklich?“
„Ja, wirklich.“
Die Frau musterte ihn kurz. Dann fragte sie:
„Aber auf wen bezieht sich Ihre Frage? War sie… ja, doch, sie war natürlich ernst gemeint, oder?“
„Ja“, sagte er und schaute nun wieder in die Ferne. „Sie bezog sich auf meine Frau…“
Dann sah er wieder die junge Frau neben sich an und ergänzte schnell entschuldigend:
„Aber Sie brauchen dazu überhaupt nichts zu sagen. Eigentlich ist es ja ganz verrückt, dass ich Ihnen überhaupt eine solche Frage gestellt habe.“
Wiederum fühlte er sich von der Frau kurz gemustert. Dann erwiderte sie:
„Vielleicht muss man manchmal ein wenig verrückt sein…“
‚Diese Antwort passt zu ihr’, dachte er unmittelbar. Und doch tat ihm diese Antwort irgendwo sehr wohl. Außerdem gab sie ihm den Mut, eine neue Frage anzufügen:
„Wie meinen Sie das?“
Sie lachte.
„So, wie ich es gesagt habe: Vielleicht muss man manchmal ein wenig verrückt sein.“
„Aber das verstehe ich nicht ganz.“
„Vielleicht, weil Sie noch zu selten verrückt waren.“
Er schaute sie ratlos an – sie lächelte.
„Nehmen Sie es nicht so ernst“, sagte sie dann. „‚Verrückt sein’ bedeutet einfach: Tun, was man will.“
Diese Worte lösten in ihm eine unerwartete Erschütterung aus. Es war, wie wenn sein ganzes Inneres für einen kurzen Moment unter Adrenalin stand; wie wenn ein Alarmruf durch sein Inneres ziehen würde – um sich dann sofort wieder in der Ferne zu verlieren.
„Tun, was man will?“, fragte er nun.
„Ja, einfach tun, was man will.“
Er wollte ihr deutlich machen, dass das nicht ging.
Ermutigt von ihrer offenen Art, empfand er genügend Vertrauen, ihr diese Tatsache an einem drastischen, abwegigen Beispiel zu verdeutlichen. Noch impulsiert von dem Mut der Spontanität sagte er, in völliger Gewissheit ihrer Antwort:
„Und angenommen, ich würde Sie nun küssen wollen?“
Einen winzigen Moment schien die Frau über diese Frage erstaunt. Dann sagte sie mit derselben Offenheit wie zuvor:
„Nun – warum nicht?“
Diese Antwort traf ihn zum zweiten Mal gänzlich unerwartet. In seinem Kopf drehte sich alles. Für ihn war die Frage rein rhetorisch gewesen – und nun entzog sie aller Rhetorik den Boden. Verwirrt überlegte er jetzt erst, ob er diese junge Frau überhaupt gerne küssen würde. Ihr offenes, sympathisches Gesicht, ihr Lächeln, war auf einmal sehr anziehend, sogar trotz ihres Haarschnittes. Doch kurz bevor er seinem Bedürfnis nachgeben wollte, sah er die ganze Szene vor sich, und ihre Unmöglichkeit zerbrach den ganzen Moment und führte ihn in die Normalität zurück.
Noch immer heftig verwirrt, wandte er den Kopf dem vor ihnen liegenden Weg zu und stellte entschieden fest:
„Das geht doch überhaupt nicht!“
Die junge Frau sah ihn einfach nur weiter an und sagte nichts.
Ihr Schweigen steigerte seine Verwirrung nur noch. Erneut sah er sie an und sagte, ein wenig zu heftig:
„Das geht doch nicht!“
Sie lächelte noch immer und sagte:
„Das haben Sie gesagt.“
Dann lehnte sie sich ihrerseits wieder gemütlich zurück und sah auf den Weg vor ihnen.
Noch immer legte sich seine Verwirrung nicht, und er fragte: „Aber was hätten Sie denn von mir gedacht? Ich meine, so alt, wie ich bin? Ich kann doch nicht…“
Sie sah ihn wieder an.
„Ich weiß nicht, was ich gedacht hätte. Woher soll ich das wissen? Es ist ja nicht passiert.“ Sie schwieg einen Moment lang. „Die Chance ist jetzt übrigens vorbei!“, sagte sie dann lachend.
Völlig verwirrt und auch sehr beschämt fragte Joachim Bauer sich, welchen Eindruck er soeben gemacht haben musste. Und in der Tat musste er sich gestehen, dass der Wunsch, diese junge Frau zu küssen, in ihm immer stärker geworden war.
„Entschuldigung…“, brachte er hervor.
„Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich glaube, es war meine Schuld.“
Gerührt begriff er, dass sie nicht wollte, dass er sich schämen musste.
„Was hier geschieht, ist an sich schon verrückt“, murmelte er.
„Wie ist es eigentlich überhaupt dazu gekommen?“
Wieder lächelte die junge Frau.
„Sie hatten es schon verrückt gefunden, mir eine Frage zu stellen, die Sie offenbar beschäftigte.“
„Ja, richtig“, sagte er, wie zu sich selbst. „Aber was geht Sie das an? Ich meine, Sie brauchen sich doch nicht um meine persönlichen Probleme zu kümmern…“
„Richtig.“
„Sehen Sie?“
„Ich brauche es nicht – aber es hindert mich auch nichts.“
„Aber es interessiert Sie doch gar nicht. Was hätten Sie denn davon?“
„Vielleicht studiere ich ja Psychologie…“
Entsetzt und beschämt fragte er:
„Wirklich?“
Die junge Frau lachte.
„Nein. Aber hätte doch sein können!“
Noch immer nicht beruhigt, fragte er:
„Und was studieren Sie nun wirklich?“
„Vielleicht studiere ich ja gar nichts.“
„Bitte sagen Sie mir die Wahrheit – ich bin schon so verwirrt genug.“
„Na gut, ich studiere noch nicht. Aber im nächsten Semester fange ich an. Design.“
„Gut. Aber trotzdem. Was haben Sie davon, sich meine persönlichen Probleme anzuhören?“
„Keine Ahnung. Noch haben Sie ja gar nichts davon erzählt.“ Er musste lachen. Eine wunderbare Logik!
„Ja. Aber ich meine, selbst schon meine Frage, die ich vorhin stellte, ist doch für Sie ganz uninteressant. Ich bin für Sie doch völlig fremd.“
„Ja und? Kann man sich für Fremde denn gar nicht interessieren?“
„Nun – das tut man in der Regel doch nicht?“
„Aber Sie haben eine Frage gestellt. Warum soll ich darauf denn nicht antworten?“
„Fühlten Sie sich denn gar nicht belästigt?“
„Das hätte ich schon gesagt.“
Für Joachim Bauer war dieses ganze Gespräch einschließlich des Inhaltes etwas völlig Neues. Es verstieß so sehr gegen seine bisherige Lebenserfahrung, dass er es noch immer nicht glauben konnte.
„Aber wie kann es sein, dass ein wildfremder Mensch mit einer wildfremden Frage Sie interessiert? Das kann doch eigentlich gar nicht sein?“
Die junge Frau lächelte ihn an.
„Man kann sich manche Dinge auch einreden“, sagte sie. „Und wenn Sie sie lange genug wiederholen, glaube ich sie vielleicht auch irgendwann. Also passen Sie lieber auf!“
Verwirrt schwieg er.
Nach einer kleinen Weile sagte die junge Frau:
„Wissen Sie, ich denke einfach, Menschen sollten füreinander da sein. Das kann man nicht immer und nicht jedes Mal. Aber warum sollte man nicht einer Frage zuhören und versuchen, darauf zu antworten? Vielleicht sehen wir uns nie wieder, vielleicht auch doch, aber was spielt das zunächst für eine Rolle? Sie haben mir eine Frage gestellt, und ich habe versucht, darauf zu antworten. Na ja, eigentlich habe ich ja eher auf das geantwortet, was Sie danach gesagt haben…“

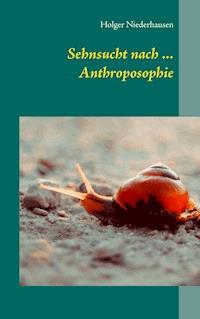

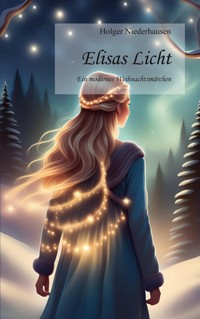
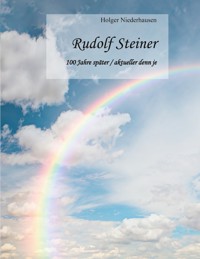







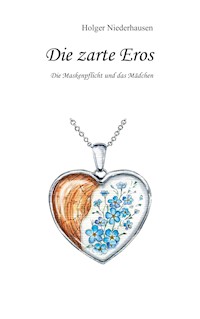



![Die [durchgestrichen: letzte] erste Unschuld - Holger Niederhausen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9d69c6320692c771bc65edda9a41b406/w200_u90.jpg)