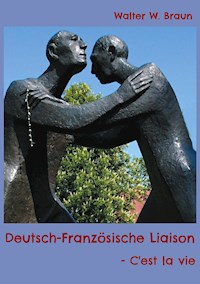Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit "über Grenzen gehen..." meint der Autor nicht nur Grenzen der Länder und Nationen. Das ist auch physisch zu sehen. Es sind die Grenzerfahrungen bei der Besteigung von hohen und höchsten Bergen oder Touren, die den Menschen aufs Äußerste fordern können. Irgendwann gewann er die Einsicht: "Man kann noch sehr lange, wenn man schon lange nicht mehr kann!" Und es bedurfte immer wieder der Selbstüberwindung, oder anders gesagt: "Den inneren Schweinehund bezwingen."Lohn ist das Glück über den Erfolg, der Stolz auf erbrachte Leistungen. Das Buch befasst sich ausschließlich mit Reisen ins oder im Ausland; zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto, Flugzeug oder Schiff. Bei allem stand die Erkenntnis im Vordergrund: Nur wer Fremdes gesehen hat, lernt Eigenes richtig zu schätzen und andere besser verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 649
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Hinweis zum Untertitel dieses Buches
Das bekannte Zitat steht am Anfang von Claudius' Gedicht »Urians Reise um die Welt« aus dem Jahr 1786. Der genaue Wortlaut im Gedicht ist: »Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was verzählen«
Mit „über Grenzen gehen...“ meint der Autor nicht nur Grenzen der Länder und Nationen, sondern das ist mehr physisch zu sehen. Es sind die Grenzerfahrungen bei der Besteigung von hohen und höchsten Bergen oder Touren, die den Menschen aufs Äußerste fordern können. Irgendwann gewann er die Einsicht: „Man kann noch sehr lange, wenn man schon lange nicht mehr kann!“ Und es bedurfte immer wieder der Selbstüberwindung, oder anders gesagt: „Den inneren Schweinehund bezwingen.“ Hinterher folgt aber der Lohn im stillen oder euphorischen Glück über den Erfolg, der Stolz auf die erbrachte Leistung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 1 Warum wollen Menschen und Völker reisen
2 Beschwerliches Reisen
Kapitel 2 1 Mit der Marine im Ausland
2 São Miguel, Hauptinsel der Azoren
3 Gran Canaria, eine Perle der Kanaren
4 Madeira, die Blumeninsel im Atlantik
Kapitel 3 1 Mit dem Schiff nach Norwegen
2 Zweite Schiffsreise nach Norwegen
Kapitel 4 Im Urlaub nach Österreich zum Großglockner
Kapitel 5 1 Besuche in Dänemark während einer Reserveübung
2 Tagesausflug in Dänemark
3 Von Kiel aus ein Trip nach Dänemark
Kapitel 6 1 Mit einer Jugendgruppe zum Rheinfall in Schaffhausen
2 Eine Geschäftsreise tangiert die Schweiz
3 Betriebsausflug in die Schweiz
Kapitel 7 1 Neugierig, in welchem Ort bin ich geboren?
2 Konditionsmängel am Straßburger Münster (Elsass)
3 Betriebsausflug ins Elsass mit Folgen
4 Mit Freunden entlang der Elsässischen Weinstraße
5 Auf Kaiser Wilhelms Spuren.
6 Fahrradtouren über die Grenze
7 Technisches Wunderwerk in Saint-Louis-Arzviller
8 Wanderungen in den Vogesen
9 Weitere Wanderung in den Vogesen
10 Promenade in Wissenbourg
11 Missverständnis bei einer Radtour im Elsass
12 Wieder eine Konditionstour in den Vogesen
13 Im Artilleriewerk Schoenenbourg der Maginot Ligne
14 Feiertag in Saverne (Zabern)
15 Auf der Route des Cêtes zur Col de la Schlucht
16 Besuche in Niederbronn-les-Bains und Bitche
17 In den berühmten Potterien von Soufflenheim
18 Mit unseren Enkeln im Elsass
19 Fête de la AAAFRONA mit Roger
20 Mit den Schulkameraden im Elsass
21 Rundreise nach Saint Die, Epinal und Géradmer
22 Wanderung in den Hoch-Vogesen mit Handicap
23 Wanderung zu Felsen und Burgen
24 Besuch im Eco-Musée im südlichen Elsass
Kapitel 8 1 Besuch bei Verwandten in Wien
2 Erlebnisse in Wien
Kapitel 9 1 Urlaub auf Gran Canaria
2 Abstecher auf die Insel Lanzarote
3 Erster Urlaub auf Teneriffa
4 Erneut auf Teneriffa
5 Mit der Familie auf Teneriffa
Kapitel 10 In Scheveningen in den Niederlanden
Kapitel 11 1 Ostern an der Orangenküste in Spanien
2 Im Winter in Spanien
Kapitel 12 Verspätete Hochzeitsreise nach Venedig
Kapitel 13 Einmal ins Großherzogtum Luxemburg
Kapitel 14 Erfahrung mit der DDR
Kapitel 15 1 Erster Urlaub im Montafon
2 Erneut im Montafon
Kapitel 16 Visite im Fürstentum Liechtenstein
Kapitel 17 Busreise nach Slowenien
Kapitel 18 Gipfelbesteigung auf über 3000 Meter
Kapitel 19 1 Erlebnisreiche Tage in den Schweizer Bergen
2 Misserfolg in einer grandiosen Berglandschaft
3 Erneut Versuch am Matterhorn
4 Vom Lötschental ins ewige Eis
5 Letzter Versuch am Matterhorn
6 Familienurlaub in Zermatt
Kapitel 20 1 Auf Ötzis Spuren in Österreich
2 Im Nationalpark Hohe Tauern
3 Großglockner-Tour mit Biwak
4 Eine Tour im Stubai
5 Weitere 9 Tage, jetzt im Ötztal
6 Von Österreich aus auf Deutschlands höchsten Berg
Kapitel 21 1 Ein verlängertes Wochenende in Cannes
2 Urlaub in Südfrankreich
3 Von Südfrankreich ins Fürstentum Andorra
4 Noch einmal in Südfrankreich
Kapitel 22 1 Herausforderung am Gran Paradiso
2 Bergtour auf den Ortler in Südtirol
3 Schmerzhafte Erfahrung in den Bergamasker Alpen
Kapitel 23 1 Urlaub an der türkischen Riviera
2 Abstecher nach Rhodos (Griechenland
3 Städtereise nach Istanbul
4 Noch einmal in der Türkei
Kapitel 24 1 Unsere Tochter wohnt in der Schweiz
2 Feste und Feiern in der Schweiz
3 Mit dem Glacier-Express unterwegs
4 Fitnesstouren in Kandersteg zum Oeschinensee
5 Sightseeingtour in Luzern
6 Geschäftliche Kontakte nach Rorschach
Kapitel 25 Urlaub im Sunshine-State Miami in Florida (USA)
Kapitel 26 In Budapest, der Hauptstadt von Ungarn
Kapitel 27 Dolce Vita in Italiens Toskana.
Kapitel 28 Traumreise nach Südafrika
Kapitel 29 1 Urlaub im Zillertal in Österreich
2 Urlaub im Zillertal
3 Harmonischer Familienurlaub im Zillertal
4 Im Zillertal zum Vierten
Kapitel 30 1 Am Säntis, im Osten der Schweiz
2 Mit einer starken Konditionstouren-Truppe am Säntis
Kapitel 31 1 Letzte Hochgebirgs-Tour mit Hans im Virgental
2 Anspruchsvolle Klettereien am Arlberg
3 Mit neuem Bergführer wieder einmal im Montafon
4 Geplante Bergwanderung am Arlberg
5 Zweiter Versuch am Arlberg
6 Im Tannheimer Tal von Reutte nach Pfronten
7 Weitere spannenden Klettereien im Montafon
8 Sommerfrische am Silvretta-Stausee
Kapitel 32 1 Eine Kletterwoche in den Dolomiten
2 Erneut in den Dolomiten und in Bozen
3 Noch eine Kletterei in den Dolomiten
4 Wanderwoche im Tessin
Kapitel 33 Feiern mit französischen Freunden im Elsass
Kapitel 34 1 Abenteuerliche Klettersteige in der Schweiz
2 „Verruckti Chaibe“ auf Schweizer Klettersteigen
3 Erneuter Versuch im Gemmisteig bei Leukerbad
4 Überraschung in Kandersteg
5 Auf Sions Höhen im Wallis und erneut im Gemmisteig
6 Herbsttage im Wallis
Kapitel 35 Plaisir am Gardasee
Kapitel 36 Urlaub in Dubai, Abu Dhabi und Oman
1
1. Warum wollen Menschen und Völker reisen?
Schon seit der Homo erectus und seine früheren Verwandten, danach der Homo sapiens 1), der sich von Afrika aus verbreitete, die Kontinente und alle Regionen der Erde bevölkerten, bestand schon ein innerer Drang, ein angeborener Antrieb sich fortzubewegen. Das war die frühe Form des Reisens, das über Tage, Monate und Jahre dauern konnte. Der Hintergrund war das Bedürfnis und Bestreben ein wenig über den Tellerrand zu blicken. Das mag durchaus viele Gründe gehabt haben und war nicht nur aus reiner Neugierde. Unsere Vorfahren wollten sehen, wo es reichlich Beute gibt, wo die besten Jagdreviere anzutreffen sind und man besser, sicherer oder vielleicht auch etwas bequemer leben könnte. Dann, so lässt sich vermuten, wollte man entdecken, wo und wie der nächste Nachbar lebt und wer das sein mag. Weitere Gründe waren neues Land zu erobern oder sich vor Gefahren in Sicherheit zu bringen. Für beides waren angeborene Fähigkeiten und angelerntes Wissen wichtig, um sich in geeigneter Weise verteidigen zu können oder in der Lage zu sein, erfolgreich Länder erobern zu können. Nachdem die eigenen Bedürfnisse ausreichend abgedeckt und gesichert waren, entstanden schließlich geschäftliche Bedürfnisse und meist auch sehr ertragreiche Handelsbeziehungen zwischen den Völkern. So kamen Porzellan aus China, Gewürze aus Indien und anderen asiatischen Ländern und so weiter nach Europa. Und ein weiterer Faktor und Antrieb mag gewesen sein, das war ein reger Austausch der unterschiedlichsten Kulturen.
Schon die Bibel lehrt uns, dass Kain, nachdem er seinen Bruder Abel erschlagen hatte, mit seiner Sippe in ein anderes Land gezogen ist und dort die Stadt Nod jenseits von Eden baute. Vermutlich fürchtete er sich vor der Sippe Abels und brachte sich mit seinem Stamm (Volk) durch die Flucht – oder Auswanderung – in Sicherheit. Unter „anderes Land“ ist kein Staatsgebilde zu verstehen, wie wir es heute kennen, sondern nur eine andere Region; vielleicht gar nicht allzu weit vom Ursprung entfernt.
Über die Jahrtausende und Jahrhundert war der Entdecker-Drang unter den Völkern Antrieb und Grund sich anderweitig umzusehen und andere suchten einfach nur Ruhm und Ehre. Wissbegierige Forscher wollte sehen was der Nachbar hat oder wie es über der Grenze (Grenze des Horizonts, nicht der Staatsgrenze) aussieht und wie es von da aus weitergeht. Die angeborene Neugierde und der Forschergeist des Menschen wurden zur Triebfeder. Reisen und damit verbundene Abenteuer hatten immer schon etwas Magisches an sich. Es war aufregend und spannend, wenn man fremde Länder betreten durfte, andere exotische Kulturen entdecken konnte. Wer sie nicht ausbeutete, der wollte zumindest andere Menschen besser verstehen, in ihrer Art und ihrem Leben kennenlernen. So erweiterte sich der geistige Horizont, wenn man die eigene Komfortzone verlassen hatte und den Nachbarn einmal besuchte, seine Kultur kennenlernte und eine farbig-bunte Vielfalt auf sich einwirken ließ, statt sich an dem Unbekannten zu reiben oder exotischen zu stören.
Unternehmungslustige oder feindlich gesinnte Völker, wie die Wikinger – um nur dieses eine nordische Volk zu nennen –, zogen über riesige Entfernungen, um Ländereien zu erobern oder sie waren als Verfolgte auf der Flucht. Es gab die Zeit der großen Völkerwanderung, die Menschen von Ost nach West oder von Nord nach Süd brachten. In Jahrhunderten oder Jahrtausenden haben sie Kontinente erobert und die Stämme vermischten sich. Mehrfach waren die Menschen gezwungen ihre Heimatregion zu verlassen, um bei Klimaveränderungen und Ernteausfällen, denen Hungersnöte folgten, das Überleben der Sippe zu sichern. Nehmen wir dabei wieder ein Beispiel aus der Bibel. „Jakob zog während einer Hungersnot in seinem Lande mit den Söhnen und deren Anhang nach Ägypten, da es dort genug Vorräte und noch Getreide zu kaufen gab.“ Seine Nachkommen siedelten in Gosen und lebten rund 300 Jahre in dieser fruchtbaren Region. In unserer jüngeren Zeit, im 19. und 20. Jahrhundert trieb der Hunger Zigtausende zum Auswandern nach Amerika oder fleißige Bürger wurden nach Ungarn und Rumänien gelockt, um dort die Ländereien zu bewirtschaften und den Herrschenden so die Kassen zu füllen.
Heute gehört Reisen aus vielfältigsten Antrieben und Gründen zum einen aus reinem Vergnügen und zum anderen aus geschäftlichen Gründen zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen in Deutschland. Die Medien bezeichnen die Deutschen deshalb gerne als „Reiseweltmeister“, ob der Einzelne etwas davon hat, ober er je einmal wegkommt oder nicht.
2. Beschwerliches Reisen
Wenn wir nun einmal ein paar Generationen zurückblicken, sehen wir Reisen noch als zeitraubendes, mitunter gefährliches und anstrengendes Abenteuer und von dem, was das kostete, wollen wir gar nicht erst reden. Aus reiner Wissbegierde blieb das Vergnügen zumeist nur einzelnen, wagemutigen Abenteurern vorbehalten, wie dem Naturforscher Alexander von Humboldt oder Vaco da Gama, dem Entdecker vieler Seewege. Mit einem Schiff kam der Reisende noch relativ schnell vorwärts, ansonsten musste er zu Fuß gehen, ritt auf einem Esel, Kamel oder Pferd und wer es sich leisten konnte, fuhr bequemer mit der Pferdekutsche. Und Könige und Kaiser regierten noch reisend; sie hatten keinen ständigen Regierungssitz, sondern sie zogen von Region zu Region und hielten an wechselnden Orten Gericht oder trafen politische Entscheidungen, so wie der Kaiserstuhl (erst Königsstuhl, dann Kaiserstuhl), an dem Otto III. am 22.Dez.994 bei Sasbach sein geschichtsträchtiges Gericht abhielt.
Anfang des 19. Jahrhunderts fuhr die erste Dampfeisenbahn und kaum hundert Jahre sind es her, da das Automobil erfunden wurde. Von nun an wurde peu à peu das Fortkommen einfacher, komfortabler und bedeutend schneller. Seit einem halben Jahrhundert fliegen Düsenflugzeuge in Stunden über die Kontinente. Damit wurde es sogar dem „Normalsterblichen“ möglich, in relativ kurzer Zeit ferne und selbst exotische Länder zu erreichen und in alle Gebiete vorzudringen.
Noch einen gewichtigen Vorteil bescherten die Entwicklungen der Neuzeit. Heute muss niemand mehr einen schweren Beutel mit Münzen oder ein Bündel Scheine mitschleppen und ist nicht mehr länger an einen Ort gebunden, bis die angeforderten Geldmittel aus der Heimat transferiert eingetroffen waren. Stattdessen gibt es schon länger die relativ sicheren Reiseschecks und heutzutage ermöglichen Bank- und Kreditkarten überall auf der Welt Geld aus dem Automaten zu ziehen oder es können Überweisungen mit Western Union und anderen Geldhäusern schnell und einfach an so gut wie jeden Ort der Welt in minutenschnelle und an jedermann getätigt werden.
Die Sprachbarriere war seit der biblischen Sprachverwirrung von Babylon ein großes Hindernis. Nur eine Minderheit beherrschte eine Fremdsprache und allenfalls einige Privilegierte konnten sich in Latein, Französisch, Spanisch oder Portugiesisch verständigen und in den fernöstlichen Sprachen bewegten sich noch weniger. Erst die weltweite Ausbreitung der englischen Sprache vereinfacht die Kommunikation.
Die Weltkriege brachten unfreiwillig Millionen Menschen in ferne Länder; ein sicher nicht beabsichtigter Nebeneffekt aber für den Einzelnen ein Stück Lebenserfahrung. Heute noch höre ich die Veteranen an den Stammtischen von der Zeit in Sewastopol auf der Krim schwärmen oder wenn sie verklärt von ihren amourösen Geschichten erzählten, aus der Zeit als sie „wie Gott in Frankreich“ lebten. Unter normalen Verhältnissen wären sie im Leben vermutlich nie und nimmer dahin gekommen. So hatte sich ihr Horizont aufgezwungen erweitert.
Es ist auch erst ein halbes Jahrhundert her, dass die Deutschen den Lido di Jesolo entdeckten und Venedig an der Italienischen Adria. Seither strömten Millionen über die Alpen zu den Italienern, um das Dolce Vita - das süße Leben – zu genießen, die italienische Lebensart. Später wurde Mallorca zum 17. Bundesland der Deutschen erklärt, wie es die Bild-Zeitung gerne tituliert.
Weite Reisen waren für einen im Schwarzwald aufgewachsenen Buben und Jugendlichen bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts kaum denkbar, es sei denn, vermögende Eltern machten das möglich. Meine erste größere Bahn-Reise war an die Nordsee, nachdem mich die Bundeswehr zum Eignungstest nach Wilhelmshaven einberufen hatte.
In diesem Buch möchte ich nicht meine Reisen innerhalb Deutschlands eingehen, in denen ich in den Jahrzehnten privat und geschäftlich in so gut wie in jeden Winkel unseres Landes kam, von der Nord- und Ostsee bis auf die höchsten Berge im Alpenraum. Dabei lernte ich auch hier die vielen Facetten der Schönheit unseres Landes und ganz besonders unserer engere Heimat kennen und schätzen lernte. Gerade Deutschland in der gemäßigten Klimazone, ist ein Land das eine bemerkenswerte Fülle bietet und eine unglaubliche landschaftliche Vielfalt. Im Grunde müsste niemand ins exotische Ausland reisen. Hier spielt aber wieder die angeborene Neugierde hinein und die Erkenntnis, nur wer Fremdes gesehen hat, lernt das Eigene richtig zu schätzen und andere besser verstehen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang. Mit der Corona-Pandemie in den Jahren 2020/21 wurde Reise sehr stark eingeschränkt und war zeitweise so gut wie nicht möglich. Viele Länder wurden als Risikogebiete eingestuft und der Flugverkehr kam zum Erliegen. Da Urlaub im Ausland so gut wie unmöglich wurde, entdeckten plötzlich die Deutschen wieder das eigene Land. Die Touristen bevölkerten die Wanderwege im Schwarzwald genauso wie die Strände an Nord- und Ostsee. Hätten nicht über Wochen und Monate die Gaststätten, Restaurants und Hotels auf behördliche Anordnung geschlossen sein müssen, und sonst durften sie nur mit Einschränkungen im Platzangebot öffnen, wären die Gästezahlen auf Rekordhöhe geschnellt.
So interessant und abwechslungsreich Reisen und Aufenthalte im Ausland für mich waren, umso mehr lernte ich die Schönheiten der eigenen Heimat, der Mittelbadischen Region schätzen und was man kennt, will man bewahren. Wer sich dazu noch mit der Geschichte und Kultur befasst findet einen unerschöpflichen geistigen Reichtum und ist immer wieder erstaunt, über welches Wissen, welche schöpferische Kraft und Einfallsreichtum unsere „Altvorderen“ verfügten.
Im Blick auf meine badische Heimat will ich in diesem Kontext gerne Konrad Kintscher, einst Direktor bei Burda in Offenburg, aus seinem Buch zitieren:
Das Land am Oberrhein
"Wenige Landschaften der Welt wurden so vielfältig gepriesen wie das vom Schwarzwald und den Vogesen so schön und mächtig eingerahmte Gebiet am Oberrhein. Obwohl drei Länder am Strom zusammentreffen, wirkt ihre Sprache, die alemannische Mundart, über die Ufer des Rheins, über die Höhen der Gebirge und tief ins Land der Eidgenossen und der Franzosen. Auch ist die geologische Verwandtschaft so wenig zu übersehen, wie der Gleichklang der Sprache unüberhörbar ist"
Anregungen und Ideen findet der geneigte Leser auch in einem meiner weiteren Bücher, das Wandervorschläge gibt.
Dem Südwesten hautnah
111 Tipps und mehr – ein etwas anderer Wanderführer
Paperback, 260 Seiten, 46 Bilder, ISBN 978-3-7386-2881-4
Top-Touren im Südwesten - für geübte und konditionsstarke Wanderer
Paperback, 260 Seiten, 45 Farbseiten
ISBN: 978-375-043-143-0
1 ) https://www.br.de/wissen/homo-sapiens-evolution-geschichte-moderner-mensch-referat-100.html
2
1. Mit der Marine im Ausland
Nur ein Jahr später nach dem Eignungstest bei der Marine in Wilhelmshaven begann für mich die militärische Ausbildung im Marine-Ausbildungsbataillon 1 in Glückstadt an der Elbe. Das idyllische Städtchen nördlich von Hamburg und direkt an der Elbe blieb mir wegen dem schikanösen Drill in und außerhalb der Kaserne, nachhaltig aber nicht in so guter Erinnerung. Zu sehr hallt noch der dumpfe Kommiss-Ton nach, das hirnlose Gebrüll kleiner Könige, die sich als Maat, Obermaat oder Bootsmann ansprechen ließen. Die Marine wähnte sich Mitte der Sechziger noch als Elite und entsprechend mussten sie ihrer Meinung nach uns, die Matrosen drillen. „Wir werden jetzt richtige Menschen aus euch machen“, hörten wir die „Sklaventreiber“ lauthals brüllen. „Euch soll der A… auf Grundeisen gehen“ und noch mehr solcher hirnloser Sprüche prasselten auf uns nieder. Doch das Vierteljahr mit allen Schikanen und Erniedrigungen ging auch vorüber, dann folgten Fachlehrgänge zum Sanitäter in List auf Sylt und in Krankenpflege-Schulungen in einer großen Klinik, nahe Wilhelmshaven und dem Heereslazarett in Bad Zwischenahn. Dort herrschte schon ein anderer Ton vor und nun begann für mich die interessantere Zeit bei der Marine.
Die Ausbildung dauerte insgesamt 9 Monate an drei verschiedenen Standorten und nach dem erfolgreichen Abschluss war ich nun Gefreiter und Krankenpfleger und wurde zum Sanitätsdienst auf das Trossschiff Dithmarschen versetzt. Mit mir sorgte sich ein Obermaat um das Wohl der rund hundertköpfigen Besatzung. Außerdem lagerte Sanitätsmaterial für 2000 Mann im kriegsmäßigen Einsatz im Bauch des Schiffes, dem Magazin. Da war alles dabei, was man sich denken konnte, einschließlich Suspensorium (für Männer) und Wärmeflaschen für frierende Kranke.
Der Borddienst auf diesem Schiff begann nach dem Ende der Lehrgänge und einigen wohlverdienten Urlaubstagen über Weihnachten und dem Jahreswechsel auf 1966 bis nach Dreikönig. Zu meiner Freude war das neue Kommando in Wilhelmshaven, der Großstadt mit langer Marinetradition und am Jadebusen, wo ich mich schon auskannte und inzwischen Freunde und Bekannte gefunden hatte. Das Trossschiff mit der Nato-Bezeichnung A 1409 selbst war eigentlich ein normales Transportschiff im Natograu. Gebaut wurde es ursprünglich als ziviles Handelsschiff, dann hat es die Marine gekauft, modifiziert und seit etwa 1955 diente es als Versorgungsschiff den zu begleitenden Schiffen und führte, außerdem dem erwähnten Sanitätsmaterial, das etwa ein Drittel der Kapazität beanspruchte, Wasser und ein weiteres Drittel seemännische Material mit sich. Da fanden sich Holz zum Abdichten von Lecks und Wassereinbrüchen, Feudel (Putzlappen) und Pütz (seemännisch für Eimer), natograue Farbe zum Pönnen (streichen), Tampen (Seile) und viele andere alltäglich wichtige Dinge.
Trossschiff „Dithmarschen“
Das Schiff hatte knapp über 3000 Bruttoregistertonnen und eine Schiffslänge von rund 100 Metern vom Bug nach Achtern. Dem zivilen Ursprung war es zu verdanken, dass es keine Bewaffnung an Bord gab, von Pistolen und dem G3-Gewehr, die zu jedem Soldaten gehörten, einmal abgesehen. Zu dieser Zeit hatte die Marine noch wenige bewaffnete und gegen ABC (Atomare, biologische und chemische Kampfmittel) abgeschirmte Transportschiffe. Die neue Generation an Versorgungsschiffen, wie das Trossschiff Offenburg und viele andere wurden erst später in Dienst gestellt. Heute – 50 Jahre später – werden mit Sicherheit keine unbewaffneten Versorgungsschiffe mehr in der Marine im Dienst auf den Meeren unterwegs sein.
Im Wohnbereich der Versorger, zu denen ich als Sanitäter zählte, gab es die
Back (Tisch) und Spinde für das Essgeschirr und gepolsterte Truhen dienten als Sitzgelegenheiten. Sie boten genügend Stauraum für Decken und andere Dinge. Jeder Spind ließ sich verriegeln und das war nicht unwichtig, damit bei starkem Seegang nicht alles herausfiel – und wir sollten noch erleben, was hoher Wellengang und tobendes Meer bedeutet und welche undenkbaren Kräfte dabei frei werden und sich entfalten können. Das Versorgerdeck hatte zusätzlich einen großzügigen Waschbereich mit Dusche und Toiletten. Die Schlafkojen im Raum waren 3-stöckig übereinander angeordnet und relativ komfortabel und Gitter boten Schutz, damit keiner im Schlaf unabsichtlich herausfiel und abstürzte. Jedes Besatzungsmitglied verfügte, im Vergleich zu den Verhältnissen auf anderen Marineschiffen, ungewöhnlich viel Platz. Für mich stand zudem noch ein Ausweichquartier im Sanshap zur Verfügung, meinem Arbeitsplatz auf dem Achterdeck, und davon machte ich häufigeren Gebrauch, wenn ich alleine sein wollte. Neben einem gut gefüllten Medikamentenschrank und dem unverzichtbaren Behandlungstisch, waren hier Ersatzgeräte für die Funker, falls der Funkraum auf der Brücke einmal im Gefecht ausfallen sollte. Hier übten sich die Funker hin und wieder im Morsen, indem sie darin regelmäßig Wettwerbe mit anderen Schiffen ausgetragen haben. Die Morsekenntnisse und Schnelligkeit im Senden und Lesen der Zeichen musste immer und immer wieder geübt werden und das ging ganz einfach auch zwischen dem Funkraum und achtern im Sanshap.
Im Krankenrevier, wie das Sanshap auch genannt wurde, stand noch ein Etagenbett für zwei Kranke zur Verfügung, die ich auch benützten konnte, wenn ich wollte und sie nicht von Patienten belegt waren – und das kam in meiner aktiven Dienstzeit nie vor.
Nach der Eingewöhnungsphase verließ unser Schiff in den letzten Januartagen die Pier in Wilhelmshaven. Bei jeder Ausfahrt mussten wir zuerst die große Seeschleuse passieren, die in jener Zeit die größte Binnenschleuse der Welt gewesen sein soll. Weiter ging die anfangs in gemächlicher Fahrt durch den Jadebusen und mündete in Höhe der Nordfriesischen Inseln schließlich in die Nordsee. Der weitere Kurs war Nordwest und nach Tagen ohne besondere Vorkommnisse, aber ausgefüllt mit Rollenschwoof (Übungseinheiten für den Ernstfall nach dem Rollenplan), passierten wir die backbords liegende englische Insel oder das Königsreich Großbritannien. Alles war für mich völlig neu, interessant und spannend. Selbst in der Freizeit verbrachte ich viele Stunden an Deck, wollte sehen und mitbekommen, was an Bord oder Außerhalb unterwegs so alles abläuft und vor sich ging. Die Nordsee war in den ersten Tagen noch relativ ruhig und kaum bewegt und bereitete mir keine Schwierigkeiten. Das einzige Manko war, es war bitterkalt und die metallenen Planken verstärkten, wenn man länger darauf stand, dieses Gefühl.
Nach Tagen erreichten wir das raue Seegebiet nahe den Färöer Inseln, etwas nördlich von Schottland. In diesem Seegebiet war es zu in der winterlichen Jahreszeit empfindlich kalt, großflächige Eisplatten schwammen ringsum auf dem kaum bewegten Wasser. Immer noch wurden wir tagsüber und manchmal auch nachts mit allen möglichen Übungseinheiten beschäftigt und in Trab gehalten. Speziell „Highline fahren“ musste mit den Neulingen in der Seemännischen Division an Bord geübt werden. Damit wird die Übergabe von Material auf See bezeichnet. Zwei parallel fahrende Schiffe werden über sehr belastbare Tampen aus Sisal (dicke Seile) verbunden, der sogenannten „Highline“ und daran wird per Schlauch Wasser, Öl oder mittels Paletten festes Material übergeben; „fieren“ genannt. Während der Operation hatten die Seeleute dafür zu sorgen, dass die „Highline“ immer straff blieb. Durch die Seebewegungen kommen sich die Schiffe näher oder triften auseinander. Das musste anfangs noch manuell mit bis zu 10 Mann über ein Spil reguliert und ausgeglichen werden, indem das Seil nachgegeben oder eingeholt wurde. Später wurden automatische Seegang-Windschen an Deck montiert, die elektrisch gesteuert die Bewegungen ausgleichen konnten. Das erleichterte fortan sehr wesentlich die Arbeit der Seeleute. Während diesen Manövern war meine Position als Sanitäter mit einem Verbandskoffer an Deck, während mir die Schuhe fast festfroren.
Während den Manövern zeigte sich die See in diesem nördlichen Gebiet stündlich zunehmend rauer und das Schiff folgte dem Seegang. Die Bewegungen wurden heftiger und es stellten sich bei mir die ersten Symptome der Seekrankheit ein. Ich bekam Kopfschmerzen, mir wurde es flau im Magen und ich konnte es kaum glauben, nachdem der Kommandant auf meine Frage: „Welchen Seegang haben wir denn?“, antwortete: „Das ist noch ganz harmlos, wir haben erst Seegang sechs.“ Für einen geübten Seemann war das allenfalls mittelmäßig und bei einem erfahrenen Segler begann jetzt erst der richtige Spaß.
Vermutlich hatte ich schon eine grüne Färbung im Gesicht. Der Kapitän gab mir jedenfalls den Rat: „Trink einen Whiskey, dann geht es dir gleich besser“, und das meinte er betont zuversichtlich. Bei anderen mag sein Tipp nützlich gewesen sein und gewirkt haben, bei mir nicht. Nun war es ganz aus mit meinem seemännischen Stehvermögen; mir wurde spuckübel. Bei der nächsten günstigen Gelegenheit verzog ich mich in meine mittschiffs im Versorgerdeck befindliche Koje.
Jetzt zeigte sich der Vorteil, dass ich bei den Versorgern untergekommen war. Mitten im Schiff sind die Bewegungen deutlich geringer und eine Idee besser zu ertragen, wie auf dem Achterdeck oder gar vorne im Bug, und erst recht wie in den höheren Bereichen der Brücke oder in der Offiziersmesse, in der ich – da ich als Sanitäter nach Meinung der Offiziere nicht ausgelastet war – „Backschafter“ sein musste, das heißt, ich holte das Essen aus der Kombüse und servierte es den Offizieren. Später musste ich abräumen und mich um den Abwasch kümmern.
Mit jeder Welle hob und senkte sich das Schiff am Bug und achtern um mehrere Meter. Das Auf und Ab verstärkte sich noch durch seitlich rollende und stampfenden Bewegungen und unangenehmes Geschlingere.
„Highline fahren“ auf hoher See
Die Übungsfahrt dauerte vierzehn Tage, dann waren wir wieder zurück in Wilhelmshaven an der Pier. Die Festmacherleinen waren aber nicht lange mit den Pollern verbunden und schon hieß es wieder „Leinen los“. Bereits ein paar Tage später verließen wir wieder den Hafen und vor uns lag eine abwechslungs- und ereignisreiche sechswöchige Auslandsfahrt.
Unser Schiff hatte die Aufgabe einen Marineverband, bestehend aus Zerstörern und Fregatten, in den Atlantik zu begleiten. Ein zweites Versorgungsschiff, die Münsterland, war ebenfalls mit von der Partie und für die Treibstoffstoffversorgung der Schiffe zuständig. Das Tankschiff war um einiges größer als das Trossschiff Dithmarschen. Ziel der Übungsfahrt war die seemännische Ausbildung der Mannschaften, verbunden mit einem mehrtägigen Übungsschießen rund 1000 Meilen südwestlich der Azoren, mitten in den Weiten des Atlantiks und nur wenig nördlich des Äquators. Nebenbei sollten ausländische Häfen angelaufen werden. Solche Kontakte waren wichtiger Teil der Repräsentation und diente auch dazu Kontakte im Ausland zu pflegen. Ein weiterer, nicht unwichtiger Nebeneffekt, bei dieser Gelegenheit konnte günstig direkt und zollfrei Verpflegung und Treibstoff gebunkert werden (einkaufen und einlagern).
Der Verband passierte nach dem Auslaufen im Konvoi bei langsamer Fahrt den Jadebusen und noch zeigte sich alles perfekt und in bester Ordnung. Bei mir überwog die Vorfreude auf die Zeit auf See und ich war sehr darauf gespannt, was uns in den Häfen erwarten wird, in die wir nach Plan einlaufen wollten. Dann durchfuhren wir den Ärmelkanal – eine für die Bootsbesatzung wichtige Marke, denn ab Höhe Dover-Calais gab es – neben dem allgemeinen Wehrsold und der Bordzulage, eine Verdoppelung der Bordzulage und zusammen war das über den Daumen gerechnet insgesamt eine Verdreifachung des üblichen Wehrsolds. Für mich, dem inzwischen zum Gefreiten beförderten Wehrpflichtigen, war das sehr willkommen, ich konnte jede zusätzliche Mark gut gebrauchen, denn meiner Familie konnte und wollte ich nicht auf der Tasche liegen.
Nach den anfangs relativ ruhigen Tagen auf See näherten wir uns der berühmt-berüchtigten Biskaya und in diesem Seegebiet gerieten wir in eine massive Schlechtwetterfront, uns erwartete ein veritabler Orkan mit Windstärken zwölf und Seegang elf. Die Wellenberge kamen haushoch und in der Folge drosselten die Schiffe auf „langsame Fahrt“, der Abstand zwischen den Schiffen im Konvoi wurde deutlich vergrößert; kaum dass man das Nachbarschiff noch zwischendurch aus den Wellenbergen auftauchen sehen konnte. Für uns Unerfahrenen war es unglaublich, wie sehr das Schiff stampfte, schlingerte, schaukelte und rumpelnd in sich durchgeschüttelt wurde. Das Metall ächzte, riesige Wellenbrecher mit schäumenden Wassermassen ergossen sich über das Deck. Jedes nicht absolut sicher festgezurrte und verstaute Teil flog wie ein Geschoss durch die Gegend.
Das Vorschiff taucht tief in einen Wellenberg ein
Der Verband pflügte drei lange Tage im tobenden Sturm langsam durch die See, bis das Gebiet durchfahren war und wir uns den Azoren näherten. Schon kurz nach Beginn des Sturms und seit das Schiff so heftig zu schlingern und zu schaukeln begonnen hatte, war ich seekrank und mir war es sterbenselend übel. Jede Minute empfand ich danach nur noch als der reinste Horror. Anfangs versuchten mich Vorgesetzten durch geeignete Maßnahmen abzulenken, damit sich die Seekrankheit legen sollte oder ich mich daran gewöhnte. Erst wurde ich zum „Posten Ausguck“ auf die Brückennock gerufen. Das ging gar nicht; wie sollte ich ernsthaft nach möglichen Gefahren Ausschau halten können, wenn der Magen minütlich rebellierte. Dann sollte ich angeseilt das Achterdeck schruppen, während ununterbrochen Brecher über das Deck rollten und über mich und den mir zur Seite stehenden Bootsmann hereinbrachen. Schon klitschnass wurde nach wenigen Minuten das unwürdige Spiel abgebrochen. Jegliche Bemühungen mich seefest zu machen sind erfolglos geblieben und hatten nichts gebracht. Irgendwann war es mir so sterbenselend; ich verweigerte jeden Befehl, verzog mich ins Deck, das wie schon erwähnt, mittschiffs lag und legte mich in eine der untersten, freien Kojen und hielt die Pütz (Eimer) im Arm.
Mittschiffs waren die Schaukelbewegungen geringfügig weniger spürbar. Trotzdem war der Spukkübel mein wichtigstes Utensil und blieb in Reichweite und so wurden drei Tage wurden zur Qual und waren der reinste Horror. Schon kurz nach Beginn der Übelkeit waren bei mir der Rachen und Mundraum durch die Magensäure verätzt und jeder Schluck schmerzte. Trotzdem musste ich ständig trinken, um eine Dehydrierung vorzubeugen und Kekse essen. Die Vorgesetzten ließen mich aber fortan in Ruhe, und ich war auch nicht der einzige Seekranke an Bord. Vielen aus der Mannschaft, den Unteroffiziere und Offiziere erging es nicht besser, nur mit unterschiedlichen Verläufen. Selbst der Kapitän war angeschlagen und „hütete die Koje“. Die leichtere Form der Seekrankheit zeigte sich in heftigen Kopfschmerzen, die schwerere nahe der Ohnmacht und Dehydrierung, so wie bei mir.
Nur einem der Seeleute schien das alles gar überhaupt nichts auszumachen. Sein beliebtester Arbeitsplatz war im Vordersteven des Schiffes. Während die übrige Besatzung gegen die Seekrankheit ankämpfte, lief er durch das Mannschaftsdeck und schlürfte rohe Eier aus. Wer sich bis dahin noch hatte auf den Beinen halten können, der wurde nun schlagartig grün im Gesicht, spukte über die Reling und fütterte die Fische.
Und es war noch einen Major an Bord, der als Gast offiziell die Auslandsreise mitmachen durfte. Seinen Dienst versah er bei einer Starfighter-Staffel. Der Bruder unseres 1. Offiziers ist bei diesem Geschwader tödlich abgestürzt und deshalb durfte er jährlich einen Staffelkameraden zu einer längeren Auslandsausfahrt einladen. Selbst im gröbsten, tosenden Sturm stand der Major unerschütterlich auf der Brücke und lies sich mittags 6 Teller Eintopf bringen. „Wenn ich wieder im Flieger sitze, wird mir jedes Gramm abgewogen“, begründete er schmunzelnd seinen großen Appetit.
Was ich in diesen Tagen zu mir nehmen konnte war, neben Wasser, sogenannte „Panzerplatten“. So bezeichneten wir haltbare Kekse aus dem Nato-Paket, das zur Verpflegungsration gehörte, die jedem Soldaten für den Notfall in seiner Ausrüstung zur Verfügung stand. Hätte mich in diesen Tagen jemand über Bord geworfen, wäre es mir egal gewesen und ich hätte es vielleicht sogar als Erlösung empfunden. Mit jeder Minute bereute ich mehr, nun Dienst bei der Marine tun zu müssen. Die raue See war absolut nicht mein Ding und ich konnte mich auch später damit nie anfreunden. Segelsport war demnach nie eine Alternative für mich.
Eine Nordfriesische Zeitung berichtete später in einem groß aufgemachten Artikel ausführlich über die denkwürdige Fahrt der Marineschiffe im tobenden Orkan in der Biskaya. Dabei wurde erwähnt, dass über 12 Meter hohe Wellen über die Schiffe rollten und die Fregatte Köln Wassereinbruch gehabt haben soll. Die Krängung der Schiffe lag bei 50° und somit am kritischen Punkt, also richtig heftig und grenzwertig.
Von unserem Schiff wurden keine nennenswerten Schäden vermeldet. Durch Seekrankheit halbtote Seeleute galten nicht als Schaden! Zum Glück geht im Leben aber alles Übel der Welt irgendwann auch einmal wieder zu Ende. Wir erreichten nach über einer Woche auf See und mehreren Tagen im Sturm die Azoren, ein Inselarchipel im östlichen Atlantik. Zuerst ankerten wir aber noch auf Reede in Sichtweite der Insel. Alle Mann, oder besser gesagt, die Mannschaft ohne die Offiziere, mussten alle rostigen und lädierten Stellen mit frischer Farbe ausbessern. Das Schiff wurde von unten bis oben gepönt (gestrichen) und gleichzeitig auch penibel rein Schiff gemacht (reinigen, putzen). Der Sturm hatte auch an unserem Schiff Spuren hinterlassen und im Einfluss des salzhaltigen Wassers blühte auch so schon permanent Rost. Bei der Einfahrt in den Hafen musste alles picobello aussehen; wir repräsentierten schließlich die Bundesrepublik Deutschland.
2. São Miguel, Hauptinsel der Azoren
Nachdem das Schiff im neuen Glanz erstrahlte und somit die Beschäftigungstherapie für die Mannschaft beendet werden konnte, gab der Kommandant ein Bordfest. Jedes Deck (Mannschaften, Unteroffiziere, Portepee-Unteroffiziere und Offiziere) bekam mehrere Flaschen Sekt spendiert und zugeteilt. Außerdem war temporär das Alkoholverbot für die Mannschaft aufgehoben und wir konnten wieder Bier in der Kantine kaufen und davon auch einen ausreichenden Vorrat im eigenen Spind bunkern.
Nach Tagen der Abstinenz ging es recht feucht-fröhlich zu und bis tief in die Nacht, lief aber für einige auch nicht ganz ohne Blessuren ab. Anderntags liefen wir nun im Hafen von Ponta Delgada, Hauptstadt von São Miguel und Hauptinsel der Azoren ein. Das Schaukeln und Schlingern war vorerst vorbei, die Übelkeit hatte sich wieder gelegt und mir ging es zunehmend besser. Endlich konnte ich richtig essen und wieder aufleben, sowie meiner normalen Beschäftigung an Bord nachgehen und meine Aufgaben erledigen.
Zuerst stand aber noch ein Empfang an Bord für geladene Gäste auf dem Programm und wir, die Mannschaft durften Kellner spielen und bedienen, nicht ohne selbst in den Genuss von ausgewählten Speisen und Getränken zu kommen. Die drei Smuts an Bord waren Berufsköche und in der Lebensmittellast stand zur Verfügung was das Herz begehrte. Das ermöglichte es ihnen erlesene Gerichte zu bereiten und das Essen an Bord war allgemein sehr gut. Darauf wurde und wird großen Wert gelegt, denn wenn das Essen nicht stimmen würde, entstünde schnell Frust und Ärger. Nach dem offiziellen Teil hatten wir drei freie Tage für Landgang (das Schiff verlassen). Die Freizeit musste wohl etwas eingeschränkt gesehen werden, denn die täglichen dienstlich notwendigen Verrichtungen waren schon Pflicht, und ich als Sanitäter hatte im Grunde rund um die Uhr Dienst, wenn ich an Bord anwesend war.
Den Aufenthalt im Hafen nütze ich zuallererst einen Arzt auf einem der begleiteten Zerstörer aufzusuchen. In jedem Verband fährt ein Schiff mit, das einen komplett eingerichteten Operationsraum aufweist und einen Arzt an Bord hat. Wichtig war, sämtliche Behandlungen mussten auch bei schwerer Erkrankten auf See sichergestellt sein. Damals war es noch nicht möglich mitten im Atlantik oder in den Weiten der Weltmeere Kranke oder Verletzte mit dem Hubschrauber zu holen und stationäre Hubschrauber an Bord hatten erst die später in Dienst gestellten Marineschiffe. Zu dieser Zeit wurde der Patient noch per „Highline“ dem Schiff mit Arzt übergeben und diesen Fall hatten wir unterwegs tatsächlich. Auf einem der anderen Schiffe ist ein Besatzungsmitglied an Appendizitis (Blindarmentzündung) erkrankt und wurde auf See operiert.
Der von mir aufgesuchte Arzt übergab mir wirksamere Tabletten, die mir fortan deutlich besser gegen Seekrankheit helfen sollten und die übergebene Menge reichte bis zum Einlaufen in Wilhelmshaven. Dort besorgte ich mir das Medikament im Materialdepot des Marine-Arsenals und übernahm die Tabletten in den eigenen Bestand des Depots. Wichtig war für einen wirksamen Schutz, ich musste fortan täglich eine Tablette einnehmen, auch ich im Urlaub zu Hause. Diese Vorsorge half mir aber tatsächlich mindestens bis zum Seegang der Stärke 6 und stärker erlebte ich während meiner restlichen, aktiven Marinezeit nur noch ein einziges Mal. Das war einige Monate später auf dem Weg von Kiel an der Ostsee in die Nordsee, wo uns ein schwerer Sturm im Skagerrak überraschte. In diesem Sturm ging übrigens in der Nordsee ein Fährschiff unter und über hundert Tote waren zu beklagen. Das Trossschiff Dithmarschen musste zum Schutz noch in der Nacht in Dänemark in einen Hafen einlaufen, da die die Krängung eine kritische Grenze überschritten hatte. Tags darauf war der Spuk vorbei und alles wieder gut. So ist eben sie See.
Mit dem Besuch der Azoren betrat ich zum ersten Mal im Leben, wenn ich von meinem Geburtsort im Elsass einmal absehen will, den Boden eines Landes im Ausland. Die Inselgruppe liegt weit draußen im Atlantik etwa 1400 Meilen vom europäischen Festland entfernt und ist portugiesisches Territorium. Die Inseln waren damals allgemein noch ein sehr exotisch-touristisches Ziel. Deutsche Urlauber gab es kaum und bekannt war der Archipel allenfalls aus den Wetterberichten unter dem Begriff: „Azorenhoch“. Die Häfen wurden überwiegend von Seglern oder Schiffen angelaufen, die vor der Weiterfahrt nach Süd- oder Nordamerika noch einmal Proviant und Treibstoff zu bunkern wollten.
In Ponta Delgada lagen die Bundeswehrschiffe drei Tage an der Pier. Der Hafen war nicht groß und vermutlich die Anlegemöglichkeiten für größere Schiffe begrenzt. Unser Liegeplatz befand sich deshalb in der zweiten Reihe, das bedeutete, wir mussten, wenn wir an Land wollten, über das Nachbarschiff hinweggehen und in unserem Falle teilten wir den Platz mit einem rostigen chinesischen Frachter. „Solche Situationen sind in ausländischen Häfen gerade bei größeren Schiffen nicht selten“, wurde uns gesagt. Manchmal liegen die Schiffe zu dritt und mehr nebeneinander und sind untereinander fest vertäut. Streng rechtlich gesehen betritt man beim Betreten des anderen Schiffes fremdes Hoheitsgebiet, geht aber allgemein kameradschaftlich miteinander um. Die chinesischen Seeleute luden uns sogar bei einer Heimkehr mitten in der Nacht noch freundschaftlich auf ein Bier ein, was wir nicht ablehnen konnten und sie hatten sogar Becks-Bier in Büchsen an Bord. Das erlaubte uns ohne Bedenken mit ihnen anzustoßen.
Ein gemeinsamer offizieller Ausflug ins Landesinnere gehörte noch mit zum Dienst-Programm. Etwas Kultur musste bei solchen Gelegenheiten auch dabei sein und ich hatte nichts dagegen, im Gegenteil, ich interessierte mich immer schon für Land und Leute und bei diesem Besuch war ich mir sicher, ich werde nie mehr im Leben eine solche Gelegenheit bekommen. Ein Bus mit deutschsprechender Reiseleitung brachte die abkömmliche Besatzung zu markanten Stellen mit vulkanischer Aktivität. Blubbernde, stinkende Schwefelquellen wechselten sich mit sattgrüner Landschaft ab. Die charmante Reisebegleiterin informierte uns wortgewandt über die Besonderheiten der Insel und des Archipels. Die Schwefelquellen zeugen noch immer von der fragilen Oberfläche und den nie ganz erloschenen vulkanischen Aktivitäten. „Die Inseln der Azoren sind eigentlich die aus dem Meer ragenden Spitzen von Vulkanbergen“, erfuhren wir.
Typisch für die Inselwelt im Atlantik war, es regnete immer wieder zwischendurch, Nebel zogen auf und hinderten die Sicht. Es war noch Februar und die Luft empfand ich als feucht und kühl, dabei war ich zuvor der Meinung, auf den Azoren herrscht nur schönes Wetter. Das Gegenteil ist der Fall, wurde uns gesagt. „Die Inseln des Archipels sind nur deshalb so grün, weil es oft und ergiebig regnet. Die Regenwolken vom westlichen Atlantik werden von den Bergen aufgehalten und regnen sich hier ab.“ Die wetterbestimmenden Strömungen driften weiter nach Norden und schwenken bei Island in eine Ostströmung, die uns in Westeuropa dann im günstigen Falle stabiles Hochdruckwetter bescheren; natürlich ein wenig laienhaft und vereinfacht dargestellt.
Das war die eine Seite, um ein ganz klein wenig die Insel und deren Schönheit in abwechslungsreicher Vegetation mit allerlei endemischen Arten kennenzulernen. Ohne Mühe bekamen wir auch schnell Kontakt zu einheimischen Jugendlichen und damit im weiteren Sinne auch zur Bevölkerung. Im Ausland war es für uns normal, ja man könnte auch obligatorisch sagen, dass wir in Marineuniform ausgingen. Das weckte immer Interesse und erleichterte uns Kontakte. Nicht selten wurden wir direkt angesprochen und kamen so schnell ins Gespräch. Sogar zu Marine-Angehörigen der gleichzeitig im Hafen liegenden portugiesischen Schiffe bekamen wir Matrosen Kontakt und, wie es üblich war, tauschten wir mit ihnen die Mützenbänder. Die seidenen Mützenbänder mit aufgesticktem Namen des Schiffes waren bei ihnen wie auch bei uns sehr begehrt und dienten als Souvenir.
Mit einem Taxi und einem privaten Auto begleiteten wir einheimische Jugendliche rund 30 Kilometer ins Landesinnere. Zuerst wollte man – wie sollte es anders sein? – Frauen suchen. Wenn wir es recht verstanden hatten, kannten die Einheimischen entsprechende Adressen im Ort, wohin sie mit uns gefahren wollten. Bei der Ankunft fanden sich aber nur Mütter, die ihre kleinen Kinder im Tragetuch mit sich führten. Das war nun nichts für die sex-hungrigen Mariner oder doch etwas zu exotisch. Schnell nahmen die Interessierten Abstand von ihrem ursprünglichen Plan und stattdessen war die glorreiche Idee geboren, einen Weinkeller aufzusuchen. Mir ist bis heute nicht klar, wem oder wessen Eltern eines der Jugendlichen dieser Keller gehört hatte, wir machten uns darum auch keine Gedanken, denn mehr die Gaudi stand im Vordergrund oder war Gruppendynamik war die Antriebsfeder? Im Gewölbe standen übermannshohe Weinfässer, nur es waren keine Zapfhähne. Da wussten sich die Burschen aber schnell zu helfen und bohrten kurzerhand in halber Höhe ein Loch ins Fass. Der Rotwein floss wie ein kleiner Brunnen, nur zwischendurch mit dem Daumen auf dem Loch gestoppt. Gläser hatten wir keine und brauchten sie auch nicht, stattdessen nahmen wir Blechbüchsen, füllten sie und tranken bis zum Abwinken. Für mich war es zum Glück etwas schummrig oder im Schein der Kerzen düster. Was ich nicht mehr trinken konnte, schüttete ich hinter mich und unbemerkt zwischen die Fässer, sonst wäre mir der Ausflug vermutlich schlecht bekommen. Ich hoffte nur, jemand das Loch wieder verstopft hatte, bevor wir den Keller verließen und das Fass nicht halb leer gelaufen ist. Es wäre doch zu schade um den guten Wein gewesen.
Die Inselgruppe der Azoren, wie auch Madeira, gehören zu Portugal und der „Escudos“ war noch das gültige Zahlungsmittel. Wenn wir Mariner in losen Gruppen durch die Straßen und Gassen promenierten, rannten uns schnell dreißig, vierzig Kinder hinterher und sie bettelten uns um Geld an. Die armen Tröpfe hatten nicht einmal Schuhe an den Füßen und erregten deshalb schon unser Mitleid. Mitte Februar ist es eigentlich auf den Azoren noch zu kühl, um barfuß zu laufen.
Wir bezahlten überall mit Scheinen und die Münzen waren uns nichts werte. Das Kleingeld machte in der Summe allenfalls Pfennige aus und die verteilten wir großzügig unter den Kindern. Blauäugig wie wir waren, dachten wir allerdings, die Kinder würden damit sich Brot kaufen. Nein, sie stürmten in das nächste kleinere Geschäfte und kauften Zigaretten, sogar die Kleineren, allenfalls sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein konnten. Im Laden konnten sie Zigaretten stückweise erwerben und die waren ihnen anscheinend wichtiger als Brot.
Mit Verwunderung oder Bewunderung über die Askese wurden wir Zeuge des auf dieser Insel tief verwurzelten Katholizismus. Jede Insel besitzt eine Hauptkirche, Zentralkirche oder Kathedrale, die meistens einem Heiligen oder noch häufiger der Jungfrau Maria gewidmet ist. Solche Wallfahrtskirchen sind mindestens einmal im Jahr das Ziel aller Gläubigen der Insel und damals nahm man den Kirchgang offensichtlich noch ernst.
Liegeplatz im Hafen von Ponta Delgada
Über einen endlos weiten Vorplatz bis zum Eingang der Kathedrale in Ponta Delgada führte eine Vortreppe nach oben. Während unserer Anwe-senheit traf gerade eine größere Schar an Pilger oder Wallfahrer ein. „Sie sind aus bis zu 20 Kilometer Entfernung im Laufschritt hierher geeilt“, hören wir von den Zu-schauern des Spektakels. Ihre Gang hatte etwas Ähnlichkeit mit der Echternacher Springpro-zession, wie sie in Luxemburg Tradition ist. Die Pilger rutschten dann vom untersten Treppen-absatz auf den Knien die abgestuften Treppen nach oben, den langen Weg zum Eingang und durchs Kirchenschiff bis vor den Altar, wo sie die Hostie in Empfang nahmen. Alleine der letzte Anschnitt durch das Kirchenschiff dürften 100 Meter gemessen haben und hinterher sahen wir blutende Knie.
Nach diesem rituellen Bußgang – dem sakralen Pflichtteil – zog kurze Zeit später die Pilgerschar geschlossen zum Rummelplatz und ging über den Jahrmarkt, der alles bot, was Vergnügen bereitet. Anscheinend ist es überall in der katholischen Welt gleich. Bei uns ist es die „Kirmes“ oder im Mittelbadischen die „Kilwi“. Zuerst kommt die Buße und dann wird ausgiebig und bis in den Morgen hinein oder bei manchen gar über Tage gefeiert. Das gehört dazu, wie das Gasthaus neben der Kirche, in dem unsere Altvorderen nach dem Gebet und Gottesdienst zum Frühschoppen einkehren mussten. Auf der Insel war es möglicherweise auch der Treffpunkt, wo man sich vielleicht nach längerer Zeit wieder einmal getroffen hatte, sich sah und dabei alle Neuigkeiten austauschen konnte.
Nach den erlebnisreichen Tagen mit kurzen Nächten und reichlich Alkohol und unglaublich vielen neuen Eindrücken wurden die Anker gelichtet; wir liefen aus und der Kurs führte uns nun weiter südwestlich in den Atlantik. Jetzt war die See war völlig ruhig und spiegelglatt, die Sonne stand fast senkrecht über uns. So ließ sich die Seefahrt deutlich besser aushalten und ertragen. Da störten gewisse Sonderaufgaben nicht, die andere und ich aus der Versorgungsmannschaft gelegentlich wahrnehmen mussten. „Potaken drehen“ (Kartoffel schälen), wie es im Marinejargon hieß, gehörte auf dem Achterdeck dazu.
Während der Konvoi immer weiter in Richtung Südamerika schipperte, erfreute wir uns Tag für Tag am spielerischen Schauspiel der uns begleitenden Schwärme Delphine, die offensichtlich Spaß hatten, im gleichen Tempo parallel dem Schiffe zu folgen. Sie sprangen hoch aus dem Wasser und tauchen danach elegant, manchmal sich um die eigene Achse drehend in die Fluten. Gleichzeitig überquerten fliegende Fische wie Tennisbälle oder Frisbee-Scheiben unser Schiff und tauchten auf der anderen Seite wieder elegant in die Wellen.
Nach Eintritt der Dunkelheit wurden die Schiffe an einem Wochenende über die Toppen geflaggt und mittels bunten Lampen beleuchtet. Musik über die Lautsprecher untermalte die laue Nacht. Die romantische Südseestimmung bot uns Tropen-Atmosphäre pur. Dabei feierten wir bis weit nach Mitternacht und nach reichlich genossenem Alkohol gab die Besatzung deckübergreifend – mehr grölend wie singend – Seemanns-lieder zum Besten, die weit aufs Meer hinaus hallten.
Schnell vergingen die Tage und schließlich hatten wir das Zielgebiet in den blauen Weiten des Atlantiks erreicht. Achtern wurde ein etwa 10 mal 10 Meter großes Floss mit metallischem Mastaufbau ausgesetzt und dann am langen Tampen im Schlepptau mitgeführt. Das bei langsamer Fahrt am voll ausgerollten Seil etwa vier Kilometer hinter dem Schiff hergezogene Floß diente den Zerstörern und Fregatten als Zielscheibe für ihre Schießübungen. Die feuernden Schiffe konnten wir nicht sehen, sie befanden sich über dem Horizont, nur auf der Brücke wurde per Radar beobachtet und registriert, ob das Ziel-Floß getroffen wurde oder nicht. Während dem Schießen war uns der Aufenthalt an Deck streng verboten; „das ist zu gefährlich“, ließ man uns glauben. Unser Schiff hatte aber keine vollständigen Durchgänge wie sie die Kriegsschiffe üblicherweise haben und dabei noch ABC-geschützt (Atom, Bakterien, Chemie) sind, und nahe dem Äquator wurde es im Schiffsinnern unangenehm warm. Da waren alle froh, wenn irgendwann nachmittags das Schießen eingestellt wurde und wieder nach Draußen durften und richtig durchlüften konnten.
Weitere Übungseinheiten folgten Schlag auf Schlag, wie „Mann über Bord“, „Wassereinbruch“, „ABC-Alarm“ und dergleichen, bis das volle Programm offensichtlich abgewickelt war. Die Mission hatte ihren Zweck erfüllt, nun ging es wieder in östlicher Richtung zurück. Unvorhergesehen oder Pech war allerdings, dass unser Schiff über das Schleppseil fuhr und es sich um die Schiffsschraube wickelte. Noch vor Ort mussten die mitfahrenden Bord-Taucher in die Tiefe und das Seil lösen. Die letzten störenden Reste wurden während einer kurzen Liegezeit im Hafen von Funchal auf Madeira entfernt.
3. Gran Canaria, eine Perle der Kanaren
Der Verband machte sich auf die Rückreise und wieder dauerte es Tage, bis die Kanarischen Inseln direkt voraus lagen und wir im Hafen von Las Palmas festmachten. Wir waren in der Hauptstadt von Gran Canaria, eine der Kanarischen Inseln. Zuerst gab es wieder einen offiziellen Empfang für geladene Ehrengäste und die Mannschaft durfte sie bedienen. Danach hatten wir drei Tage frei und auch hier gehörte wieder zuerst eine Inselbesichtigung mit Bus und Reisebegleitung zum offiziellen Besuchs-programm.
Wir kamen bei der Sightseeing-Tour auch in ein kleines Dorf das hoch oben und weit abseits in den Bergen lag und in denen noch Nachfahren der Ureinwohner leben sollen. Staunend durften wir die Frauen am großen Sandsteintrog versammelt beobachten, wo sie nach alter Väter Sitte im Brunnen mit fließendem Wasser ihre Wäsche wuschen. Entweder war es reine Nostalgie oder der Komfort einer Waschmaschine war noch nicht angekommen. Tatsache war aber, die Nachkommen der Guanchen führten noch ein karges, bescheidenes Leben und einige der Familien wohnten teils sogar noch in Höhlen. Vielleicht waren es die Letzten oder sie haben das aus reiner Folklore weiter gepflegt. Die angenehm kühlen Höhlen hatten mehrere Räume und waren einst tief ins weiche Gestein der Felsen gegraben worden. Immerhin gab es aber schon buntfarbige Tapeten, die von den Wohnungsinhabern einfach mit Nägeln an die Wände geheftet worden waren.
In der übrigen Zeit durften wir den Landgang frei gestalten und dabei wurde uns der Aufenthalt in Las Palmas zu einem unvergleichlichen, nachhaltigen Erlebnis. Wir konnten gar nicht alle Einladungen annehmen, die wir bekamen und wo wir hinkamen, wurden wir von deutschen Landsleuten angesprochen, eingeladen und großzügig bewirtet. Von den nächtlichen Gelagen konnten wir uns tagsüber am 3 Kilometer langen Playa de las Canteras, dem berühmten Sandstrand der Stadt erholen. Sehr erstaunte uns, wie heiß der Sand war in der Februarsonne sich anfühlte. Barfuß laufen war kaum möglich und wo wir das mussten, eilten wir schnellstens dem Wasser zu und kühlten die Fußsohlen.
Der Chef-Smut kaufte mit dem Wachtmeister (Verwalter) unterdessen für die Weiterfahrt exzellente Kanarische Kartoffeln ein, sowie reichlich der besonders aromatisch schmeckenden Tomaten und Zwiebeln. Gleichzeitig wurde zollfreier Treibstoff gebunkert und die Tanks gefüllt.
Noch waren es im Jahr 1966 überwiegend wohlhabende Deutsche, die zu den Kanarischen Inseln reisten und es gab nicht wenige, die eine exklusive Residenz in der Stadt oder an schönsten Plätzen mit bester Aussicht auf die Insel ihr Eigen nannten. Und selbst die wenigen Urlauber, die wir antrafen, zählten nicht zu den Massentouristen; die Inseln waren noch ein exotisches Ziel und wurden Anfang der 1970-Jahre als Traumziel entdeckt, nachdem bequemes und bezahlbares Reisen per Flugzeug möglich geworden war.
4. Madeira, die Blumeninsel im Atlantik
Ein letzter Stopp während der Rückreise wurde auf Funchal eingelegt, Hauptstadt der Blumeninsel Madeira. Die Stadt fügt sich eingebettet wie ein Amphitheater in den blauen Atlantik. Im Hintergrund sahen wir beeindruckende Berge und sattgrüne Hügel. Leider wurde uns hier keine Stadtführung oder Inselrundfahrt geboten und für ausgiebige Erkundungen in Eigenregie fehlte die Zeit. Der eigentliche Grund für das Einlaufen in den Hafen war eine erneut notwendige Inspektion oder Reparatur. Im Atlantik war – wie erwähnt – das Schiff versehentlich oder durch einen Navigationsfehler bei den Übungen über das Seil gefahren und das hatte sich um die Schiffsschraube gewickelt. Ein Teil wurde von den Kampftauchern schon am Unglücksort entfernt. Nun waren immer noch Reste vorhanden, die störten und beseitigt werden mussten. Die Kampftaucher hatten also noch einmal einen vollen, strapaziösen Einsatz, die dafür Besatzung einen Tag frei.
Nach der kurzen Liegezeit schipperten wir auf direktem Weg zurück in den Heimathafen. Diesmal war die Biskaya mir wohlgesonnen, war ruhig und harmlos. Mit 15 bis 18 Knoten passierten wir den Ärmelkanal und in der Ferne erkannten wir deutlich die engste Stelle, die beeindruckenden Kreidefelsen von Dover in der Grafschaft Kent und Calais auf der französischen Seite. Nach langen aber kurzweiligen sechs Wochen auf See kehrten wir nach Wilhelmshaven zurück und legten an der Pier an. Dafür war inzwischen aber höchste Zeit geworden, denn die Spannungen innerhalb der Besatzung hatten sich zunehmend und gefährlich vermehrt. Überall schien es zu knistern und es entstand der Eindruck, als wenn keiner mehr dem anderen sein Gesicht ertragen konnte. Vielleicht hatte das auch mit dem berühmt-berüchtigten Bordkoller zu tun. Auftretende Disharmonien, Stress, die nicht immer guten Gerüche und letztlich die Enge, das machte ein Zusammenleben auf Dauer immer schwerer.
Die letzte Etappe auf See dauerte neun Tage bis wir in Wilhelmshaven an der Pier angelegt hatten. Jetzt freuten wir uns alle, die nicht zum unverzichtbaren Wachdienst eingeteilt waren, nach den vielen Wochen auf See endlich nach Haus fahren zu dürfen. Über die Oster-Feiertage war Dienstbefreiung angesagt.
Hinterher erwartete uns Sanitäter allerdings eine böse Überraschung und jede Menge Arbeit. So gut wie die Hälfte der Schiffsbesatzung hatte sich im Rotlichtviertel von Las Palmas den Tripper geholt und das auch noch mit einem sehr hartnäckigen, resistenten Erreger. Die Betroffenen mussten wir in der Sanitätsstation langwierig kurieren, was etwa vier Wochen in Anspruch nahm, da das verabreichte Penicillin nur bedingt wirkte. Nebenbei hatten sie im Urlaub zu Hause auch noch ihre Frauen und Freundinnen infiziert und kleinere oder größere Krisen und Tragödien ausgelöst, aber das ist eine andere Geschichte.
3
1. Mit dem Schiff in Norwegen
Zurück aus dem Oster-Urlaub wurden kurz darauf erneut die Anker gelichtet. Wir sollten einen Flottenverband nach Norwegen begleiten und wieder erwartete uns ein neues Abenteuer. Erst aber passierten wir nach einer störungsfreien Fahrt mit etwa 15 Knoten durch die Nordsee und nicht zu starkem Seegang einen außerordentlich landschaftlich reizvollen Fjord auf dem Seeweg nach Bergen. Die kurzweilige Passage zog sich dahin, links und rechts des Fjords sahen wir senkrechte, hoch aufragenden Felswände, abwechselnd mit flachen Buchten und malerisch, bunten Holzhäusern längs den Ufern. Unser Zielpunkt war der Marinehafen Haakonsvern etwa 15 Kilometer außerhalb von Bergen und dieser galt zur damaligen Zeit als bedeutendster Marinehafen der Nato. Wie uns berichtet wurde, können mehrere Schiffe hintereinander in den Tunnel im Berg einfahren. Von außen werden die Schotten dicht gemacht und man sieht nichts mehr von ihnen. Wir hörten auch: „Im Innern sollen die Schiffe sogar vor Atombomben sicher sein.“
Zum Landgang wurden wir nach Bergen, der zweitgrößten Stadt in Norwegens, gefahren. Vollmundig wurde sie etwas verklärt: „Als Tor zum Reich der Fjorde“, beschrieben. Außer den gut erhaltenen Häusern für Handel, Gewerbe und Schifffahrt im Hafen und der Innenstadt, die zum Teil noch aus der Hansezeit stammen, sahen wir zu meinem Leidwesen nicht sehr viel von der weltoffenen Stadt. Und zu einer Fahrt mit der Bergbahn auf einen der Gipfel reichte es auch nicht. Stattdessen besuchten wir im Rudel die Kneipen und Lokale der Innenstadt oder im Hafenbereich. Dabei waren aber weniger als die Hälfte der Besatzung unterwegs, denn neben allen die Wache hatten, durften die von der Geschlechtskrankheit betroffenen Männer das Schiff nicht verlassen und mussten an Bord bleiben.
Für uns war es ein Kuriosum und Besonderheit, in Norwegen galt durfte kein Alkohol in den Lokalen ausgeschenkt werden. Wir bekamen zwar in den Bars ein einheimisches, dünnes Ale, ein Bier mit nur 1 % Alkoholgehalt, was so gar nicht nach unserem Geschmack war. Je mehr wir davon getrunken haben, desto nüchterner wurden wir und umso häufiger war der Drang zur Toilette. Wir lösten das kleinere Problem pragmatisch auf unsere Weise. Bei uns an Bord gab es zollfreien Alkohol und nun kaufte jeder von uns vor dem Landgang eine Flasche Whiskey, Cognac oder Gin und die verbargen wir in der Uniformjacke. Mit diesem Mitbringsel gewappnet gingen wir in ein Lokal, wo wir am Tisch nur Cola bestellten. Diese mischten oder verfeinert wir nun mit dem eigenen Getränk.
Im Hafen von Haakonsvern
Einige nette und lebenslustige Norwegerinnen bekamen das schnell mit oder vielleicht hat man es ihnen auch verraten und sie so an unsere Tische gelockt. Da blieb nicht aus, dass wir in kurzer Zeit von hübschen, unkomplizierten Mädchen umzingelt waren, die uns gerne Gesellschaft leisteten. Die Norwegerinnen waren für ihre Natürlichkeit bekannt, ihre ungezwungene, freizügige Art und Offenheit; alles selbstverständlich im anständigen Rahmen. Sie waren einfach nett, gesellig und unterhaltsam, nicht so kompliziert, wie manche jugendlichen Frauen bei uns im Süden. Die Verständigung gestaltete sich auch wenig kompliziert, denn überwiegend alle Jugendlichen sprachen perfekt Englisch und nicht wenige sogar Deutsch. Wir konnten uns des Eindrucks nicht erwehren, dass die Norweger ein sehr sprachbegabtes Volk sind.
Der Besuch in Bergen dauerte mehrere Tage, dann legten wir wieder ab und bald hatten wir die offene Nordsee erreicht. Die weitere Rückreise verlief dann nicht ohne Komplikation. Einer der Unteroffiziere eines der anderen Schiffe hatte zu viel „gebechert“ und ging unglücklicherweise in der Dunkelheit über Bord. Die anschließende Suche nach dem Verunglückten, an denen sich alle Schiffe des Verbandes beteiligen mussten, wurde nach 24 Stunden erfolglos eingestellt. Der Mann wurde nicht gefunden und hatte im kalten Wasser der rauen Nordsee auch nicht ein oder zwei Stunden eine Überlebens-Chance.
2. Zweite Schiffsreise nach Norwegen
Der letzte Septembertag rückte näher und damit auch das offizielle Ende meiner Dienstzeit. Im Sommer ergab sich aber eine sehr interessante und lukrative Möglichkeit zu einer weiteren und längeren Auslandsfahrt. Es sollten mehrere Zerstörer der sogenannten „Fletscher-Klasse“ in einer Werft in Norfolk (USA) generalüberholt und modernisiert werden. Der für die amerikanische Marine bedeutendste Ort liegt an der Ostküste der USA und galt seinerzeit als größter Marinehafen der US-Navy.
Geplant war, dass die Reise und der Aufenthalt etwas über drei Monate sein sollte und überschritt damit mindestens einen Monat meine reguläre Dienstzeit. Diese einmalige Chance wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen, denn wer kam damals schon einfach so nach Amerika? Das Problem war auch schnell gelöst. Ich beantrage eine Dienstzeitverlängerung als erste Reserveübung und das wurde auch genehmigt.
Die Auslandsfahrt einschließlich der drei Monate Aufenthalt in Amerika hätten mir zum Wehrsold stattliche Zulagen eingebracht. Neben dem regulären Salär und der üblichen Bordzulage, gab es bei der Fahrt ab der Linie Dover - Calais im Ärmelkanal die doppelte Bordzulage – ich erwähnte es schon – und die Gesamtsumme sollte in Amerika in Dollar ausbezahlt werden. Der Kurs lag Mitte 1966 im Durchschnitt noch bei 4,20 Mark je Dollar. Für den Auslandsaufenthalt hätte ich auf diese Weise gut und gerne rund 3500 Mark extra ausbezahlt bekommen. Mit dieser Summe konnte man damals noch einen VW-Käfer kaufen und davon träumte ich. Andererseits hätten wir das Geld auch für den Hausstand und die nötigen Anschaffungen gut gebrauchen können.
Andere Besatzungsmitglieder, die zuvor schon einmal mit der Marine in Amerika waren, schwärmten von der überwältigenden Gastfreundschaft deutscher Familien im Seehafen. Während der Liegezeit wurden sie Tag für Tag – und manche auch über mehrere Tage – eingeladen. Wer nicht zum Wachdienst eingeteilt war, konnte Urlaub einreichen und verbrauchte während der Zeit keinen Pfennig. Hinterher wurde zudem noch die Erstattung von Verpflegungsgeld für die Abwesenheitstage beantragt, was zusätzliche Dollars einbrachte, für die Souvenirs gekauft wurden, wenn man die Ausgaben nicht auch noch sparen wollte.
Leider geriet – und für uns an alle an Bord völlig überraschend – die Wirtschaft der Bundesrepublik im Sommer 1966 in eine erste Rezession und schwächelte. Bisher war seit der Währungsreform Westdeutschland mit stetig steigenden Wachstumsraten verwöhnt. Nun wurden im Zuge staatlichen Sparmaßnahmen die zugebilligten Gelder der Marine gestrichen oder gekürzt und der Amerikatrip fiel ins Wasser. Die Vorbereitungen waren aber schon angelaufen. Schon anfangs des Sommers lagen wir mit dem Schiff sechs Wochen in einer Hamburger Werft. In dieser Zeit wurden Modernisierungsmaßnahmen im und an dem Schiff vorgenommen und speziell moderne Seegang-Windschen installiert. Sie sollten fortan den Seeleuten das „Highline“ fahren erleichtern. Die neuen Windschen passten sich elektronisch gesteuert dem Seegang und dadurch wechselnden Abständen der Schiffe an.
Nach der Montage dieser Einrichtung folgten notwendige Tests und Übungen und dazu fuhren wir mehrere Tage lang durch die Ostsee. Das denkwürdige Endspiel der deutschen Fußballmannschaft gegen England verfolgten wir auf Reede in der Eckernfördener Bucht und abschließend kehrte das Schiff durch den Skagerrak, wo uns der schon erwähnte Sturm Schwierigkeiten machte, nach Wilhelmshaven zurück. Kurz darauf wurden wir noch einmal nach Norwegen beordert und ein Konvoi aus mehreren Schiffen bestehend, steuerte im Sommer die Hafenstadt Kristiansand an. Diese norwegische Großstadt liegt im Süden des Landes, direkt an der Meerenge des Skagerraks. Uns ist nicht verborgen geblieben, dass seit dem Zweiten Krieg noch sehr viele negative Ressentiments im Land vorherrschten, wir wurden aber überall freundlich aufgenommen.
Die Hafenstadt war eine der ersten, die durch die deutsche Wehrmacht eingenommen worden war und die Organisation Todt ließ hier eine massive Festung errichten. Das wirkte immer noch negativ in der Bevölkerung nach. Uns hat man aber als Marineangehörige nicht angefeindet. Im Gegenteil, es ergaben sich schöne Kontakte mit der Bevölkerung und positive Gespräche, wenn wir in den besuchten Lokalen auf Einheimische trafen, die mit uns ins Gespräch kamen. Dabei wurde uns auch da und dort großzügig ein „dünnes“ Bier spendiert und von uns wanderten einige Päckchen Zigaretten als unsere Geschenke über den Tisch, die wir verbilligt in der Zolllast des Schiffes kaufen konnten.
Mein Eindruck von Norwegen war sehr positiv und ich hatte mir vorgenommen, einmal eventuell mit einem Wohnmobil über ein paar Wochen das Land von Süd nach Nord zu durchfahren oder mit einem Schiff der „Hurtigruten“ an Nordkap zu gelangen. Es ist leider nichts mehr daraus geworden.