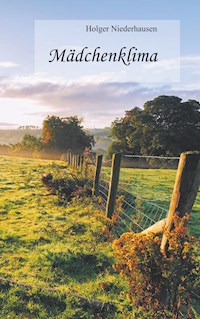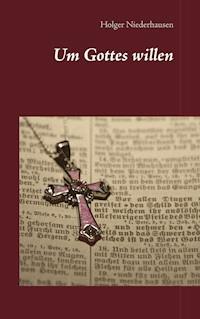
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die sechzehnjährige Juliane führt ein tief religiöses Leben. Als sie eine weitreichende Entscheidung trifft, ist sie dem Spott und der Verfolgung ihrer Umgebung ausgesetzt, die sie bereitwillig erduldet. Dann lernt sie einen Jungen kennen, aber ihr Glück ist nur von kurzer Dauer und wird von neuem Leid abgelöst. Doch wieviel kann eine reine Seele ertragen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Menschenwesen hat eine tiefe Sehnsucht nach dem Schönen, Wahren und Guten. Diese kann von vielem anderen verschüttet worden sein, aber sie ist da. Und seine andere Sehnsucht ist, auch die eigene Seele zu einer Trägerin dessen zu entwickeln, wonach sich das Menschenwesen so sehnt.
Diese zweifache Sehnsucht wollen meine Bücher berühren, wieder bewusst machen, und dazu beitragen, dass sie stark und lebendig werden kann. Was die Seele empfindet und wirklich erstrebt, das ist ihr Wesen. Der Mensch kann ihr Wesen in etwas unendlich Schönes verwandeln, wenn er beginnt, seiner tiefsten Sehnsucht wahrhaftig zu folgen...
Sie kniete in der Kirchenbank und hatte die Hände gefaltet. Ihr Kopf lag auf den betenden Händen, und angestrengt versuchte sie, innig an Gott zu denken.
Auch als schließlich ihre Knie zu schmerzen begannen, hielt sie weiter aus. Immer weiter...
Als es nicht mehr ging, blickte sie noch einmal lange auf das Kreuz auf dem Altar, dann setzte sie sich ... und blickte von neuem innig das Kreuz an.
Sehnsucht war es, was sie fühlte. Sehnsucht und Hingabe... Nach einer sehr langen Zeit stand sie auf, hielt die Hände noch immer andächtig gefaltet und ging langsam in Richtung Ausgang.
Vorsichtig schloss sie die Kirchentür. Dann ging sie tief erfüllt und froh wieder den üblichen Kilometer auf der um diese Tageszeit kaum befahrenen Straße, bis sie bei dem Ferienhäuschen ankam. Leise ging sie auf ihr Zimmer und legte sich noch einmal still in ihr Bett.
Wie so oft in den Jahren zuvor, war sie noch einmal eingeschlafen und erwachte, als auch ihre Eltern aufstanden. Sie deckte den Frühstückstisch, kochte Kaffee und freute sich, mit ihren Eltern auf der Terrasse sitzen zu können. Zwei schöne Ferienwochen lagen vor ihnen...
Beim Frühstück fragte ihr Vater:
„Na, Juliane, bist du heute tatsächlich wieder um sechs aufgestanden und in die Kirche gegangen?“
„Ja, zwanzig nach sechs...“
„Aber du hättest doch wenigstens heute einmal ausschlafen können. Es sind doch wirklich nicht einmal zwölf Stunden vergangen, seit du gestern Abend da warst!“
Das stimmte. Sie war, als sie gestern Abend angekommen waren, als erstes ebenfalls zur Kirche gegangen.
„Das war gestern“, sagte sie sanft.
„Ja, ich weiß“, erwiderte ihr Vater. „Du willst hier jeden Tag in die Kirche gehen. Und das schon, seit du zwölf bist. Ich wundere mich nur, wie du das durchhältst. Damals hast du immerhin noch den einen oder anderen Tag ausgelassen, weil du zum Beispiel verschlafen hattest. Ich hätte nie gedacht, dass das länger als ein, zwei Jahre anhält. Aber nun bist du sechzehn – wo soll das nur hinführen? Zum Glück machst du das nur hier im Urlaub...“
Auch das stimmte – die Kirche hier in den Bergen war etwas Besonderes, und außerdem war sie immer offen, ganz im Gegensatz zu den Kirchen in ihrer Heimatstadt. Aber die Worte ihres Vaters hatten ihr wehgetan. Sie verstand nicht, was so schlimm daran war, an Gott zu glauben, und wie man in dieser Weise darüber sprechen konnte. Immer wieder hoffte sie, dass das Gespräch nicht diesen Verlauf nahm, und wie so oft schwieg sie hierzu...
Ihrem Vater war dieses Schweigen immer sehr unangenehm, spürte er dadurch doch stets sehr genau, was er angerichtet hatte. Diesmal entschloss er sich jedoch zur Flucht nach vorn, im Grunde wider besseres Wissen, und beharrte:
„Nein, Juliane, wirklich – was ist denn eigentlich der Sinn des Ganzen?“
Traurig und verletzt sah sie ihren Vater an.
„Der Sinn des Ganzen ist, dass ... Gott mir einfach wichtig ist.“
Mit den ausgesprochenen Worten war sie unmittelbar tief unzufrieden, sie hörten sich überhaupt nicht mehr so an, wie sie es innerlich fühlte. Gesprochen klang es so armselig...
„Was heißt ‚wichtig’? Was machst du in der Kirche eigentlich überhaupt?“
„Gerd, lass sie doch!“, warf nun ihre Mutter ein. Dankbar schwieg sie und barg sich im Schatten der mütterlichen Worte...
Doch ihr Vater entfloh dem drohenden Unrecht, indem er weiter auf seinen Fragen beharrte.
„Es kann doch nicht so schwer sein, darauf zu antworten! Wenn es ihr so wichtig ist, kann sie doch sicher auch dazu stehen. Außerdem meine ich es doch überhaupt nicht böse. Ich will nur wissen, was sie da in der Kirche eigentlich wirklich macht!“
Noch immer barg sie sich im Schutz der Mutter und schaute ihren Vater an. Dieser schaute sie an, und sie sah, dass er wartete. Da sagte sie schließlich:
„Ich bete.“
„Und was betest du?“
„Ich versuche zu beten.“
„Ja, aber was denn?“
Unglücklich mit dem ganzen Verlauf, der ihre intimsten Erlebnisse an eine Oberfläche zerrte, auf der sie sowieso nicht verstanden werden würde, sagte sie wahrheitsgemäß:
„Ich denke einfach an Gott...“
„Das ist doch kein Beten“, erwiderte ihr Vater. „Und warum brauchst du dazu eine Kirche?“
Diese Fragen hatte sie sich selbst oft genug mehr oder weniger deutlich gestellt. Doch obwohl sie darauf keine endgültige Antwort hatte, war eine Kirche sehr wohl etwas Besonderes, und war ihr morgendlicher Gang zur Kirche eine Art Opfer, das sie sehr gern bringen wollte.
„Man betet doch in einer Kirche. Warum soll ich nicht hingehen dürfen?“
„Du darfst ja. Ich verstehe nur nicht, wozu man Kirchen überhaupt braucht. Entweder man glaubt überall an Gott oder nirgends.“
„Ja“, erwiderte sie, „aber du glaubst ja sowieso nirgends an Gott. Manches verstehst du einfach nicht...“
In diesen Worten lag ihr ganzer Schmerz, und doch tat er dies nur in einer ungeheuren Sanftheit, sie wollte ihren Vater keineswegs verletzen.
Ihr Vater jedoch musste weiter darauf beharren, dass alles Unverständnis seinerseits seine volle Berechtigung hatte, und erwiderte:
„Richtig – und ich finde, es ist auch nicht zu verstehen, wenn man jeden Tag früh aufsteht, kilometerweit zu einer Kirche geht, um dort an Gott zu denken, wenn man das auch bequem da tun könnte, wo man gerade ist.“
„Vielleicht will man es einfach nicht bequem tun“, erwiderte sie, während der Schmerz in ihrem Herzen wie ein sanfter Strom dahinfloss.
„Meinetwegen nicht bequem“, gestand der Vater ein, „aber wozu eine Kirche?“
„Weil eine Kirche etwas Heiliges ist.“
„Sie ist auch nur von Menschen gebaut.“
„Gerd“, mischte sich von neuem die Mutter ein, „was soll das jetzt eigentlich?“
Sie wollte nicht, dass sich nun auch noch ihre Eltern zu streiten begannen, und erwiderte ihrem Vater:
„Für etwas Heiliges. Damit man darin betet...“
„Ja – damit die Kirche Macht über ihre Schäfchen hat!“, entgegnete ihr Vater.
„Gerd!“, erwiderte seine Frau scharf. „Nun mach aber mal einen Punkt! Über Juliane hat keine Kirche Macht – sie betet ganz für sich allein, und das weißt du sehr gut!“
„Mag sein“, reagierte ihr Vater unmittelbar, „aber wer weiß, wo das noch hinführt! Wer weiß, welcher Kirche oder –“, er unterbrach sich, „wem auch immer sie sich noch anschließen wird. Religion ist ein Gebiet mit tausend Irrwegen – und das weißt auch du sehr gut!“
Todunglücklich über den Streit verteidigte sie sich:
„Ohne Religion gibt es nur Irrwege!“
Auch diese Worte klangen gesprochen unmittelbar anders, als sie sie innerlich empfunden und gemeint hatte – und ihr Vater ließ es sich nicht nehmen, sie als neuerliche Kampfansage zu erwidern:
„Oho! Siehst du, Angelika, da hast du es – ‚Ohne Religion gibt es nur Irrwege’! Deine Tochter...!“
„Du hast sie dazu provoziert.“
„Egal, sie hat es gesagt.“
„Was ist denn daran schlimm!?“, fragte sie nun verzweifelt.
„Das ist eben meine Meinung.“
„Schlimm ist daran, liebe Tochter“, wandte sich ihr Vater nun in recht scharfem Ton an sie, „dass solche Worte eins zu eins von einem Fanatiker stammen könnten, der alle Menschen am liebsten mit Gewalt bekehren würde.“
In tiefstem Schmerz sah sie ihren Vater an und sagte mit unschuldiger Heftigkeit:
„Ich möchte nur das tun dürfen, was ich tue, ohne mit Gewalt auf Fragen antworten zu müssen, weil man es nicht versteht...“
„Und das ist ihr gutes Recht!“, unterstrich ihre Mutter.
Hätte die Unschuld der Tochter den Vater vielleicht besänftigt, so sah er in den Worten der Mutter eine erneute Provokation. Scharf blickte er seine Frau an und sagte in ähnlicher Schärfe:
„Du wirst schon noch einmal sehen, wo das hinführt!“
Diese letzte Bemerkung hinterließ endgültig einen Scherbenhaufen. Vor diesen Worten war sie noch vollkommen bereit gewesen, wenn auch in großem Schmerz, so doch dennoch irgendwie mit dem eigentlichen Frühstück wieder eine Gemeinsamkeit zu finden. Doch nun war es ihr, wie wenn diese letzten Worte ihres Vaters jegliche Brücke abgebrochen hätten – sie fand einfach keine Brücke mehr, um im Schatten dieser düsteren Drohung ein Frühstück zu beginnen, das eigentlich ganz von der Harmonie des ersten Urlaubstages durchdrungen gewesen sein sollte.
Mit einem Gefühl von Schuld und dennoch unfähig, sitzen zu bleiben, stand sie langsam auf, stellte noch behutsam ihren Stuhl wieder an den Tisch und verließ die Terrasse.
Traurig und aufgewühlt ging sie auf ihr Zimmer und setzte sich auf das Bett.
Von dort blickte sie die Tür, die sie eben hinter sich geschlossen hatte, an und fragte sich, was sie falsch machte und warum sie sich immer wieder verteidigen musste.
Unten auf der Terrasse hörte sie ihre Eltern streiten, und dies schmerzte sie noch mehr als alles zuvor. Ihre Qual und ihre Selbstzweifel wurden so groß, dass sie keinen einzigen Gedanken mehr fassen konnte. In tiefster Traurigkeit starrte sie wie erschlagen auf die Tür ... bis diese sich plötzlich öffnete.
Ihr Vater kam herein.
Im ersten Moment fast erschrocken, dann nur noch tief traurig, sah sie ihn einfach nur an.
Etwas verlegen sagte ihr Vater nun, hastig ansetzend:
„Na ja, ich ... war etwas ... komm doch einfach wieder runter, Juliane.“
Sie kannte es nicht anders. Sie war es gewohnt, dass ihr Vater sich nicht entschuldigen konnte. Das, was er eben gesagt hatte, war für ihn bereits die größte Entschuldigung – und ihr nahmen diese wenigen Worte bereits fast die ganze Last von der Seele, die die vergangenen Minuten aufgehäuft hatten. Fast – denn das Wissen um das Unverständnis des Vaters blieb eine fortdauernde Last, die mit jedem Erlebnis dieser Art größer wurde...
Dennoch sah sie ihn dankbar an und folgte ihm wieder nach unten, und ihr Herz war ohne jeden Vorwurf...
Als sie am nächsten Morgen wieder um kurz nach sechs dem Nachbarort entgegenging, dachte sie an die gestrige Auseinandersetzung. Sie verstand einfach nicht, wie ihr Vater Angst vor Fanatismus haben konnte. Ihr war völlig klar, dass sie einen einsamen Weg ging, den niemand mit ihr teilte. Sie wusste auch sehr genau, was ‚Sekten’ waren, und suchte absolut keinerlei Anschluss an solche Erscheinungen. Sie konnte genauso klar denken, wie jedes andere sechzehnjährige Mädchen – auch wenn sie völlig anders war als jedes andere Mädchen in ihrem Alter.
Hatte ihr Vater das eigentlich schon einmal bemerkt? Dass andere Mädchen mit sechzehn Jahren längst ihre eigenen Wege gingen? Völlig eigene Wege? Dass sie mit ihren Eltern oft nichts mehr anfangen konnten, oft nicht einmal mehr mit ihnen redeten, jedenfalls nicht mehr als nötig – und schon gar nicht mehr mit ihnen in den Urlaub fuhren? War das alles für ihn selbstverständlich? Oft hatte sie dieses Gefühl: dass es dafür keinerlei Anerkennung gab; dagegen aber immer wieder diese schmerzlichen Fragen, die sie jedes Mal wieder fühlen ließen, dass ihr Vater in ihre Urteilskraft keinerlei Vertrauen zu haben schien. Und das – dieses scheinbar absolut fehlende Vertrauen – war es, was so unendlich weh tat...
Es war sogar ein doppelter Schmerz. Ihr selbst tat er weh – und dann tat er nochmals weh, weil in jeder dieser Bemerkungen Gott selbst als etwas Minderwertiges, Gefährliches hingestellt wurde. Denn um Gott ging es ja gerade. Wenn das Religiöse nichts weiter als eine ‚suspekte Sache’ war, dann galt das Gleiche für Gott.
Das Schlimmste war die Selbstverständlichkeit, mit der Menschen über so etwas sprachen – nicht nur ihr Vater, auch wenn es aus seinem Munde natürlich noch mehr weh tat. Aber wie kamen Menschen dazu, über das Religiöse so selbstverständlich und so abfällig zu urteilen? Dieses Abfällige war eigentlich noch schlimmer als das fehlende Vertrauen. Denn es war eigentlich die Behauptung: Ich weiß, dass Religion Unsinn ist! Dann konnte man einem religiösen Menschen ja gar nicht vertrauen – denn dann war jeder Mensch, der religiös sein wollte, ein Irrender, und ja, sehr schnell sah man die Irrenden dann wirklich als Irre an! Im Grunde also war das, was sie als mangelndes Vertrauen empfand, das Ergebnis der Tatsache, dass ihr Vater alles Religiöse wirklich für Unsinn hielt – für einen Unsinn, der im besten Fall einfach nur Unsinn war, im schlimmsten Fall eine gefährlich werdende Verrücktheit.
Es war eigentlich furchtbar, dass Menschen so dachten. Sie verstand es einfach nicht. Aber sie wusste, dass die meisten Menschen mehr oder weniger so dachten. Jeder, dem Religion nicht wichtig war, hielt sie doch letztlich für einen Aberglauben – oder zumindest interessierte ihn Gott nicht. Für sie war das unfassbar. Wenn Gott das Höchste und Heiligste war, wie konnte man dann einfach daran vorbeigehen, vorbeisprechen, vorbeileben? Wie konnte man die ganze Zeit so leben, als gäbe es Gott nicht?
Sie verstand zwar, dass das möglich war, aber ihr selbst erschien dies wie ein Leben ohne Sinn – ja mehr noch, man stellte sich doch unmittelbar gegen Gott. Man lebte ganz bewusst ohne Gott – und das war nichts anderes als gegen Gott. Wenn es aber Gott für einen gab; wenn man an ihn glaubte; wenn man sicher war, dass es Gott gab, dann wollte man doch auch in jedem Moment ein frommer Mensch sein!
Es war doch überhaupt nicht so, wie ihr Vater sagte. Sie ging doch gar nicht in die Kirche, weil sie sonst nicht an Gott dachte. Eigentlich war es genau umgekehrt. Sie dachte immer an Gott – und ging deswegen jeden Morgen in die Kirche. Weil es in der Kirche noch religiöser war, weil dies gerade der heilige Ort war. Weil hier nicht nur der Mensch betete, sondern der ganze Ort...
Sie lächelte bei diesem Gedanken. Ein betender Ort... Aber so war es doch! Jeder einzelne Stein einer Kirche war heilig. Die ganze Kirche wusste sehr genau, wer Gott war – und einem Stein, der zu einer Kirche gehörte, würde es nie einfallen, sich zu sagen, Gott sei ihm egal oder Gott gebe es nicht. Der Stein betete fortwährend, und er wusste immer, dass es Gott gab! Eine Kirche war also heilig, weil sie selbst betete, egal, ob Menschen in ihr waren oder nicht.
Ein Mensch, der also in eine Kirche trat, trat in eine Art heiligen Schutz – denn er trat in ein Gebäude, das Gott kannte und zu Gott betete und Gott heiligte. Der Mensch brauchte nur niederknien und mitbeten...
Mit solchen Gedanken war sie bei der Kirche angekommen. Sie öffnete die Tür und betrat das schweigende Gebäude. Sie liebte die großen Türen und die großen, alten Türklinken. Dann kam man in einen Vorraum. Die eine große Tür schloss man hinter sich... Und nun musste man noch einmal eine Tür öffnen. Man ging auch hier hinein – und jetzt war man wirklich in dem eigentlichen heiligen Raum.
Andächtig faltete sie wieder die Hände, blickte mit Ehrfurcht auf den Altar mit dem Kreuz und ging langsam den Gang entlang, bis sie wieder bei der fünften oder sechsten Bankreihe angekommen war. Diesmal setzte sie sich zuerst und verweilte einen Moment. Dann kniete sie nieder, in derselben Haltung wie am Morgen zuvor, und wandte wieder all ihre Gedanken und Gefühle zu Gott.
Voller Hingabe öffnete sie ihr Herz, flüchtete sich gleichsam in Gottes Schutz, in dem sie aber schon war, und empfand in tiefstem Glück die einzigartige Atmosphäre einer Kirche, eines heiligen Gotteshauses an einem frühen Morgen... Und all dieses Glück gab sie wiederum hin – ihr ganzes Glück und ihren ganzen guten Willen, alles ließ sie hinströmen zu Ihm...
Und auch diesmal hatte sie wieder lange ausgehalten, als ihre Knie zu schmerzen begannen. Dann hatte sie sich schließlich hingesetzt und lange auf das Kreuz geblickt. So saß sie nun noch immer.
Langsam ließ sie nun die innige Andacht ausklingen und kehrte behutsam zu dem gewöhnlicheren Denken zurück. Was für ein Friede in so einem stillen Kirchenraum lebte...
Hier war man völlig abgeschlossen von Streit, von Verletzung, von allem Gewöhnlichen, Gemeinen, hier hinein drang kein böser Wille, nicht einmal eine Unbedachtsamkeit. Nur der reine, der heilige Friede lebte hier. Es war eigentlich wie ein Paradies, wie ein wirkliches Paradies. Wenn das, was hier drin war, auch draußen sein würde...
Wenn man mit der Sanftheit, mit der man zu Gott betete und sich zu Ihm wandte, auch den übrigen Menschen begegnen würde. Wenn man ihnen gegenüber auch mit einem so heiligen Gefühl... Aber die meisten Menschen kannten dieses Gefühl ja überhaupt nicht. Sie beteten nicht zu Gott, und sie wandten sich nicht zu ihm. Sie kannten es nicht, dieses Gefühl. Sie kannten diesen unendlichen Frieden nicht. Und sie kannten dieses heilige Innere einer Kirche nicht – nicht an einem frühen Morgen, nicht mit der eigenen heiligen Hingabe eines frühen Morgens, eines frommen, Gott suchenden Herzens...
Wieder blickte sie lange auf das Kreuz. Da hing Er, der Erlöser, gestorben für alle Menschen. Und keiner nahm dies mehr ernst. Sie konnte das nicht verstehen. Wie konnte man einfach so leben und... Wie konnte überhaupt die ganze Welt einfach so weitergehen und immer weniger fromm sein? Wie konnte die ganze Welt unfromm, unheilig, unsehnsuchtsvoll sein ... und es auf der anderen Seite Gott geben? Wie ging das? Musste Gott sich nicht unendlich einsam fühlen? Und Christus? Als wenn Er umsonst gestorben wäre? Die Welt ging an Gott vorbei. Sie lebte jeden Tag ohne Gott – Tag für Tag ... für Tag...
Diese Vorstellung erfüllte auf einmal ihre ganze Seele. Eine furchtbare Vorstellung einer jeden Tag und jeden Augenblick an Gott vorbeigehenden Welt – einer Welt, die sich fern, unendlich fern von Gott abspielte. Einer Welt, die leer und sinnlos war, weil sie ja Gott nicht hatte. Leer und sinnlos ... und verloren, denn sie hatte Gott vergessen.
Sie hatte auf einmal Angst. Was geschah mit einer Welt, die Gott so vollständig vergaß und missachtete? Sie wollte in so einer Welt nicht leben – aber sie tat es schon. Aber wenn man sich dies überlegte ... all die Menschen, die nichts von Gott wissen wollten, und sie alle zusammen waren die Welt ... eine Welt von Menschen, die alle nichts von Gott wissen wollten. Dies war die Welt! Aber sie war so kalt wie Eis. So tot wie Plastik. So verloren wie die unentrinnbarste Tiefe. Was war eine Welt ohne Gott? Es war die Hölle. Ein reiner Ort des Schreckens, der Sinnlosigkeit, der absoluten Verzweiflung...
Ohne Gott hatte nichts einen Sinn. Aber das unendlich Furchtbare war, dass sie dies keinem einzigen Menschen erklären konnte, erlebbar machen konnte. Ihr Gefühl, ihre Erkenntnis – alles war wie in ihr gefangen, sie konnte es keinem einzigen Menschen weitergeben. Und die Welt ging weiter, wie sie war; die Menschen lebten weiter, wie sie waren. Und keiner dachte an Gott. Und keiner fühlte, wie wichtig Gott war. Wie es ohne Ihn gar keinen Sinn gab. Die Welt ging einfach weiter – ohne Sinn, und keiner merkte es...
Bestürzt wandte sie ihren Blick wieder dem Kreuz zu, fast flehend. Doch der Erlöser hing nur da, unbeweglich. Hier, in der Kirche, lebte der ganze Friede Gottes. Doch dort draußen, gleich hinter den Mauern dieses heiligen Baues, kannte man Gott bereits nicht mehr, lebte man ohne Ihn – aber was war das dann für ein Leben...?
Aber sie musste ja wieder hinaus. Der Tag erhob sich. Bald würden ihre Eltern aufstehen. Sie wollten heute gemeinsam auf einen der umliegenden Berggipfel hinaufwandern.
Bestürzt stand sie auf. Eine neue Traurigkeit lag auf ihrer Seele. Sie hatte ähnliche Fragen schon oft empfunden, aber in dieser Intensität hatte sie sie dennoch noch nie erlebt. Mit dieser Traurigkeit blickte sie, bevor sie die Tür zum Vorraum wieder öffnete, noch einmal zurück zum Altar. Mit dieser Traurigkeit trat sie hinaus in die strahlende Morgensonne, und machte sie sich auf den Rückweg...
*
An diesem Tag versuchte sie um so stärker, ihren Eltern keinen Grund für irgendwelche Nachfragen zu geben, ihrem Vater keinen Anlass zu einer Bemerkung zu bieten. Sie wollte mit dem, was sie innerlich empfand und womit sie kämpfte, ganz und gar allein sein. Ihre Eltern verstanden es ohnehin nicht – und sie verstand es auch noch nicht, hatte zumindest nichts in der Hand, was sie nach außen vertreten konnte. Nichts außer ihre neue, gewachsene Verzweiflung und Ratlosigkeit...
Es gelang ihr sehr gut, während der Wanderung, während der Pausen und der Gespräche die liebe und unbeschwerte Tochter zu spielen – und nicht nur zu spielen, denn dies war sie auch. Diese Seite hatte sie auch – den unbedingten Willen zu einer Harmonie untereinander, selbst dann noch, wenn ihr gar nicht danach zumute war.
Aber auch dies war etwas, was mit der Sehnsucht nach Gott und mit Gottes Willen zu tun hatte. Abweisung und ein Sich- Zurückziehen war nicht das Richtige. Allen Kummer musste man sich für Gott aufheben. Die Menschen verstanden ihn sowieso nicht. Aber dann musste man eben still allein leiden, mitten im „Normalsein“...
Dieses einsame Leiden gelang ihr so gut, dass ihre Mutter oben auf dem Gipfel, als sie in einer Almhütte einkehrten, sogar davon schwärmte, wie schön es war, noch immer so mit der großen Tochter wandern zu gehen und etwas zu unternehmen. Sie freute sich bei diesen Worten auch – weil ihre Mutter sich freute. Das war schön... Und zugleich wuchs in dieser Freude aber auch ihre Einsamkeit, denn sie alle, ihre Mutter und auch alle Anderen, sahen immer nur die eine Seite von ihr. Niemand sah die andere – und wenn man sie sah, wurde alles nur noch schlimmer... Mit dieser Seite war sie entweder vollkommen allein, oder es gab sogar Angriffe. Einsames Leiden...
Als sie schließlich abends im Bett lag, entstand in ihr langsam etwas wie eine leise Vorstellung, eine vage Antwort auf die Frage, mit der sie den ganzen Tag so allein gewesen war.
Am nächsten Morgen, als sie wieder auf der fast völlig stillen Straße zum nächsten Ort ging, war die leise Vorstellung über Nacht längst zu einer Gewissheit gewachsen. Sie war sich sicher, dass dies geschehen musste, dass sie dies tun wollte. Fortwährend musste sie daran denken – und trotzdem wollte sie alle Gedanken daran noch aufschieben, bis ihre Andacht vorüber war. Es gelang ihr nicht – aber unbeirrt schob sie, während sie auf der Straße ging, alle Gedanken daran dennoch immer wieder von sich.
Sie betrat die Kirche. Ein einsames, sechzehnjähriges Mädchen, aus der gottlosen Welt kommend, in die heilige Welt eintretend, bald vielleicht noch einsamer...
Sie kniete nieder. Immer wieder kamen die Gedanken – aber sie schob sie tapfer von sich. Und schließlich kam wieder jener Moment, wo die Gedanken schwiegen und ihre Seele in der Gottessehnsucht lebte, in der Sehnsucht nach Gott und in der Hingabe an Gott... Um ihre Gedanken zum Warten zu erziehen, dehnte sie ihre Andacht an diesem Morgen extra lange aus, versuchte, die zu schmerzen beginnenden Knie noch wesentlich länger zu ertragen als an den beiden ersten Morgen.
Dann blickte sie, immer noch kniend, lange auf das Kreuz. Und erst dann setzte sie sich auf – und gewährte nun, während sie weiter auf den Altar schaute, ihren Gedanken wieder Einlass...
Früher hatten Menschen ihr ganzes Leben Gott geweiht und waren sogar äußerlich in ein Kloster eingetreten, Mönch oder Nonne geworden. Früher waren auch Menschen für den Glauben an Gott gestorben. Sie hatten sich nicht gefürchtet – vielleicht hatten sie sich gefürchtet, aber sie waren trotzdem bereit dazu gewesen. Sie wollten lieber sterben, als ihren Glauben zu verleugnen ... als Gott zu verleugnen. Man musste den Mut haben, seinen Glauben nicht zu verbergen...
Was sie empfand, war, dass man heute bis in die Kleidung hinein Gott verleugnete. Sie wollte sich eine eigene Kleidung machen – selbst. Sie wollte nicht mehr die in den Fabriken massenhaft und einheitlich hergestellten Sachen anziehen, sondern sich selbst etwas machen und dies dann anziehen, und dies sollte zugleich das Zeichen dafür sein, dass sie die Beziehung zu Gott vollkommen ernst nahm...
Keine fremde, bequem gekaufte, unauffällige Kleidung mehr, und kein Weglaufen mehr davor, dass Andere sehen würden, dass man an Gott glaubte, und zwar nicht einfach nur so...
Jetzt, wo sie diesen Gedanken voll zuließ und sich ausmalte, füllte sich ihr Herz erneut mit Freude. Ja, dies musste geschehen! Das war es, was sie tun musste! Nicht in ein Kloster gehen, aber in voller Öffentlichkeit den Mut haben, für Gott einzutreten. Was für eine Welt war dies, wo es dafür sogar Mut brauchte...
Eine eigene, selbst gemachte Kleidung. Keine Fabrikkleidung, sondern Gotteskleidung...
*
Voller Freude, erfüllt und glücklich, ging sie wieder zurück zu ihrem Ferienhäuschen.
Diese Freude blieb ihren Eltern beim Frühstück nicht unbemerkt. Sie hatte überhaupt nicht vorgehabt, ihren Eltern sofort etwas davon zu erzählen, aber als sie dann gefragt wurde,
sagte sie doch aufrichtig die Wahrheit...
Es war ihre Mutter, die fragte:
„Na, Juliane, du siehst ja heute so besonders fröhlich aus. Was ist denn los?“
Etwas tief in ihr wusste, dass ihre Eltern dies nicht verstehen würden. Aber in diesem Moment überwog einmal mehr ihr völliges, immer wieder neues Vertrauen, und so erwiderte sie unbedarft und noch ganz in ihrer Freude:
„Ich habe vor, mir eine eigene Kleidung zu machen!“
„Eine eigene Kleidung?“, fragte die Mutter. „Was für eine Kleidung denn?“
„Ich weiß noch nicht. Eine einfache, selbst gemachte Kleidung eben.“
Sie lächelte ihre Mutter an. Noch immer überhörte ihr argloses Herz den leisen Unterton, den schon diese erste Rückfrage der Mutter gehabt hatte.
„Und warum das?“
„Weil ich nicht mehr die Fabrikkleidung tragen will. Ich will mir meine Kleidung selbst machen. Und das soll zugleich –“ – in diesem Moment war ihr völlig klar, wie die Reaktion ihrer Eltern sein würde; dennoch führte sie den Satz mit zögerndem Mut zu Ende –, „...es soll zugleich ein Zeichen dafür sein, dass ich an Gott glaube...“
„Aber Juliane!“, sagte die Mutter erschüttert. „Dafür braucht man doch keine Zeichen! Was hat das denn mit der Kleidung zu tun?“
Die nahezu identische Frage auf dem noch schweigsamen Gesicht ihres Vaters war nicht weniger schlimm als die ausgesprochenen Worte ihrer Mutter. Schon jetzt befand sie sich also in dem Leiden, das so viele Gottesgläubige vor ihr immer wieder durchstehen mussten. Tief traurig ergab sie sich einmal mehr in ihr Schicksal und hoffte nur, es möge ein Ende haben...
„Vieles“, erwiderte sie mit einem noch immer um Verständnis bittenden Blick in die Augen ihrer Mutter. „Nicht direkt mit der Kleidung – aber eben doch. Ich möchte die einfach so gekaufte ‚normale’ Kleidung einfach nicht mehr. Ich möchte meine eigene Kleidung, die nur ich habe, und die ich mir selbst gemacht habe...“
Sie meinte all diese Worte wieder einmal völlig anders, als die Anderen sie verstanden – und nun vor allem ihr Vater. Dieser sagte jetzt recht heftig:
„Juliane! Gerade vorgestern haben wir doch genau über dieses Thema geredet. Genau dieses! Ich habe gesagt, die Dinge können sehr leicht außer Kontrolle geraten – und ihr, du und deine Mutter, ihr wolltet mich da noch beruhigen. Und ich habe mich sogar beruhigen lassen. Und jetzt das! Vorgestern sagte ich noch: Man wird noch sehen, wo das hinführt. Und jetzt sieht man es! Eigene Kleidung! ‚Selbst gemachte, eigene Kleidung’, die ‚zugleich ein Zeichen sein soll’! Himmelherrgott nochmal – was sind das für Gedanken? Was – was soll das?“
Tiefe Einsamkeit...
„Ich will einfach –“ setzte sie zu einer Antwort an, doch der Vater unterbrach sie unmittelbar.
„Nein, jetzt reicht es einmal. Das mit dem ‚Ich will einfach’ ist eben überhaupt nicht so einfach! Du machst dich doch zum Gespött der Leute! Und uns übrigens gleich mit, das darfst du dabei auch nicht vergessen – bei deinen ganzen undurchdachten Plänen. Auch uns machst du zum Gespött der Leute! Hast du dir das eigentlich mal überlegt? Aber glaube ja nicht, dass das der Hauptpunkt ist. Der Hauptpunkt ist, dass das völliger Blödsinn ist. Eigene Kleidung schneidern, die dann ein Zeichen sein soll, dass man an Gott glaubt! Hat man so was schon gehört? Was glaubst du, wie man darauf reagiert? Dass man das mit offenen Armen und offenem Mund staunend anerkennt? Ich sage, zum Gespött wirst du! Du hast keine Vorstellung. Mit deinen blauäugigen Plänen rennst du mitten ins Verderben. Was hast du dir nur dabei gedacht?“
Sie war völlig erschlagen. Antworten konnte sie auf solche heftigen Angriffe oder Argumentationen, die sie aber immer wie Angriffe empfand, absolut nicht.
„Vielleicht gelingen ihr ja sehr schöne Kleider“, wandte ihre Mutter nun als Möglichkeit ein, an die bisher offenbar noch keiner gedacht hatte.
„Angelika – das glaubst du doch selbst nicht. Sie hatte noch nie eine Nadel in der Hand, geschweige denn, auch nur ein Puppenkleidchen genäht. Wie sollen ihr da ‚sehr schöne Kleider’ gelingen? Falls ihr überhaupt etwas gelingt, wird es zum allgemeinen Gespött werden. Das gebe ich dir schwarz auf weiß. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt darüber diskutieren! Je eher man diese absurde Idee wieder fallen lässt, desto besser!“
„Es ist meine Idee“, verteidigte sie sich. „Und es ist mehr als eine Idee ... es ist ... ein Entschluss ... eine Tatsache...“
„Oh nein...“, erwiderte der Vater fassungslos und stützte seinen Kopf, den er zugleich schüttelte, in die Hand. Dann blickte er seine Frau an und sagte:
„Angelika – sag du etwas. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen kann...“
Ihre Mutter wandte sich nun an sie und sagte:
„Dein Vater hat Recht, Juliane. Überleg doch mal in Ruhe. Du kannst nicht nähen. Was dabei herauskommt, kann höchstens – wie soll ich sagen? Du musst dir das doch selbst sagen! Du musst doch wissen, was dabei herauskommen kann und was nicht. Und es ist doch klar, was dann weiter passieren wird. Ich meine, hast du dir das alles selbst noch nicht überlegt?“
„Es ist mir egal“, erwiderte sie leise.
„Aber Kind, uns ist es nicht egal! Wir wollen nicht, dass alle Welt über dich redet, weil du plötzlich eine so ... sonderbare Idee hast. Du hast doch jetzt schon kaum Kontakte, geschweige denn eine Freundin. Wenn du eine solche hättest, könnte man ja sagen: Höre dir mal an, was die dazu sagt. Aber so – kann ich nur sagen: Höre auf deine Eltern. Wenigstens diesmal. Um deinetwillen. Du wirst dich völlig außerhalb von allem stellen, wenn du diese verrückte Idee wahrmachst. Die Frage ist, ob nicht sogar die Schulleitung sagt, das ist des Guten zuviel, werde wieder vernünftig...“
Sie war völlig verzweifelt. Noch nie waren sich ihre Eltern in ihrem Widerstand so einig gewesen. Aber noch nie war sie sich in einem Entschluss so sicher gewesen, hatte sich so sehr darauf gefreut und war so sehr bereit gewesen, alles zu ertragen, was damit zusammenhing... Oh ja, sie hatte auch Angst davor, aber sie konnte es nicht nicht tun – das war einfach eine Sache der Unmöglichkeit, genauso unmöglich wie, sich eine Welt ohne Gott auszumalen...
„Das ist mir egal...“, sagte sie noch einmal leise, aber bestimmt.
„Juliane!“, sagte ihr Vater nun wieder. „Wie alt bist du eigentlich? Das hier ist keine Kindergarten-Angelegenheit. Es geht nicht darum, so einen unfassbaren Plan einfach mit einem bequemen ‚Das ist mir egal’ zu verteidigen. So einfach ist das nämlich nicht. Die Konsequenzen sind unglaublich. Und ich glaube langsam, du kannst das noch nicht einmal annähernd überblicken. Man muss dich vor dir selbst in Schutz nehmen. Und das, obwohl du in weniger als zwei Jahren volljährig sein wirst. Ich fasse es nicht, wie du bei einer so absurden Entscheidung mit so unglaublichen Konsequenzen einfach nur sagen und wiederholen kannst: ‚Das ist mir egal’! Ich verstehe es einfach nicht...“
Traurig sah sie nun ihren Vater an. Dann sagte sie:
„Du verstehst auch alles andere nicht, was mir so wichtig ist. Ich erwarte nicht, dass du das jetzt verstehst. Und auch meine Antwort verstehst du nicht. Ich weiß sehr genau, was ich gesagt habe – und ich habe es nicht ‚einfach so’ gesagt. Sogar die Konsequenzen sind mir klar. Aber dass ich es trotzdem tun will, ist mir einfach wichtiger. Ich will dies einfach tun – und ich muss es einfach tun. Und ich kann es nicht ändern, dass ihr es nicht verstehen könnt – und alle Anderen vielleicht auch nicht. Aber ich verstehe es, ich verstehe mich vollkommen, und ich weiß, dass es richtig ist und dass ich es tun muss. Und was alle Anderen darüber denken, ist mir egal, weil ich weiß, dass es richtig ist...“
Verblüfft hatte ihr Vater zugehört. Auch jetzt fand er nicht recht zu seiner Sprache zurück, obwohl man ihm ansah, dass er um jeden Preis etwas antworten wollte. Schließlich aber musste er den Versuch aufgeben. Er brachte nur noch heraus:
„Ich kann mir nicht helfen – und ich kann offenbar auch dir nicht helfen. Wenn du dich nicht belehren lassen willst, dann tu, was du für richtig hältst – und lass dich von der Wirklichkeit belehren. Ich sage nur, es wird schlimm werden...“

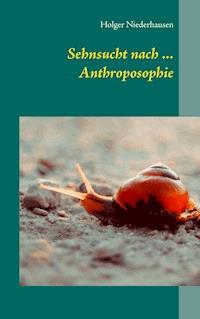

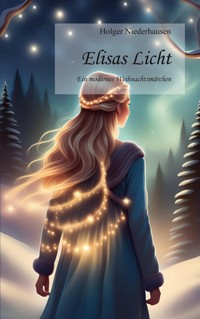
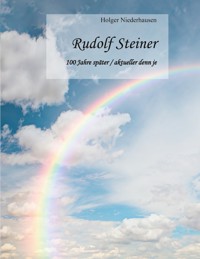







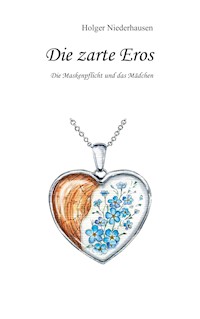



![Die [durchgestrichen: letzte] erste Unschuld - Holger Niederhausen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9d69c6320692c771bc65edda9a41b406/w200_u90.jpg)