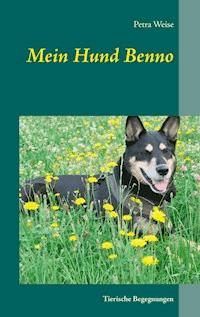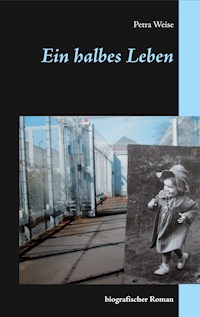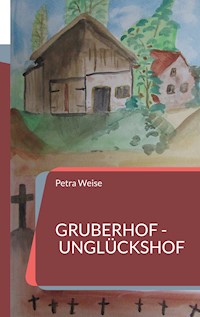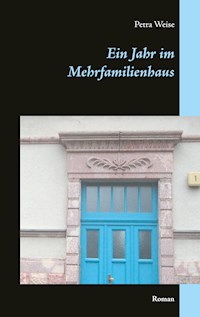Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Erzählerin Bianka stürzt in eine tief verschneite Schlucht. Sie weiß nicht, wie sie dorthin geraten ist und auch nicht, ob sie jemand findet und retten kann. Abstürze. Davon gibt es viele in Biankas Umfeld: seelische, moralische, religiöse und technische, die sich durch diesen Roman wie ein roter Faden ziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wir haben so viel Mühe gehabt zu lernen, dass die äußeren Dinge nicht so sind wie sie uns erscheinen - mit der inneren Welt steht es ebenso!
Friedrich Nietzsche
Inhalt
Bianka
Elisabeth
Melanie
Mark
Thomas
Vater
Mutter
Elena
Kai
Kim
Nicole
Sven
Melanie
Biankas Geburtstag
Bianka
Ich liege im Schnee. Eigentlich stehe ich eher – halb Sitzen, halb Stehen. Es ist kalt. Ich zittere. Doch nicht nur wegen der Kälte. Ich zittere vor allem aus Angst.
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Warum bin ich hier? Und wie komme ich hierher? Ringsum ist es dunkel, doch der Schnee leuchtet im Mondlicht und ich erkenne direkt unter und neben mir ganz deutlich Zweige. Mein linker Fuß klemmt in einem Ast. Das finde ich seltsam. Wie kommt mein Fuß in einen Ast? Warum sollte ich auf einen Baum gestiegen sein? Ich schaue nach unten, am eingeklemmten Fuß vorbei. Viel weiter unten, ganz weit entfernt sehe ich Lichter, vermutlich von einem Ort. Ich kann mir das alles nicht erklären.
Plötzlich überkommt mich Panik, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich in diesen Baum zwischen all dem Schnee hoch oben auf einem Berg gelangt sein soll. Ich spüre, wie unnormal schnell mein Herz schlägt. Mein ganzer Körper zittert. Ich friere entsetzlich. Gleichzeitig läuft mir der Schweiß übers Gesicht. Ich will ihn wegwischen, doch sofort durchzuckt mich ein heftiger Schmerz durch den rechten Arm bis hinauf in die Schulter. Erschrocken halte ich inne und horche in mich hinein, ob der Schmerz stärker wird oder abnimmt. Dann versuche ich, langsam meine linke Hand zu benutzen. Doch das geht nicht, sie ist im Geäst verkeilt. Ich zerre etwas heftiger, was höllisch weh tut. Ich habe das Gefühl, dass meine Finger taub sind, aber die ganze Hand wie Feuer brennt.
Plötzlich wackelt der Boden unter mir und gibt ein Stück nach. Entsetzt lehne ich mich gegen die wankenden Zweigen und schreie: „Hilfe! Hilfe!“
Ringsum bleibt alles still. Ich bin mutterseelenallein auf dieser Welt und fange vor lauter Angst an zu weinen. Was ist passiert? Ich kann mich an nichts erinnern.
Immerhin erinnere ich mich an meinen Namen. Bianka.
*****
Ich liebe meinen Namen, denn Bianka bedeutet weiß, glänzend und schön und passt wie ausgesucht zu mir. Ich habe eine makellose weiße Haut, glänze mit meinen vielen Talenten und schön bin ich auch. Außerdem ist Weiß meine Lieblingsfarbe, auch wenn die Leute behaupten, dass Weiß gar keine Farbe ist.
Wahrscheinlich liebe ich gerade deshalb den Schnee so sehr. Schnee ist nicht nur wunderschön weiß, er macht alles hell und freundlich, es überdeckt den Straßenstaub und sämtliche Schmutzecken. In der Sonne glitzert er wie tausende Diamanten und mich ergreift ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Ich könnte jubeln, springen, tanzen und meine Freude laut in die Welt schreien.
Meine Freude über frisch gefallenen Schnee teilen nur wenige Menschen. Die meisten blicken mürrisch drein, ziehen frierend ihre Schultern hoch, verstecken ihren Mund hinter einem modisch gemusterten Schal, tragen allerdings trotz der Kälte keine Mütze. Wer nicht frieren will, sollte sich einfach warm anziehen. So einfach ist das.
*****
Mir ist, als ob ich ebenfalls keine Mütze trage, obwohl ich normalerweise immer eine auf dem Kopf habe, sobald ich aus dem Haus gehe. Oder ein Stirnband. Ich weiß, dass man mehr als sechzig Prozent der Körperwärme über den Kopf verliert. Mir passiert das nicht, jedenfalls nicht im Winter. Doch warum habe ich heute keine Mütze auf? Immerhin trage ich meinen Anorak. Doch der scheint mich nicht zu wärmen, denn ich bin schon ganz steif gefroren und zittere wie Espenlaub. Ich habe nicht einmal festes Schuhwerk an den Füßen, nur so leichte Sportschuhe. Ich verstehe das nicht.
Mir zieht es die Augen zu und ich verspüre den starken Wunsch, einfach einzuschlafen. Entsetzt reiße ich meine Augen auf und bemühe mich, wach zu bleiben, denn mir ist plötzlich klar geworden, dass ich erfrieren könnte. Vielleicht sind meine Arme und Beine längst erfroren, weil ich sie nicht bewegen kann.
Noch einmal rufe ich um Hilfe. Das Schreien strengt mich an. Um wach zu bleiben, zähle ich bis zehn und probiere danach das kleine Einmaleins. Es gelingt mir nicht. Ich weiß nicht, wie viel zwei mal drei ist. Sofort weine ich wieder, obwohl das nicht weiterhilft.
Mir wird schwarz vor Augen und furchtbar übel. Wenn ich jetzt die Besinnung verliere, ist alles verloren. Ich werde erfrieren und keiner wird mich finden. Voller Panik drücke ich mich gegen das Geäst. Vorhin gab der Ast unter mir nach. Das bedeutet, dass ich mich auf keinen Fall bewegen darf, um nicht weiter abzustürzen. Ich weiß allerdings nicht, wie weit ich stürzen würde, wenn der Ast bricht. Vorsichtig versuche ich, mich aus dem Gesträuch zu befreien, um möglicherweise vom Baum herunterklettern zu können. Doch ich bin festgeklemmt und bei jeder kleinsten Bewegung durchzucken meinen gesamten Körper höllische Schmerzen.
Ich suche noch einmal mit den Augen nach den Lichtern und bin mir nun sicher, dass weit unten im Tal ein Ort sein muss. Also befinde ich mich auf einem Berg, allerdings nicht auf einem Weg, sondern in einem Baum. Und überall ist Schnee, viel Schnee.
Obwohl ich Schnee liebe, macht mir im Moment genau dieser viele Schnee die größten Sorgen, ebenso der ächzende Baum und der seltsame Ort tief unten im Tal.
Ich hänge in einem Baum fest und weiß, dass ich dies nicht träume. Doch real scheint mir die sonderbare Situation ganz und gar nicht zu sein. Wie bin ich nur hierher geraten?
Ich muss nachdenken.
*****
Ich lebe in Chemnitz und wollte mit meinem Freund in den Schiurlaub fahren, worauf ich mich seit Wochen freute.
Wo ist Mark überhaupt?
„Mark!“, schreie ich. „Mark!“
Doch ich höre keine Antwort, ich höre gar nichts. Der Schnee schluckt wohl sämtliche Geräusche. Hat er auch Mark verschluckt?
Wir sind seit vier Jahren ein Paar, doch wir wohnen nicht zusammen, weil wir beide unseren Freiraum brauchen. Außerdem ist Mark unangenehm pingelig, sein Ordnungssinn würde mich in den Wahnsinn treiben. Zweimal pro Woche treffen wir uns in einem Gasthof. Mark hat einen gefunden, der genau in der Mitte zwischen unseren Wohnungen liegt. Das hält er für gerecht. Mark achtet auf so etwas. Anschließend schläft er entweder bei mir und ich bei ihm an einem anderen Tag, meist Donnerstag.
Urlaub verbringen wir normalerweise getrennt, jeder mit seinen Freunden, doch diesen Schiurlaub wollten wir gemeinsam in Tirol genießen. Eine Woche lang jede Nacht im gleichen Bett und tagsüber auf der Piste.
Mein Gedächtnis funktioniert also. Ich versuche, mich an heute Morgen zu erinnern und somit Stück für Stück herauszufinden, was genau mit mir passiert ist, wie ich in diesen Baum, in diese Situation geraten bin.
*****
Mark wollte mich daheim abholen. Wie immer nervte er fünf Minuten vor der Zeit. Er blieb im Auto sitzen und hupte. Glaubte er, ich käme nun eilig aus dem Haus gestürzt? Ich hatte noch nicht einmal meine Tasche gepackt und auch noch keine Zähne geputzt. Wozu die Eile? Wir haben Urlaub!
Außerdem bin ich im Gegensatz zu Mark kein Frühaufsteher. Ich brauche meine Ruhe und meinen Kaffee. Erst danach bin ich halbwegs ansprechbar.
Heute Morgen beeilte ich mich, um Mark nicht unnötig zu reizen. Als er endlich zur Tür hereinkam, fiel ich ihm um den Hals. Das mag er. Doch er schob mich zur Seite und und schaute sich suchend im Zimmer um.
„Wo ist deine Tasche?“, wollte er wissen. Dabei stand sie groß und breit auf dem Sofa.
„Mein Schminkzeug muss noch mit, dann können wir los.“
Mark runzelte die Stirn. Ich folgte seinem Blick, der mahnend auf meiner Kaffeetasse und dem Weinglas von gestern Abend lag. Wen stören diese zwei Teile? Mich jedenfalls nicht. Doch Mark erträgt keine Unordnung. Er drehte den Wasserhahn auf und spülte ab. Dabei weiß er genau, dass ich es nicht ausstehen kann, wenn er sich in meinen Haushalt einmischt. In seiner Wohnung kann er gern die gesamte Kücheneinrichtung dreimal täglich abwaschen, in meiner Wohnung hat er die Finger von meinen Sachen zu lassen.
„Lass das!“, fauchte ich ihn an.
Doch er trocknete bereits die Tasse und das Glas sorgfältig ab und räumte beides in den Schrank, statt alles einfach auf der Spüle stehenzulassen. Typisch Mark.
Die beiden Bücher, die auf dem Tisch lagen, klappte ich schnell zu und warf sie auf die Tasche. Dann räumte ich Creme, Seife, Lippenfett, Wimperntusche und das Zahnputzzeug in meinen Kosmetikkoffer – fertig.
Marks Auto ist groß und bequem, weshalb wir seines benutzten und nicht meins. Ich fahre einen kleinen Mazda mit großem Motor. Ich komme eben gern schnell an. Natürlich war Marks Fahrzeug nicht nur außen, sondern auch innen blitzblank geputzt, als bekäme er einen Sauberkeitspreis. In meinem Mazda liegt alles, was ich brauche, griffbereit auf dem Beifahrersitz, was Mark immer furchtbar aufregt.
„Hoffentlich liegt ausreichend Schnee. Hier in Chemnitz ist kein Krümelchen.“
„In der Lizum liegen unten vierzig Zentimeter, oben fast zwei Meter mehr“, beruhigte er mich.
Mark ruft mehrfach am Tag den Wetterbericht auf, manchmal vergleicht er sogar das aktuelle Wetter mit der Beschreibung auf seiner Wetter App im Handy. Mir ist das Wetter gleichgültig. Ich kann es sowieso nicht ändern.
Die Autobahn Richtung Süden war frei. Es herrschte wenig Verkehr und wir kamen gut voran, auch wenn Mark keine fünf Stundenkilometer schneller als erlaubt fuhr.
Südlich von München machten wir Pause in einem Rasthof. Kurz darauf war die Autobahn zu Ende und wir fuhren auf einer gut ausgebauten Straße weiter. Auch hier lag kaum Schnee. Doch kurz nach Garmisch sahen wir neben der Straße Langläufer auf schienenartigen Spuren vorwärts rutschen.
So langsam wurde es dunkel, doch der Schnee neben der Straße leuchtete hell und freundlich. Plötzlich standen wir vor einer Bake. Die Straße war gesperrt.
„Was machen wir jetzt?“, fragte Mark und schaute mich irritiert an.
Das wusste ich natürlich auch nicht. Mark war für die Vorbereitung der Strecke zuständig und sollte eigentlich auch über alternative Routen informiert sein. Ich hatte nicht einmal in eine Karte geschaut und verließ mich voll auf ihn. Er zögerte erst eine Weile und bog schließlich nach Mittenwald ab. Das war ohnehin die einzige Möglichkeit, weiterzukommen.
Ich wäre gern in Mittenwald geblieben, hätte ein Lokal für ein Abendessen und ein Bett für die Nacht gesucht. Doch Mark wollte nicht. Er erinnerte mich daran, dass er unser Urlaubshotel bereits angezahlt hatte. Während er sich nach einem Weg in Richtung Innsbruck erkundigte, zog ich mir den Anorak über und lief die Straße entlang. Mir gefielen die bunt bemalten kleinen Häuser. Doch weit kam ich nicht, weil meine leichten Sportschuhe nicht wasserdicht sind. Die warmen Winterstiefel befanden sich gut verstaut im Gepäck. Mark hatte Recht, es wäre unklug, so kurz vor dem Ziel im Ort zu bleiben und für eine einzige Nacht die Koffer auszupacken. Er zog die Schneeketten auf und wir fuhren weiter.
Ich erinnere mich, dass die Straße sehr schmal war und links und rechts von hohen Schneewehen gesäumt. Innerlich betete ich, dass wir uns auf einer Einbahnstraße befanden, denn ein zweites Auto hätte keinen Platz gefunden.
Und doch kam uns eines entgegen!
Mark lenkte sein Fahrzeug so weit wie möglich nach rechts und hielt an. Das machte mich wütend, denn wir fuhren bergauf, hatten also Vorfahrt. Und natürlich passierte es ganz genau so wie ich befürchtet hatte: Unser Auto bewegte sich nicht, es steckte mit den rechten Reifen im tiefen Schnee fest.
„Jetzt hast du den Salat!“, fauchte ich.
Mark blieb ruhig. Wie immer, was mich noch wütender machte. Ich öffnete meine Beifahrertür und stieg aus.
Mehr weiß ich nicht.
*****
Ich habe einen sogenannten Filmriss.
Offenbar muss ich beim Aussteigen direkt ins Freie getreten und in einen Abgrund gestürzt sein. Abgrund? Ich bin gefallen! Ich schließe meine Augen und sehe trotzdem die Lichter weit unten im Tal vor mir. Doch ich klemme in einem Baum. Mir fallen plötzlich Bilder eines Films ein, wo sich eine Frau beim Absturz in eine tiefe Schlucht in einem Baum verfing. Himmel! Ich stecke in einem Ast fest und schwebe gleichzeitig in der Luft, über mir und unter mir ist gar nichts. Zitternd klammere ich mich an den Zweigen fest, obwohl ich mich ohnehin nicht bewegen kann.
Ich bin ganz allein und keine Menschenseele ist in der Nähe, die mir helfen kann. Zudem ist es dunkel.
Mark! Wo ist er? Ist er ebenfalls abgestürzt? Mitsamt Fahrzeug bis hinunter ins Tal?
„Guter Gott! Mach, dass Mark nichts passiert ist und er unterwegs ist, um Hilfe zu holen!“
Ich bin nicht gläubig, doch es kann nicht schaden, ein Stoßgebet zum Himmel zu schicken. Schon gar nicht in meiner Situation.
„Mark!“, rufe ich noch einmal. „Hilfe! Hilfe!“
Doch es kommt nur ein Krächzen aus meiner Kehle. Nun laufen mir wieder Tränen übers Gesicht, die sofort eine eiskalte Spur hinterlassen. Auch die Nase läuft und ich kann sie mir nicht putzen. Ich weine so heftig, dass mein ganzer Körper bebt.
Plötzlich kracht es ohrenbetäubend, während der Ast, in dem ich festgeklemmt bin, unter mir nachgibt. Erschrocken halte ich die Luft an und klammere mich so gut es geht an den dünnen Zweigen fest. Doch das ist sinnlos, der ganze Baum wird abstürzen! Ich werde abstürzen! Ich werde sterben!
Ich wage nicht, mich zu bewegen. Ich wage nicht einmal mehr zu weinen.
Nun ist nichts mehr zu hören. Gar nichts. Kein Knacken im Baum, auch kein Geräusch von einem Motor. Die Straße kann doch nicht weit sein! Oder doch? Könnte ich so tief gestürzt sein, dass man die Straße nicht mehr hört? Sollte ich überhaupt dankbar dafür sein, noch zu leben? Ich hänge hier rettungslos fest und kann nur darauf warten, in die Tiefe zu stürzen. Hoffentlich bleibe ich nicht verletzt irgendwo liegen. Hier im Schnee am Abgrund findet mich kein Mensch, falls auch Mark abgestürzt ist. Mein Freund ist tot! Diese Erkenntnis trifft mich derart heftig, dass ich keine Luft mehr bekomme und plötzlich furchtbar schwitze. Der Schock ist so groß, dass ich nicht einmal weinen kann. Ich sehe es direkt vor mir, wie Mark mitsamt seinem Auto in die Tiefe stürzt. Doch dann hätte mich das abstürzende Fahrzeug mit in die Tiefe gerissen.
In mir keimt neue Hoffnung auf. Mark wird nach mir gerufen haben. Er konnte in der Nacht nichts sehen und ist bestimmt sofort ins nächste Dorf gefahren, um meinen Unfall zu melden. Doch eigentlich hat er ein Handy, womit er Hilfe rufen kann. Oder gibt es hier in den Bergen keine Funkverbindung?
Ich klammere mich an den Gedanken, dass Mark unterwegs ist, um Hilfe zu holen. Er wird mich retten! Ganz sicher wird er das. Ich muss nur ein klein wenig Geduld haben und vor allem wach bleiben. In Gedanken sage ich Gedichte auf und Texte von alten Volksliedern, um nicht wieder wegzudämmern. Dann würde ich zwar den unvermeidlichen Sturz nicht spüren, doch wenn ich jetzt ohnmächtig werde, würde ich ganz sicher erfrieren.
Entweder, ich habe mich an die Dunkelheit gewöhnt, oder es wird langsam heller. Mir kommt es jedenfalls so vor. Doch das würde bedeuten, dass ich schon mehrere Stunden hier hänge. Hat mich Mark vergessen? Holt er absichtlich keine Hilfe? Dieser Saukerl will mich loswerden!
Sofort bereue ich meine bösen Gedanken. Mir ist klar, dass Mark außer sich sein wird vor Sorge. Doch wo bleibt er?
Je heller es wird, desto bewusster wird mir meine ausweglose Situation. Am schlimmsten ist der Ausblick, den ich hier an den kleinen Baum geklammert, in das tiefe Tal unter mir habe. Mich ergreift schon wieder eine heftige Panik und ich spüre, wie ich stürze. Immer weiter, immer tiefer.
Doch ich stürze nicht wirklich – es ist ein Schwindel, der mich wie mit Macht in die Tiefe zieht. Ich habe keine Hoffnung mehr, nur noch unsagbar große Angst. Ich darf nicht nach unten schauen, um nicht verrückt zu werden.
Trotzdem schreie ich. Ich schreie aus reiner Verzweiflung und schaue dabei nach oben in Richtung Himmel. Doch außer Schnee ist nichts zu sehen. Gar nichts. Ich schließe meine Augen. Am liebsten würde ich loslassen, mich fallenlassen, damit endlich alles ein Ende findet. Doch es geht nicht. Mein Fuß und meine linke Hand sind irgendwie verkeilt und schmerzen sehr stark. Den rechten Arm kann ich nicht bewegen, obwohl er überhaupt nicht weht tut. Ich habe kein Gefühl in ihm. Wieder ergreift mich Panik, weil ich nichts tun kann außer darauf zu warten, dass der Ast bricht und mich in die Tiefe reißt.
Vielleicht sollte ich nachhelfen und einfach so lange mein Gewicht verlagern, bis der ganze Baum ins Tal fällt. Dann hätte ich endlich ausgelitten.
Plötzlich rieselt Schnee auf mich herab, gefolgt von einer kräftigen Ladung, die hart auf mein Gesicht und die Schultern fällt. Der Ast wackelt und knackt wieder.
„Hilfe!“, schreie ich. „Hilfe! Ist da jemand?“
Mir ist, als höre ich Stimmen und einen gedämpften Motor. Doch vielleicht bilde ich mir das nur ein. Ich werde verrückt! Ich bin längst verrückt. Jetzt rieselt hinter mir Schnee den Hang hinunter. Ich kann mich nicht weit genug umdrehen und sehe nicht, was hinter mir ist. Ein Tier oder gar eine Lawine. Im Grunde ist es gleichgültig, denn sterben werde ich sowieso, ob ich das Elend nun sehe oder nicht. Da kann ich die Augen auch gleich schließen, wegdämmern und nie wieder aufwachen.
Dieser Gedanke bringt mich zum Weinen. Ich stelle mir vor, wie verzweifelt meine Freunde und vor allem meine Mami über meinen Tod sind. Und ich stelle mir vor, dass sie Mark mit schweren Vorwürfen zusetzen, ihm die Schuld an meinem Tod geben. Ich sehe direkt vor mir, wie er leidet. Er soll leiden! Warum konnten wir nicht in Mittenwald übernachten? Warum musste er diese Straße nehmen? Warum holt er keine Rettung? Glaubt er, ich bin schon lange tot? Aber noch lebe ich!
„Mark! Hier bin ich! Hier unten!“
„Ruhig! Ganz ruhig! Wir holen Sie hier raus.“
Ich weine noch heftiger über solch eine unsinnige Idee, mir Worte und fremde Stimmen einzubilden.
„Alles wird gut“, höre ich eine tiefe Männerstimme. Sie tröstet und macht mich tatsächlich ruhiger. Was soll ich auch sonst tun, als mir Geschichten über meine Rettung vorzustellen?
„Ich lege Ihnen jetzt einen Gurt um.“
Ich schreie.
„Bianka! Sie sind doch Bianka, nicht wahr?“
Ich schreie noch lauter. Und doch spüre ich, wie mir etwas um Bauch und Beine geschlungen wird. Ist es möglich, dass ich nicht fantasiere?
„Wie geht es Ihnen? Haben Sie Schmerzen“, fragt die Stimme.
Ich will antworten, doch es kommt kein Laut über meine Lippen. Vielleicht weiß ich nicht mehr, wie man redet. Ich weiß gar nichts mehr.
„Schauen Sie mich an!“
Ich merke, dass ich die ganze Zeit meine Augen fest zugekniffen habe. Ich habe Angst, sie zu öffnen und niemanden zu sehen, zu sehen, dass ich nur spinne, verrückt bin.
„Können Sie mich sehen?“
Ich schaue in dunkelbraune Augen, die mich besorgt, aber freundlich mustern. Der Kopf steckt in einem Helm.
Langsam bewege ich meinen Kopf. „Ja. Ja! Oh Gott!“
Jetzt spüre ich auch eine Hand auf meiner Schulter und fühle mich plötzlich wie geborgen. Ich bin derart erleichtert, dass ich schon wieder weine und gleichzeitig einfach nur schlafen will. Ich bin gerettet! Man hat mich gefunden. Ich muss gar nicht sterben.
„Haben Sie Schmerzen“, fragt der Mann noch einmal.
„Mein Fuß. Meine Hand. Stecken fest“, stammle ich.
„Keine Sorge! Das haben wir gleich.“
Ich träume nicht. Ich fantasiere nicht. Neben mir ist ein Mann! Wahrhaftig ein Mann, der mich retten wird. Und schon weine ich wieder. Und lache gleichzeitig. Es ist ein irres Lachen, hysterisch überdreht.
„Ich bin Moritz und versuche jetzt, Ihr Bein freizubekommen.“
Sobald der Ast mein Bein freigibt, sackt der Fuß nach unten und ein stechender Schmerz rast durch meinen ganzen Körper und lässt mich laut aufschreien. Doch Moritz hat bereits eine Art Schlaufe um den Schuh geschlungen, um ihn zu stützen.
Er greift eine kleine Säge aus seinem Rucksack und entfernt den Zweig, um den sich meine rechte Hand klammert. Sie ist wie mit dem Holzstück verwachsen und lässt sich nicht öffnen. Doch darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ich fühle mich einfach nur wohl und geborgen, denn mich halten zwei Arme fest umschlungen. Mir kann nichts mehr passieren. Plötzlich spüre ich, wie ich nach oben gezogen werde und gleichzeitig neuer Schnee auf mich herunter rieselt. Es stört mich nicht. Zufrieden kichere ich vor mich hin.
Feste Hände wickeln mich komplett in eine silberne Folie ein, packen mich auf eine Trage und schnallen mich fest. So versorgt schiebt mich jemand in ein seltsames Fahrzeug, das wie ein Geländewagen aussieht und Ketten statt Räder hat.
Obwohl Moritz auf mich einredet und mir sogar mehrfach mit der Hand ins Gesicht klatscht, schlafe ich sofort ein und werde erst wach, als man mir eine Nadel in den Arm sticht.
Ich habe das Gefühl, auf einmal in einem Hubschrauber zu sein, doch ich mag nicht darüber nachdenken.
*****
Mich setzt tatsächlich ein Hubschrauber direkt am Krankenhaus ab. Dort wartet Mark. Er umarmt und küsst mich immer und immer wieder.
„Bitte, gehen Sie zur Seite!“, fordert ihn ein Mann auf. „Ihre Freundin wird jetzt medizinisch versorgt. Sie können sie morgen besuchen.“
Eine Ärztin untersucht meinen Fuß. Viel mehr bekomme ich nicht mit, weil ich immer wieder einschlafe.
*****
Als ich wach werde, ist es dunkel. Ich will mich aufrichten und zur Toilette gehen, doch das geht nicht. Wo bin ich? Erleichtert merke ich, dass ich ganz normal in einem Bett liege. Was habe ich nur für einen Blödsinn geträumt, denke ich zufrieden und will weiterschlafen. Doch ich kann mich nicht auf die Seite drehen. Was ist nur los?
Es ist nicht mein Bett, in dem ich liege! Mich ergreift Panik und ich fürchte, dass ich all diese grauenhaften Sachen von einem Absturz in einen schrecklich tiefen Abgrund gar nicht geträumt habe. Ich kriege keine Luft! In meinem Körper breitet sich ein unangenehmer Druck aus und bricht mir nass aus allen Poren.
Erst nach einer Ewigkeit fällt mir ein, dass ich gerettet wurde. So langsam entspannen sich meine Muskeln. Ich versuche, möglichst langsam ein- und auszuatmen und merke, dass ich tatsächlich ruhiger werde.
Ich wurde also gerettet und kam ins Krankenhaus. Das heißt, ich liege in einem Krankenbett. Und es bedeutet außerdem, dass ich verletzt bin.
In Gedanken taste ich meinen Körper ab. Mir tut nichts weh. Trotzdem kann ich mich nicht bewegen. Mein linkes Bein ist schwer wie Blei. Inzwischen haben sich meine Augen an das Dunkel gewöhnt, ich erkenne eine Tür und darüber ein Notlicht. Die Decke über den Beinen liegt schräg, so, als wäre mein linkes Bein viel dicker als das rechte. Nachschauen kann ich nicht, denn der rechte Arm steckt in einer Schlinge und im linken eine Nadel.
„Bist du wach?“, höre ich es flüstern.
Ich nicke. Im gleichen Moment wird mir klar, dass man das nicht sehen kann. Also sage ich ebenso leise: „Ja.“
„Warum hast geschrien? Tut dir was weh? Soll ich nach der Schwester klingeln?“
So viele Fragen auf einmal.
„Nein. Nichts.“
„Wie nichts? Dir tut nichts weh? Also hast du nur geträumt oder was?“
Ich weiß gar nicht, dass ich geschrien habe. Ich weiß gar nichts, nicht einmal, was ich antworten soll. Mir ist zum Heulen zumute.
„Schlaf weiter!“, flüstert meine Bettnachbarin.
„Ich wollte nur wissen, ob ich helfen kann.“
Tatsächlich schlafe ich sofort wieder ein.
Ich verspüre großen Hunger und setze mich an eine reich gedeckte lange Tafel. Alle essen, doch ich kann nicht zugreifen, weil meine Hände verbunden sind. Warum hilft mir keiner?
„Sie dürfen nichts essen!“, erklärt ein Mann.
„Warum?“
„Weil Sie trauern. Ihre Schwester ist gestorben.“
Meine Schwester?
„Ich habe gar keine Schwester.“
„Nein, jetzt nicht mehr“, sagt der Mann und weint.
Auch ich weine.
„Hallo, Bianka! Ich bin Ihre Krankenschwester und bringe Ihr Frühstück. Warum weinen Sie denn? Haben Sie Schmerzen?“
Schmerzen? Mir fällt ein, dass ich im Krankenhaus liege und weine noch heftiger, obwohl ich eigentlich keine Schmerzen habe. Nur bewegen kann ich mich nicht.
„Machen Sie sich keine Sorgen!“, sagt freundlich die Schwester. „Gleich kommt der Arzt und erklärt Ihnen alles.“
*****
Inzwischen weiß ich, dass weder meine Wirbelsäule noch mein Kopf verletzt sind. Mein linkes Bein ist kaputt, ich habe Fersentrümmerbruch verstanden und dass es gut war, im kalten Schnee gelegen zu haben. Der Arzt erklärt mir, dass es wegen der Kühlung keine nennenswerte Schwellung gibt und deshalb schneller operiert werden kann. Die linke Hand musste sofort gerichtet werden, weshalb meine Finger in einer Art Plastikkorsett stecken. Mein rechter Arm ist ruhiggestellt wegen einer Verletzung an der Schulter. Auch hier hat das Liegen im Schnee gekühlt und somit die Schmerzen gelindert. Operiert werden muss die Schulter zum Glück nicht.
Weil ich zwangsweise ruhig liege, habe ich keinerlei Schmerzen. Nur das Essen ist furchtbar schwierig und wenn ich mal zur Toilette müsste. Damit ich nach der Schwester rufen kann, hat man mir die Klingel direkt in die Hand gelegt.
„Hi!“
Ich drehe meinen Kopf in die Richtung, aus der die Stimme kommt und sage: „Hallo.“
„Bin die Melanie, hab mir die Haxn zerschossen.“
„Zerschossen?“, frage ich entsetzt.
„Beim Schifahren! Beide Haxn kaputt. Mir stand so ein Lapp im Weg, bin genau auf ihn drauf gebrettert. Schöner Mist! Die Saison kann ich knicken. Und du?“