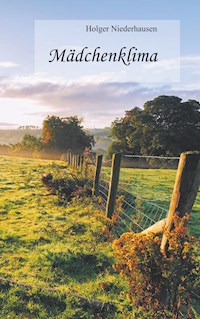Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das wahre Wesen des Menschen war ein Mysterium, und die Welt war voller Wunder. Doch der Weg in das Mysterium und in das Reich der Wunder erforderte wahre Sehnsucht und Entschlossenheit. Denn man würde einen Weg betreten, dessen Erfahrungen in der Realität dem gleichkamen, was die Märchen nur in Bildern schilderten. Der aber, der ihn ging, würde Unendliches finden...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Menschenwesen hat eine tiefe Sehnsucht nach dem Schönen, Wahren und Guten. Diese kann von vielem anderen verschüttet worden sein, aber sie ist da. Und seine andere Sehnsucht ist, auch die eigene Seele zu einer Trägerin dessen zu entwickeln, wonach sich das Menschenwesen so sehnt.
Diese zweifache Sehnsucht wollen meine Bücher berühren, wieder bewusst machen, und dazu beitragen, dass sie stark und lebendig werden kann. Was die Seele empfindet und wirklich erstrebt, das ist ihr Wesen. Der Mensch kann ihr Wesen in etwas unendlich Schönes verwandeln, wenn er beginnt, seiner tiefsten Sehnsucht wahrhaftig zu folgen...
Der Mensch vermag in jedem Augenblicke ein übersinnliches Wesen zu sein.
Novalis
INHALT
Vom Geheimnis des Glücks
Das Wunder der Liebe
Die Liebe zum Mitmenschen
Der Mensch und das Mädchen
Das Mysterium des guten Willens
Das Wesen der Liebe und seine Widersacher
Das Wesen des Kindes
Das Denken und das Wesen der Welt
Was war der Mensch?
Wann war man Mensch? Wenn man vor einem Bildschirm saß und seine tägliche Arbeit tat? Wenn man müde von der Arbeit nach Hause fuhr, in überfüllten Bussen saß oder zu Fuß den Weg nach Hause überbrückte? Wenn man einmal frei von jeder Pflicht durch eine Sommerwiese ging? Wenn man einmal nichts tat, als sich hinzulegen und den ziehenden Wolken zuzuschauen? Oder wenn man der Liebe seines Lebens begegnete?
Was war der Mensch?
Tat man dies überhaupt? Ging man einmal frei von jeder Pflicht durch eine Sommerwiese? Oder war man noch nie im Leben wirklich durch blühende Blumen gegangen? Oder war man schon jahrelang nicht mehr frei von jeder Pflicht – oder von Gedanken daran? Wie sehr war man überhaupt eingeengt – in Pflichten, in Gedanken, in Gefühlsarmut, die einem den Atem nahm, ohne dass man es ... merkte?
Wer hatte diese Momente, dass er einmal alles abschüttelte und im Spätsommer durch ein reifendes Getreidefeld ging, den sanften Wind spürte, seine Hände ausstreckte und das sanfte Streicheln der Ähren unter den Handflächen spürte? Dass er dabei in tiefstem Glück und in absoluter Freiheit seine Lungen mit Luft füllte, um sie in tiefster Dankbarkeit wieder auszuatmen?
Kannte man überhaupt solche Momente tiefsten Glücks? Momente in denen einen nichts belastete, weil man alles loslassen konnte – alles, außer das, was man gerade erlebte? Den Duft des Getreides, das Gefühl des Windes, das Streicheln der Ähren...
Konnte man das überhaupt erleben? Oder würde man durch das Getreide gehen, die Grannen fühlen, ein wenig aufatmen, aber doch ... nichts fühlen? Oder fast nichts... Was musste geschehen, damit man Glück empfinden konnte? Was musste, was konnte man tun, um glücklich zu sein – zumindest für einen Moment?
War es nicht so, dass man auch sich selbst ein bisschen loslassen musste? Also nicht nur die Pflichten, die Sorgen, die ewigen Gedanken, sondern auch das Übrige? Was war dieses Übrige? Was war es, das machte, dass man nur die Grannen fühlte, aber nicht das Glück – nicht das große, tiefe, wunderbare Glück, das einen von selbst unendlich tief einatmen und wieder ausatmen ließ?
Es gab doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Welt war gar nicht so schön, dass man glücklich sein konnte... Was war schon ein reifendes Getreidefeld... Das war die eine Möglichkeit. Oder aber man selbst war es, der sich im Wege stand, der einfach verlernt hatte, wie es war, sich glücklich zu fühlen; wie man das machte. Was man tun konnte, damit dieses Gefühl in einen einströmen, in einem aufsteigen, sich in einem ausbreiten konnte...
Wer aber ehrlich zu sich selbst war, musste doch empfinden, dass es irgendwie nur die zweite Möglichkeit geben konnte? Man stand sich selbst im Weg. Man tat fortwährend etwas, was verhinderte, dass man, selbst in einem reifenden Getreidefeld an einem friedlichen, goldenen Sommertag, glücklich war. Oder man tat fortwährend etwas nicht, wodurch man das Glück unmittelbar würde empfinden können. Aber was war es?
Kinder waren doch noch glücklich. Und hatten wir selbst nicht auch Kindheitserinnerungen? Erinnerungen und Bilder, die mit der Natur verbunden waren. Gab es da nicht einen besonderen Zauber, einen noch ganz anderen Glanz, ein anderes Erleben als das, was man jetzt hatte? Wodurch gab es das? Und wodurch hatte man es jetzt nicht mehr?
Das ganze Bewusstsein verwandelte sich vom Kind zum Erwachsenen. Der Erwachsene fühlte weniger, aber vor allem dachte er mehr. Fortwährend war er am Denken. Und hatte ein klares, scharfes Bewusstsein, Selbstbewusstsein. Nicht nur klar, sondern auch starr. Starr und trocken und immer bei sich. Abstrakt und gefühllos und immer bei sich... War es nicht so? War das nicht der Grund, warum die Ähren unsere Hände streicheln konnten – und wir ihre Zärtlichkeit gar nicht bemerkten? Lag es nicht hieran, dass die Ähren und das ganze Weizenfeld, der Wind, der Duft, der Sommertag uns gar nichts bedeuten konnten? Nicht in der Tiefe...?
Was war denn der Moment des Glücks? War es nicht der Moment, wo man Schönheit spürte? Die stille Schönheit des Moments, des Seins, in diesem Augenblick? Aber auch das Werden – das Reifen des Weizens, der leise Wind, der zum Sommer gehörte, aber auch gerade zu diesem Sommertag, zu dieser Stunde... War es nicht dies alles, was einen dann ... berührte?
Und war dies nicht genau das Glück, dieser entscheidende Moment? Die Berührung durch das, was uns umgab? War dies nicht gerade das Wunder? Dass es Momente gab, in denen alles, was wir wahrnahmen, uns berührte – und in dieser Berührung die Grenze zwischen uns und dem, was uns umgab, verschwamm?
War es nicht so, dass in dem Moment der Berührung die Welt, die uns umgab, uns in all ihrer Schönheit für einen Augenblick aufnahm? Wirklich aufnahm? So dass wir nicht nur ein ferner, abstrakter Gast in ihr waren, völlig allein mit uns und unserer Empfindungslosigkeit, sondern wirklich aufgenommen in ihr? Wir in ihr und sie um uns...
War dies nicht das Geheimnis der Zärtlichkeit der Ähren? Dass das Glück da begann, wo wir wirklich durch das Feld gingen, nicht nur räumlich, sondern mit allem, was wir wirklich waren... Und dass erst in dem Moment das reifende Feld wirklich um uns war, der leichte Sommerwind wirklich um uns war, die Ähren wirklich bei uns waren und wir nun erst ihre Zärtlichkeit spürten...
Wann aber waren wir einmal wirklich bei den Dingen? Wann waren wir so bei ihnen, dass wir sie nicht mehr als Dinge, als nüchterne Wahrnehmungsobjekte betrachteten, sondern dass alles um uns herum Leben gewann, intensive Gegenwärtigkeit? Wann waren wir selbst gegenwärtig, wirklich da...
War nicht dies das Geheimnis? Wirklich da zu sein? Und war dies nicht das Geheimnis des fehlenden Glücks? Dass man nie wirklich da war, in keinem Moment? Wo war man dann aber? Eingesperrt in das viel zu abstrakte Denken, Wahrnehmen, Bewusstsein... Aber in diesem Abstrakten war man weder wirklich da, noch war man wirklich da. Man war eigentlich gar nichts. Man bewegte sich durch die Welt, aber man berührte sie nicht wirklich, und man wurde von ihr auch nicht berührt.
Man konnte den Wind bemerken, die Ähren berühren, ja sogar ausreißen, man konnte den Sommer bemerken – und doch konnte man verzweifelt begreifen, dass man den Ähren, dem Wind, dem Sommertag, dem ganzen Augenblick nicht näher kam ... und sie alle einem auch nicht.
Um das Berührtwerden ging es. Aber wann wurde man berührt? Man konnte es nicht erzwingen. Man konnte nur spüren, dass man etwas loslassen und etwas intensivieren musste. Loslassen oder verwandeln musste man das, was einen sonst so hart außerhalb alles Übrigen stellte. Das Abstrakte. Das, was den Dingen ihre festen Namen gab, sie einordnete, was auch einen selbst einordnete. Ich bin hier, die Welt ist da. Getrennt... Ich sehe die Ähren. Ich will sie fühlen. Ich will den Sommertag spüren. Ich, ich, ich... Aber diesem Ich näherte sich der Sommertag nicht, und die Ähren schraken vor ihm zurück. Denn man war ja gar nicht bei ihnen.
Wurde man nicht nur in dem Moment berührt, wo man das Berührende erlebte? Aber was berührte denn? Und was wurde berührt? Konnte denn nicht nur das Herz berührt werden? Musste man also nicht, um überhaupt berührt zu werden, in sein Herz hinabsteigen? Musste man das reifende, vom Wind gestreichelte Getreidefeld nicht erst wieder mit dem Herzen erleben lernen? Aber wie machte man das?
Man wollte so gerne etwas fühlen – aber wie konnte man es? Man wollte das Glück, die Verbundenheit, das Berührtsein fühlen – aber stand man sich nicht noch immer fortwährend im Weg? Was gehörte denn dazu?
War dieser Wunsch, dieses Begehren, diese Sehnsucht nicht noch immer viel zu egoistisch, zu selbstbezogen? War es nicht noch immer so, dass man von der Natur, dem Weizenfeld, dem Sommertag forderte, es möge sich erschließen, es möge einen berühren? Wieviel war man dafür denn bereit, selbst zu geben? Konnte das Wunder der Berührung sich denn ereignen, wenn man sich selbst nicht auch gab? Konnte sich überhaupt jemals ein Wunder ereignen, wenn man nicht auch selbst alles hingab?
War denn nicht gerade dies das Wunder des Berührtwerdens, des glückerfüllten Berührtwerdens durch das, was einen umgab, durch diesen gegenwärtigen, unwiederbringlichen Moment? Dass man selbst auch alles hingab, was man hatte? Aber was hatte man denn zu geben? Was konnte man dem Sommertag, dem Wind, den Ähren geben – die doch bereits darauf warteten, unsere Handfläche nicht nur zu berühren und zu streifen, sondern wirklich zu streicheln?
Ja – was hatte man zu geben...? Hatte man etwas zu geben?
Wenn man in sich ging, musste man doch finden können, ob man selbst auch etwas zu geben hatte. Man selbst sehnte sich nach dem Glück, nach der Berührung, nach dem wirklichen Erleben des Momentes und seines Wunders, seines Zaubers. Die Sehnsucht war vielleicht sogar ein innerer Drang, eine verzweifelte Hoffnung – gegenüber sich selbst und gegenüber dem, was um einen war. Aber konnte man in einer solchen Stimmung, die doch auch etwas von innerer Gewalt hatte, diesen sanften Moment des Zaubers, diesen zarten Zauber des Moments erleben? Nein – und zwar, weil man noch immer nicht bereit war, auch etwas zu geben...
Aber was nur? Die Sehnsucht war einseitig, sie wollte etwas bekommen, sie hoffte auf etwas, sehnte sich nach etwas. Aber was konnte man geben?
Die Sehnsucht würde sich nie von selbst erfüllen – sie würde uns, je verzweifelter unser Verlangen werden würde, nur immer weiter von allem fortführen, was wir ersehnten. Aber was würde geschehen, wenn wir dies erkannten? Was würde geschehen, wenn wir spürten, dass wir keine Möglichkeit hatten, der Zärtlichkeit der Ähren und dem tiefen Erleben des Sommertages näher zu kommen ... wenn sie sich uns nicht selbst schenkten? Und wenn wir zugleich spürten, dass sie sich uns nie schenken würden und auch gar nicht schenken konnten, wenn wir ihnen nicht auch etwas entgegenbrachten? Was würde geschehen, wenn wir an diesen Punkt ... der Ohnmacht kämen?
Der Punkt der Ohnmacht würde das, was in uns wirksam war, verwandeln, ja umkehren. Die Ohnmacht war der Punkt, wo das eigene Wünschen, die eigene Sehnsucht, das eigene innere Streben aufhörte. Das Wunder aber war, dass gerade dann alles Übrige einem entgegenkommen konnte.
Aber warum? Weil wir selbst uns und den Dingen, dem Lebendigen um uns, entgegenstanden. Unsere Sehnsucht war noch immer eine Aktivität, die uns an uns selbst fesselte und die Dinge von uns fort stieß. Wir ersehnten zwar die Vereinigung mit der Welt, aber zugleich kamen wir von uns überhaupt nicht los. Denn noch immer waren wir nicht bereit, auch etwas zu geben.
In der Ohnmacht gaben wir dann etwas... Wir gaben unser Selbst; jenes fortwährende Wollen und Wünschen, das sogar noch in der Sehnsucht eine Art Erreichenwollen blieb, aber damit uns selbst von den Dingen getrennt hielt. Denn die Sehnsucht blieb immer mit dem abstrakten Denken und Wahrnehmen verbunden. Wir waren es ja selbst in unserer ganzen Abstraktion, die diese Sehnsucht hatten – es war im Grunde die Abstraktion selbst, die eine Sehnsucht nach dem lebendigen Erleben hatte, es aber nie erreichen konnte.
Im Punkt der Ohnmacht aber war es möglich, beides loszulassen – die fortwährende Sehnsucht, aber auch das fortwährend Abstrakte. Zumindest ein bisschen loszulassen. Man musste dies bemerken, darauf achten ... wie im Moment der Ohnmacht es geschah, dass man sich selbst zumindest ein kleines Stück losließ und so die Welt zumindest ein kleines Stück näherkommen konnte...
Aber dies war noch nicht alles, was man geben konnte. Es war schon viel – ein Stück von sich selbst; aber es war noch nicht alles. In der Ohnmacht gab man nicht nur die Sehnsucht auf, sondern auch den Hochmut, man könne durch inneres ‚Fühlen’, ‚Erleben’ der Welt näherkommen und so die Welt eigentlich zwingen, sich zu erschließen. Wenn man nicht bereit war, noch etwas zu geben, würde dies nie geschehen, niemals...
Im Grunde lag das Mysterium offen zutage. Denn wovon wurde man eigentlich berührt? In welchem Moment war man von etwas berührt? Es war der Moment ... wo man anfing, es zu lieben. Und dies war, fast, schon das ganze Geheimnis. Die wirkliche Berührung ereignete sich da, wo man das, was einen berührte, wirklich liebte. Es gab zwei Möglichkeiten: Entweder es entzündete sich eine innige Liebe zu dem, was man wahrnahm, und dies strömte über in den Moment der tiefen Berührung ... oder man empfand auf einmal eine innige Berührung, und dieser Moment strömte über in eine tief sich entzündende Liebe...
In Wirklichkeit waren beide Möglichkeiten eins, sie unterschieden sich nur in der Frage, was einem zuerst bewusst wurde. In dem einen Fall war einem der Moment der Berührung noch nicht bewusst, obwohl er schon da war, in dem anderen Fall war einem die Liebe noch nicht bewusst, obwohl sie schon da war. Berührung und Liebe waren eins...
Man konnte von nichts berührt werden, was man nicht liebte – und man konnte nichts lieben, von dem man nicht berührt wurde.
Aber ein Geheimnis gab es hier noch. Und das war das Wunder, dass hier kein Automatismus vorlag. Die Liebe war in Kategorien von Ursache und Wirkung oder von Zwangsläufigkeit und Notwendigkeit nicht zu fassen. Der Mensch konnte noch immer etwas tun. Sonst wäre es gar nicht möglich, von einem Zustand des Nicht-Berührtwerdens in einen Zustand des Berührtwerdens zu kommen. Für immer bliebe es entweder das Eine oder das Andere.
Was also war es, was man tun konnte, wenn man sich so sehr nach einem Berührtwerden durch das sehnte, was einen umgab? Und wenn dieses sich scheinbar entzog – weil man sich selbst eigentlich entzog? Was konnte man geben? Was war es, was mehr war als nur jener Teil des Selbstes, der in der Ohnmacht das eigene Sehnen aufgab, der in der Ohnmacht einen Teil der eigenen Abstraktheit aufgab? Was war mehr als das?
Es war die Liebe. Die Liebe öffnete alle Türen. Die Liebe erschloss alle Quellen. Die Liebe überwand alle Hindernisse. Die Liebe berührte die Dinge – und ihre Berührung lud die Dinge ein, sich einem zuzuwenden, auf dass auch sie einen berührten... Aber dies war nur im übertragenen, bildlichen Sinne gesprochen. In Wirklichkeit war dies eins und geschah im selben Moment. Und eigentlich tat die Liebe nur Eines: Sie kehrte unsere eigene Abwendung um.
Man mochte eine noch so große Sehnsucht nach einem Berührtwerden durch die Dinge haben, man kehrte sich selbst dennoch so lange von ihnen ab, bis man anfing, sich in Liebe ihnen zuzuwenden. Alles andere war überhaupt noch keine Zu-wendung...
Was also tat die Liebe? Sie wendete den Menschen den Dingen zu. Vorher stand er ihnen zwar gegenüber, aber er war ihnen nicht zugewandt...
Das war es, was man geben konnte. Die Liebe... Und dies war mehr als alle Sehnsucht, die den Menschen selbst doch noch am gleichen Ort bleiben ließ, allenfalls ein Wünschen war, ein Sehnen, aber nur in Gedanken, nur im Gefühl... In der Liebe jedoch wandte sich der ganze Mensch den Dingen zu. In der Liebe eilte er ihnen entgegen, in der Liebe war er es selbst, der die Dinge liebkoste, preiste und dankbar fühlte, sah und schaute.
Und wie sollten dann die Dinge nicht auch beginnen, ihn zu liebkosen und sich ihm zu geben, dankbar, ja jubelnd, dass der Mensch sie sah...
Die Liebe war das Einzige, was zu einer gegenseitigen Berührung führen konnte. Ohne die Liebe gab es kein Glück, es war einfach nicht möglich. Noch der kleinste Moment des Glücks entzündete die Liebe. Noch der kleinste Moment der Liebe entzündete das Glück...
Alles, was man tun musste, war also, mit Liebe durch ein Weizenfeld zu gehen. Mit Liebe den Wind zu spüren, mit Liebe diesen Sommertag, gerade diesen, mit Liebe die Ähren, die unter den Fingern hinwegstrichen. Liebe zu den Ähren, in deren Nähe man in diesem Moment sein durfte; die einen in ihre Nähe ließen, die es selbst waren, die einem dieses wunderbare Gefühl der Freiheit schenkten, zusammen mit dem Lufthauch, zusammen mit dem Himmel, zusammen mit der Sommerwärme ... wenn man nur auch sie liebte...
Und wiederum – vielleicht fühlte man den Moment der Freiheit, bevor sich die Liebe entzündete. Aber wenn man ihn fühlte, dann entzündete sich im selben Moment auch die Liebe zu allem, was um einen war, zu dem Wind, zu der Wärme, zu den Wolken, zu den Ähren...
Aber das Gefühl der Freiheit, das tiefe Erleben dieses einen Moments, in dem man das Glück empfand, war doch wiederum kein anderer Moment als der, in dem man begann, das, was einen umgab, dieses Weizenfeld, diesen Sommertag, zu lieben ... weil man ihm diesen Moment verdankte...
Wenn man also nicht von selbst zu diesem Moment des Glücks, diesem Moment der tiefen, reinen Freiheit kam, dann musste man zuerst die Liebe entfalten... Wenn man dies tat, würde der Moment des Glücks, der Freiheit und der tiefen Berührung notwendigerweise folgen...
Auch wenn es einem nicht bewusst wurde, war die Liebe immer das Erste und Einzige – notwendig und eine Folge war immer nur das Andere. Denn warum konnte man bei einem Durchstreifen eines sommerlichen Weizenfeldes dieses ungeheure Freiheitsgefühl, diese Befreiung von allen Sorgen und Gedanken des Alltags erleben? Ja, das konnte man sich einmal fragen...
Man erlebte es, weil einem das Weizenfeld, der laue Lufthauch auf einmal unendlich viel schenkte – und zwar eine unsagbare, allertiefste Schönheit. Indem man begann, diese zu sehen, zu fühlen, zu erleben, fühlte man die Freiheit... Denn es war die Schönheit, die so überwältigend war, dass sie einen die Sorgen und gewöhnlichen Gedanken vergessen ließ. Die Schönheit löschte sie aus... Aber die Schönheit entzündete eine ungeheure Liebe. Diese war also da, bevor das Erleben der Freiheit da war – und eigentlich war es die Liebe zu dieser Schönheit, die dann jenes unbeschreibliche Gefühl der Freiheit gab, nach sich zog...
Alles, was man brauchte, war also die Fähigkeit, Liebe zu entfalten; den Dingen wirkliche Liebe entgegenzubringen, entgegenzutragen. Das war es, was man geben musste, damit die Dinge sich selbst geben konnten...
Aber vielleicht war auch dies ja ein unüberwindliches Hindernis. Vielleicht wusste man gar nicht mehr, wie man diese Liebe entfalten konnte – oder hatte es noch nie gewusst. Aber natürlich hatte man es einmal gewusst. Denn ein Kind bringt immer wieder allem so viel Liebe entgegen – ein Kind kann dies noch, ja, es kann noch gar nicht anders...
Was aber konnte man tun, wenn man dies verlernt hatte? Das, was die Kinder taten – allem immer wieder Liebe entgegenzubringen...
Eine Möglichkeit war, sich hineinzuvertiefen in das, was die Kinder dann ‚taten’. Vielleicht konnte man dies selbst nicht mehr, zunächst, aber man konnte doch zumindest in sich gehen, um innerlich wiederzufinden, wie man es eigentlich machte, machen musste.
Eigentlich brauchte man Kinder nur zu beobachten, nur anzusehen, um selbst auch wieder zu wissen, wie das ‚ging’, worauf es ankam. Vielleicht konnte man es dann immer noch nicht wieder – aber man lebte sich zumindest wieder in die Erinnerung daran ein, wie man es einmal ‚gemacht’ hatte...
Womit hatte es denn zu tun? Was war dieses Kindliche, im besten Sinne? Es hatte mit dem Selbstvergessenen zu tun, aber auch mit dem Staunenkönnen. Im Staunen konnte aber auch der erwachsene Mensch sich wieder selbst vergessen, um in den Dingen aufzuwachen, mit den Dingen, vereint mit ihnen, berührt von ihnen. Staunen wurde zu Liebe. Was man liebte, das konnte man voller Staunen bewundern. Immer wieder ging es um die Frage: Wo entsprang die Liebe...
Der Mensch war so stolz auf sein abstraktes Denken und Fühlen. Er war so stolz darauf, dass er nicht mehr staunte, nicht mehr zu staunen brauchte, nicht mehr staunen konnte. Aber der Weg zur Liebe kehrte dies um. Man brauchte eine neue Sehnsucht nach dem Staunen. Die Sehnsucht öffnete dann die Tore für das Staunen selbst... Im Staunen gab der Mensch seinen Hochmut auf, der ihn über die Dinge erhob. Im Staunen gab er die Kälte auf, mit der er die Dinge erstarren ließ. Im Staunen neigte er sich wieder zu den Dingen, neigte sich ihnen zu, entfaltete seine ganze Zuneigung – und im Staunen schenkte er den Dingen Wärme, die die Dinge wieder belebte, lebendig machte. Er schenkte ihnen im Staunen seine Liebe – und die Dinge schenkten ihm ihr eigenes Leben zurück...
Es war eigentlich so einfach. Man musste nur bereit dazu sein, diesen Hochmut wirklich aufzugeben. Man musste bereit sein, sein Haupt zu neigen, sich den Dingen wirklich zuzuwenden, nicht noch immer irgendeinen Abstand behalten zu wollen. Man brauchte nur diese gewisse Demut, die mit der Liebe verbunden war. Es war gar nicht eigentlich Demut, aber es war ein Verzicht auf jeden Hochmut, der über den Dingen stehen wollte. Es war Liebe...
Ein anderer Weg zur Liebe führte über das ‚Schönfinden’. Es war eigentlich das Gleiche wie die Liebe. Kinder hatten so viel Liebe zur Welt, weil so vieles für sie einfach schön war – und es war schön, weil sie es liebten. Wenn ein Kind von einer Katze tief berührt war; wenn es begeistert auf eine Pfütze zurannte, und auch, wenn es unbedingt zu jenem Eisladen dort wollte – dann, weil all dies unglaublich schön war. Die Begriffe ‚süß’ oder ‚Spaß’ oder ‚lecker’ waren für Kinder nicht einfach nur Begriffe, es waren tiefe Erlebnisse, ein tiefes Berührtsein und eine ebenso tiefe Liebe ... zu dem Tier, zu den Elementen, dem Nassen, und zu dem Süßen, dem Leckeren.
Das Kind erlebte eine unmittelbare tiefe Sympathie, eine wirkliche Liebe – der Erwachsene hatte dann nur noch sehr abgeschwächte Gefühle, immer mehr spielte sich bei ihm alles nur im abstrakten Denken, Feststellen, im Kennen und Wissen ab. Das gab dem Erwachsenen Klarheit und Freiheit, aber er verlor so die Tiefe des Gefühls und die Realität des Wollens. Er fühlte vielleicht noch den Wunsch, die Katze zu streicheln, aber die Sympathie war nicht mehr so existentiell, dass er sich mit dem Tier innig verbunden fühlte. Und er würde gewiss nicht jauchzend zu springen beginnen und der Pfütze zueilen...
Und doch konnte man wieder lernen, die Schönheit der Dinge zu erkennen. Was berührte einen so an einem jungen Kätzchen? Was war dies, was nur ein junges Kätzchen an sich hatte, so unverwechselbar? Der Weg, sich auf solche Fragen wieder zu besinnen, war ein Weg zur Liebe. Denn man begann, die Schönheit von allem wieder zu sehen! Und man sah sie immer mehr, weil man überhaupt lernte, zu sehen, immer bewusster. Es war ein Erkennen der Unterschiede, der Feinheiten, der Qualitäten.
Was war es, was ein Kätzchen an sich hatte? Man musste ein Kätzchen nur beobachten, nur anschauen – dann sah man es doch. Man sah, was es war ... und man musste nur lernen, es wirklich auch zu sehen, das heißt, sich dessen bewusst zu werden, was man sah.
Das Sehenlernen war ein Lernen, immer bewusster zu sehen, immer mehr mit seinem Bewusstsein dabeizusein. Aber das war dann kein abstraktes Bewusstsein mehr, kein bloßes bewusstes Konstatieren, sondern es war ein bewusstes Dabeisein von einem selbst. Man selbst war nicht bloß der abstrakt konstatierende Intellekt, man selbst war der ganze Mensch – dieser musste dabeisein, wenn man ‚sah’. Der ganze Mensch hatte nicht nur ein gefühlloses Denken, er hatte auch ein gefühlvolles Fühlen, und er hatte ein Wollen, das noch über das Fühlen hinausgehen konnte, indem es in sich Begeisterung, ja Liebe entfalten konnte.
Dann sah man das, was ein kleines Kätzchen so unverwechselbar machte, weil man diese einzigartige Qualität nicht nur sah, sondern auch fühlte – und auch lieben lernte. Das Erkennen war dann nicht mehr nur denkend, sondern das Denken selbst nahm das erlebende Fühlen und den liebenden Willen in sich auf. Und dann sah man erst wirklich, weil man selbst, der ganze Mensch, beim Sehen das erste Mal wirklich dabei war.
Dann sah man dieses Verspielte, aber zugleich auch Anmutige, dieses unendlich Aufmerksame, dieses Zusammenspiel von gespanntem Erstarren und blitzschnellem Zupacken, aber alles noch ganz im Spiel, im Ausprobieren. Und man sah die Proportionen des Kätzchens, das unverwechselbare Köpfchen, die Augen, das Näschen, die Ohren, die feinen Haare. Man sah das alles, man fühlte erlebend die Qualitäten – und man konnte mit bewusster Liebe in dieses erkennende, erlebende Wahrnehmen des Kätzchens und seines ganzen Wesens eintauchen...
In jedes einzelne Detail konnte man immer bewusster erlebend eintauchen – und so immer bewusster wahrnehmen, erleben, fühlen und liebenlernen, was ein Kätzchen eigentlich war. Was es eigentlich war, was einen so eigentümlich berührte, wenn man ein Kätzchen wahrnahm.
Die Schönheit der Dinge... Es bedeutete, die Qualitäten erleben zu lernen. Bis in die kleinsten Einzelheiten hinein. Was empfand man, wenn man eine gerade Linie wahrnahm und anschaute? Was empfand man bei einer sanften Rundung? Was bei einer glatten Oberfläche? Was bei einer rauhen? Bei einer weichen? Was empfand man, wenn die Sonne im Meer unterging? Was, wenn sie hinter einem Berggipfel unterging? Was, wenn sie kurz hinter Wolken verschwand...
Immer mehr konnte man lernen, alles, was man sah, in seiner einzigartigen, unterschiedlichen Qualität erlebend wahrzunehmen. Dies war der Weg, die Schönheit der Dinge wirklich zu sehen.
Worin unterschied sich Anmut von Eleganz? Was unterschied Verspieltheit von Nervosität? Was unterschied Kraft und Plumpheit voneinander? Oder Plumpheit von Langsamkeit? Worin unterschied sich die Eleganz einer Libelle von der einer Gazelle – oder der eines Pfaus? Welches Tier hatte zugleich eine Anmut?
All diese Fragen führten auf einen Weg, auf dem das Fühlen wirklich fühlen lernte – und zugleich Bewusstsein bekam. Denn man konnte nicht anders, als sich über die Unterschiede klarzuwerden. Sonst sah man sie gar nicht wirklich. Man sah sie natürlich, aber sie blieben in ihrem Wesen unbewusst. Man konnte nicht sagen, was der Unterschied war. Jetzt aber lernte man dies, immer mehr... Fühlen und Denken vereinigten sich. Das Fühlen wurde erkennend, das Denken fühlend, die Qualitäten erlebend.
Welche Qualität hatte das Getreide? Warum war es nicht dasselbe, durch ein Weizenfeld zu gehen oder durch ein Rapsfeld zu gehen? Was war der Unterschied, in der Farbe, in der Gestalt, in der Berührung...? Welche Qualitäten konnte einem nur ein Getreidefeld geben? Was war mit dem Wissen, wozu das Getreide diente? Wie es verarbeitet wurde? Hatte auch dies für das Erleben eine Bedeutung?
Was empfand man, wenn vom Waldrand ein Kuckuck rief? Welche Qualität hatte dieser Ruf? Was war die Färbung des Tones, die Höhe, was war die Qualität dieses eigentümlichen Lautes? Was war die Qualität des Waldrandes? Des ganzen Erlebens von Feld, Waldrand und diesem Ruf? Was verband man noch alles damit?
Nicht um Analysen ging es hier, sondern um ein staunend empfindendes Eintauchen in die Qualitäten, in dem man immer mehr empfand, wie vielfältig ein einziger Eindruck allein schon in sich war, wieviel er enthielt. Die Wahrnehmung wurde dadurch immer tiefer, immer reicher, gesättigt von einer nie vorher bemerkten Fülle von Qualitäten...
Und dadurch lernte man, die Schönheit der Dinge wirklich zu sehen. Die Dinge hörten auf, ihre immer schon bekannte Außenseite zu zeigen – und sie begannen, ihr Inneres zu offenbaren. Noch die kleinste Einzelheit regte auf einmal zu bewusster, zu aufmerksamer, zu eintauchender Wahrnehmung an. Und es war nie zu Ende – immer konnte man noch Neues entdecken, erleben, wahrnehmen, bei allem, noch bei dem kleinsten Steinchen... Die Wahrnehmung und das Erleben der Qualitäten kam nie an ein Ende. An ein Ende kam man immer nur dann, wenn man glaubte, bereits zu wissen, was man sah... Wenn man aber einfach nicht aufhörte, zu sehen, zu schauen, zu empfinden, dann kam man einfach nicht zu Ende. Und das machte die Wahrnehmung lebendig. Das offenbarte fortwährend die Schönheit der Dinge – und entzündete die Liebe zu ihnen. Denn schon für das Wahrnehmen jeder Einzelheit brauchte man die Liebe, das Interesse, die Zuwendung.
Auf diesem Weg durchdrang sich die Wahrnehmung mit Liebe – und diese vermochte die innige, unendliche Schönheit der Dinge immer tiefer wahrzunehmen.
Das war also der andere Weg: das Sehenlernen der Schönheit, durch das Sehenlernen der Qualitäten, bis ins Einzelne. Und hier verband sich dann dieser Weg mit dem anderen – denn je mehr man wirklich die Qualitäten empfinden konnte, desto mehr lernte man auch das Staunen. Beidem zugrunde aber lag die Liebe. Die Liebe war es, die einen staunen ließ, und sie war es, die in die Qualitäten eintauchen konnte...
Um zur Liebe zu finden, brauchte man nur den guten Willen. Man hörte am Waldrand den Kuckuck. Konnte man nicht in Liebe in diesen eigentümlichen, unverwechselbaren Klang eintauchen? In Liebe innerlich zu diesem Vogel hineilen, mit seinem Hören, mit seinem Sinn, und einfach aufrichtige Dankbarkeit und Freude empfinden, dass er in diesem Moment rief und man ihn hören durfte...
Oder man ging an einem Feldweg entlang. Plötzlich sah man neben sich eine Bewegung. Man schaute hin und erblickte ei

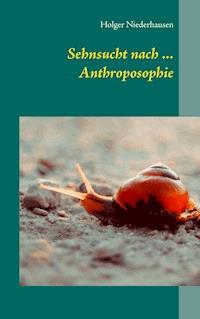

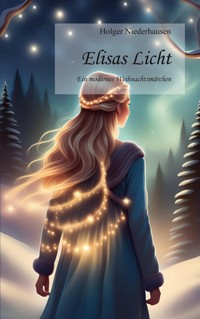
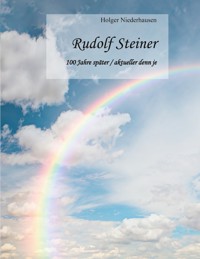







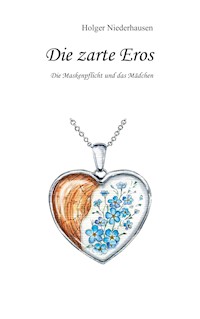



![Die [durchgestrichen: letzte] erste Unschuld - Holger Niederhausen - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9d69c6320692c771bc65edda9a41b406/w200_u90.jpg)