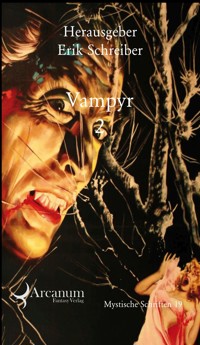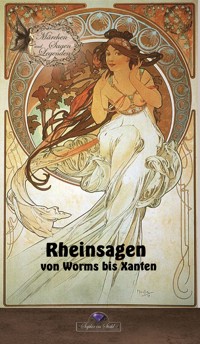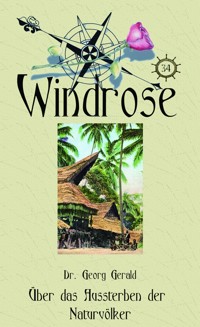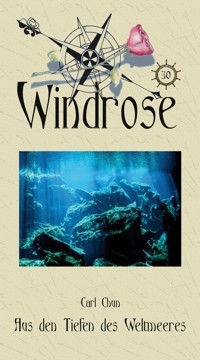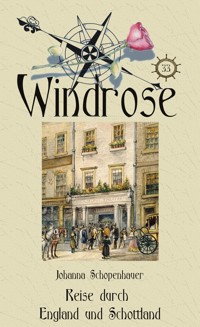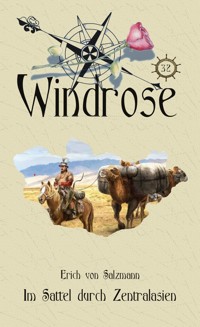4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Märchen Sagen und Legenden
- Sprache: Deutsch
In der besinnlichen Advents- und Vorweihnachtszeit rückt man wieder näher zusammen. Was liegt da näher als Weihnachtsmärchen zu lesen. Entweder selbst oder den Kindern und Enkelkindern vorzulesen. Das Gefühl, gemeinsam etwas zu erleben, und ist es nur in der Welt der Märchen, Sagen und Legenden, lässt die heile Welt neu entstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Märchen Sagen und Legenden
Weihnachtsmärchen
Saphir im Stahl
Märchen Sagen und Legenden 100
e-book: 245
Titel: Weihnachtsmärchen
Erscheinungstermin: 01.07.2024
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Julia Schiffler
Lektorat: Peter Heller
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Märchen Sagen und Legenden
Weihnachtsmärchen
Saphir im Stahl
Inhaltsverzeichnis
Friesisches Märchen Das Weihnachtsgeschenk
Deutsches Märchen Schneeblume
Ludwig Tieck Weihnacht-Abend
Isländische Volkssage Die Geschichte von Steinn Thruduvangi
Paul Heyse Eine Weihnachtsbescherung
Hans Christian Andersen Der Traum der alten Eiche
Gebrüder Grimm Die Wichtelmänner
Das Weihnachtsgeschenk
Es war einmal, vor langer Zeit, eine reiche Bäuerin. Bereits als junge Frau war sie Witwe geworden. Zuerst wollte sie nicht wieder heiraten, weil sie befürchtete, die Brautwerber hätten es nur auf ihr Geld abgesehen.
Sie betreute ihren Hof allein, nur mit einem Knecht als Helfer. Ein zuverlässiger junger Mann, nur wenige Jahre jünger als sie. Sie mochte ihn gern und konnte auf dem Hof nicht ohne ihn auskommen. Sie überlegte, ihn zu heiraten, wusste aber nicht, wie sie ihm dies verdeutlichen sollte. Damals war es nicht üblich, dass die Frau den Antrag stellte. Er wollte eigentlich auch gern, aber ein armer Knecht kann doch seine reiche Bäuerin nicht heiraten.
Daher geschah nichts. Langsam kam wieder der Dezember und mit ihm die Weihnachtszeit. Als der Heilige Abend kam, meinte die Bäuerin, er soll doch heute Abend zu ihr in die Gute Stube kommen, es könnte ja sein, dass der Weihnachtsmann ihm ein Geschenk bringe. Der Knecht hielt nichts davon. Aber die Bäuerin redete so lange auf ihn ein, bis er zusagte, am Abend in die Gute Stube zu kommen.
Am Abend ging er in die Stube und fand die Bäuerin vor. Etwas verlegen stand sie vor ihm, eine große rote Schleife umgebunden. Der Knecht verstand sofort und ein paar Monate später wurde Hochzeit gefeiert.
Schneeblume
Es war einmal eine Königstochter mit Namen Schneeblume. Sie wurde so genannt, weil sie weiß wie Schnee und am Heiligabend geboren war. Eines Tages wurde ihre Mutter krank und sie ging in den Wald, um Kräuter zu sammeln. Wie sie an einem alten, hohlen Baum vorüber ging, flog ein Schwarm wilder Bienen heraus und bedeckte sie von Kopf bis Fuß. Aber sie stachen nicht, sondern trugen Honig auf ihre Lippen und ihr ganzer Leib strahlte vor Schönheit.
Weihnacht-Abend
Man kann annehmen, dass, so sehr poetische Gemüter darüber klagen, wie in unserer Zeit alles Gedicht und Wundersame aus dem Leben verschwunden sei, dennoch in jeder Stadt, fast allenthalben auf dem Lande, Sitten, Gebräuche und Festlichkeiten sich finden, die an sich das sind, was man poetisch nennen kann, oder die gleichsam nur eine günstige Gelegenheit erwarten, um sich zum Dichterischen zu erheben. Das Auge, welches sie wahrnehmen soll, muss freilich ein unbefangenes sein, kein stumpfes und übersättigtes, welches Staunen, Blendung, oder ein Unerhörtes, die Sinne durch Pracht oder Seltsamkeit Verwirrendes mit dem Poetischen verwechselt.
Nur in katholischen Ländern sieht man große, imponierende Kirchenfeste, nur in militärischen glanzvollen Übungen und Kriegsspiele der Soldaten, in Italien haben die öffentlichen Feierlichkeiten der Priester, die mit dem Volke eins sind, so wie die Nationalfeste eher zu-, als abgenommen, im Norden, namentlich in Deutschland, werden öffentliche Aufzüge, Freuden der Bürger und dergleichen immer mehr vergessen, das Bedürfnis trägt den Sieg davon über heitre Fröhlichkeit, der Ernst über den Scherz.
Als ich ein Kind war, so erzählte Medling, ein geborner Berliner, war der Markt und die Ausstellung, wo die Eltern für die Kinder oder sonst Angehörigen, Spielzeug, Näschereien und Geschenke zum Weihnachtsfeste einkauften, eine Anstalt, deren ich mich immer noch in meinem Alter mit großer Freude erinnere. In dem Teile der Stadt, wo das Gewerbe am meisten vorherrschte, wo Kaufleute, Handwerker und Bürgerstand vorzüglich ein rasches Leben verbreiten, war in der Straße, welche von Köln zum Schlosse führt, schon seit langer Zeit der Aufbau jener Buden gewöhnlich, die mit jenem glänzenden Tand als Markt für das Weihnachtsfest ausgeschmückt werden sollten. Diese hölzernen Gebäude setzten sich nach der langen Brücke, so wie gegenüber nach der sogenannten Stechbahn fort, als rasch entstehende, schnell vergehende Gassen. – Vierzehn Tage vor dem Feste begann der Aufbau, mit dem Neujahrstage war der Markt geschlossen, und die Woche vor der Weihnacht war eigentlich die Zeit, in welcher es auf diesem beschränkten Raum der Stadt am lebhaftesten herging, und das Gedränge am größten war. Selbst Regen und Schnee, schlechtes und unerfreuliches Wetter, auch strenge Kälte konnten die Jugend wie das Alter nicht vertreiben. Hatten sich aber frische und anmutige Wintertage um jene Zeit eingefunden, so war dieser Sammelplatz aller Stände und Alter das Fröhlichste, was der heitre Sinn nur sehen und genießen konnte, denn nirgend habe ich in Deutschland und Italien etwas dem Ähnliches wieder gefunden, was damals die Weihnachtszeit in Berlin verherrlichte.
Am schönsten war es, wenn kurz zuvor Schnee gefallen, und bei mäßigem Frost und heiterem Wetter liegen geblieben war. Alsdann hatte sich das gewöhnliche Pflaster der Straße und des Platzes durch die Tritte der unzähligen Wanderer gleichsam in einen marmornen Fußboden verwandelt. Um die Mittagsstunde wandelten dann wohl die vornehmeren Stände behaglich auf und ab, schauten und kauften, luden den Bedienten, welche ihnen folgten, die Gaben auf, oder kamen auch nur wie in einem Saal zusammen, um sich zu besprechen und Neuigkeiten mitzuteilen. Am glänzendsten aber sind die Abendstunden, in welchen diese breite Straße von vielen tausend Lichtern aus den Buden von beiden Seiten erleuchtet wird, dass fast eine Tageshelle sich verbreitet, die nur hie und da durch das Gedränge der Menschen sich scheinbar verdunkelt. Alle Stände wogen fröhlich und lautschwatzend durcheinander. Hier trägt ein bejahrter Bürgersmann sein Kind auf dem Arm und zeigt und erklärt dem laut jubelnden Knaben alle Herrlichkeiten. Eine Mutter erhebt dort die kleine Tochter, dass sie sich in der Nähe die leuchtenden Puppen, deren Hände und Gesicht von Wachs die Natur anmutig nachahmen, näher betrachten könne. Ein Kavalier führt die geschmückte Dame, der Geschäftsmann lässt sich gern von dem Getöse und Gewirr betäuben, und vergisst seiner Akten, ja selbst der jüngere und der ältere Bettler erfreut sich dieser öffentlichen, allen zugänglichen Maskerade, und sieht ohne Neid die ausgelegten Schätze und die Freude und Lust der Kinder, von denen auch die geringsten die Hoffnung haben, dass irgendetwas für sie aus der vollen Schatzkammer in die kleine Stube getragen werde. So wandeln denn Tausende, scherzend, mit Planen zu kaufen, erzählend, lachend, schreiend, den süßduftenden mannigfaltigen Zucker- und Marzipan-Gebäcken vorüber, wo Früchte, in reizender Nachahmung, Figuren aller Art, Tiere und Menschen, alles in hellen Farben strahlend, die Lüsternen anlacht; hier ist eine Ausstellung wahrhaft täuschenden Obstes, Aprikosen, Pfirsiche, Kirschen, Birnen und Äpfel, alles aus Wachs künstlich geformt; dort klappert, läutet und schellt in einer großen Bude tausendfaches Spielzeug aus Holz in allen Größen gebildet, Männer und Frauen, Hanswürste und Priester, Könige und Bettler, Schlitten und Kutschen, Mädchen, Frauen, Nonnen, Pferde mit Klingeln, ganzer Hausrat, oder Jäger mit Hirschen und Hunden, was der Gedanke nur spielend ersinnt, ist hier ausgestellt, und die Kinder, Wärterinnen und Eltern werden angerufen, zu wählen und zu kaufen. Jenseits erglänzt ein überfüllter Laden mit blankem Zinn (denn damals war es noch gebräuchlich, Teller und Schüsseln von diesem Metall zu gebrauchen), aber neben den polierten und spiegelnden Geräten blinkt und leuchtet in Rot und Grün, Gold und Blau, eine Unzahl regelmäßig aufgestellter Soldaten, Engländer, Preußen und Kroaten, Panduren und Türken, prächtig gekleidete Paschas auf geschmückten Rossen, auch geharnischte Ritter und Bauern und Wald im Frühlingsglanz, Jäger, Hirsche und Bären und Hunde in der Wildnis. Wurde man schon auf eigne, nicht unangenehme Weise betäubt, von all dem Wirrsal des Spielzeuges, der Lichter und der vielfach schwatzenden Menge, so erhöhten dies noch durch Geschrei jene umwandelnden Verkäufer, die sich an keinen festen Platz binden mochten, diese drängen sich durch die dicksten Haufen, und schreien, lärmen, lachen und pfeifen, indem es ihnen weit mehr um diese Lust zu tun ist, als Geld zu lösen. Junge Burschen sind es, die unermüdet ein Viereck von Pappe umschwingen, welches, an einem Stecken mit Pferdehaar befestigt, ein seltsam lautes Brummen hervorbringt, wozu die Schelme laut: „Waldteufel kauft!“ schreien. Nun fährt eine große Kutsche mit vielen Bedienten langsam vorüber. Es sind die jungen Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses, welche auch an der Kinderfreude des Volkes Teil nehmen wollen. Nun freut der Bürger sich doppelt, auch die Kinder seines Herrschers so nahe zu sehen; alles drängt sich mit neuem Eifer um den stillstehenden Wagen.
Jedes Fest und jede Einrichtung, so beschloss Medling seinen Bericht, wächst mit den Jahren, und erreicht einen Punkt der Vollendung, von welchem es dann schnell, oder unvermerkt wieder hinabsinkt. Das ist das Schicksal alles Menschlichen im Großen, wie im Kleinen. Soviel ich nach den Erinnerungen meiner Jugend und Kindheit urteilen darf, war diese Volksfeierlichkeit von den Jahren 1780 bis etwa 1793 in ihrem Aufsteigen und in der Vollkommenheit. Schon in den letzten Jahren richteten sich in näheren oder entfernteren Straßen Läden ein, die die teureren und gleichsam vornehmeren Spielzeuge zur Schau ausstellten. Zuckerbäcker errichteten in ihren Häusern anlockende Säle, in welchen man Landschaften aus Zuckerteig, oder Dekorationen, später ganze lebensgroße mythologische Figuren, wie in Marmor ausgehauen, aus Zucker gebacken sah. Ein prahlendes Bewusstsein, ein vornehmtuendes Überbieten in anmaßenden Kunstproduktionen zerstörte jene kindliche und kindische Unbefangenheit, auch musste Schwelgerei an die Stelle der Heiterkeit und des Scherzes treten. Doch ist mit allen diesen neuern Mängeln, so endigte unser Freund seinen Bericht, diese Christ-Zeit in Berlin, vergleicht man das Leben dieser fröhlichen und für Kinder so ahndungsreichen Tage, mit allen andern Städten, immer noch eine klassische zu nennen, wenn man das Klassische als den Ausdruck des Höchsten und Besten in jeglicher Art gebrauchen will.
Diese Schilderung des Freundes, bei der vielleicht mancher denkt: „Wie viel Worte wegen einer Kinderei!“, sollte einer kleinen unbedeutenden Geschichte zur Einleitung dienen, welche sich an dem Heiligen Abend vor Weihnachten im Jahre 1791 in Berlin in der Nähe des erst geschilderten Schauplatzes zutrug.
In einem Dachstübchen saß bei einem bescheidenen Lichte eine alte Frau, welche mit großer Emsigkeit nähte, und nur selten von der Arbeit aufsah. Ihr Kind, ein kleines Mädchen von sechs Jahren, stand am kleinen Fenster und erfreute sich des Scheines, den es seitwärts von der aufleuchtenden breiten Straße her beobachten konnte, denn das Eckhaus stand diesem Schauplatz der Weihnachtsfestlichkeit nahe genug, dass man hier, selbst in dieser Höhe, noch das Getreibe wie ein Summen oder verhallendes Getöse, vernehmen konnte, und der Glanz der vielen Lichter von dorther das Fenster noch streifte, an welchem die Kleine beobachtend stand. Sie freute sich an den Karossen, welche vorbei fuhren, vorzüglich an denen, deren Bediente Fackeln trugen, sie lauschte auf das ferne Getöse und erwartete mit Ungeduld den Augenblick, in welchem sie sich mit der Mutter ebenfalls auf den vollgedrückten Schauplatz begeben würde. Es war aber noch zu früh, denn man hatte an diesem Tage, der zu den kürzesten und finstersten des Jahres gehörte, nur eben erst das Licht angezündet.
„Ach, wie hell“, rief die Kleine plötzlich.
„Was ist Dir?“, fragte die Mutter.
Da unten, in dem großen Hause, sagte das Kind, zünden sie schon den Weihnachten an. Die Leute, die mit den beiden schönen Kindern erst vor acht Tagen da eingezogen sind. Die putzen recht früh ihren Weihnachten auf.
„Die reichen Leute“, antwortete die Mutter, ohne von ihrer Arbeit aufzusehen, „können den Kindern diesen Abend freilich sehr herrlich machen. Sie haben auch wohl Gesellschaft dazu eingeladen.“
„Große Leute“, bemerkte das Kind, „passen nicht recht dazu, wenn's nicht auch Eltern sind, die ihre Kinder mitbringen.“
„Sie freuen sich doch auch“, sagte die Mutter an der Freude der Kleinen.
„Das dauert nicht lange“, antwortete das Kind, „sie sehen die Lichter und Spielsachen an, reden ein bisschen darüber, und gleich kommen sie dann mit ihren altklugen Gesprächen und politischen Neuigkeiten, wie sie es nennen. Das habe ich wohl im vorigen Jahr gemerkt, wie wir noch in dem kleinen Städtchen wohnten. Auch kann ich mich eigentlich an kein früheres Weihnachten erinnern. Was weiß doch so ein großer, ausgewachsener Mensch, was alles in solchen Püppchen steckt.“
„Minchen“, sagte die Mutter, „nachher gehen wir aus, Du sollst noch einmal alle die Herrlichkeiten da unten ansehen, und ich habe einen ganzen Taler aufgehoben, um auch für Dich, mein Engelchen, einzukaufen“.
Die Kleine sprang zur Mutter hin, küsste sie und klatschte dann lebhaft in die Hände. „Einen ganzen harten Taler!“, rief sie, „ei! Dafür können wir ja aller Welt Herrlichkeit einkaufen. Du bist aber gut, Mütterchen: gar zu gut! Es ist eigentlich zu viel. Wir brauchten es wohl zu nötigeren Dingen, nicht wahr?“
„Freilich wohl“, sagte die Mutter seufzend, „ich möchte Dir aber doch auch gern eine recht große Freude machen.“
„Gehen wir bald?“, rief das Kind.
„Du weißt“, sagte die Mutter, „ich muss noch erst die alte Frau Gerstner abwarten. Sie ist immer so freundlich gegen uns, und sie würde mit Recht böse werden, wenn wir nicht noch ein Stündchen blieben. Sie wollte schon nach Tisch kommen, sie muss abgehalten sein“.
„Sie ist gut“, sagte die Kleine, „aber der Bruder! O Mutter, warum hat doch wohl Gott solche unausstehliche Menschen geschaffen?“
Die Mutter, so ernst sie gestimmt war, musste lächeln. „Sie machen sich wohl erst selbst so, sagte sie dann: Der Schöpfer meint es wohl mit allen gut, dass sie angenehm und liebreich sein könnten.“
„Ich fürchte mich vor ihm“, sagte die Kleine, „und auch vor unserm Wirth unten. Tun die Leute nicht immer, als wäre man boshaft und gottlos, wenn man nur arm ist. Wenn ich so recht, recht reich wäre, da wollte ich einmal zeigen, wie man es machen müsse. So höflich wollte ich sein, so angenehm und mildtätig. Alle Leute, besonders die Armen, sollten eine Freude haben, wenn sie mich nur zu sehen kriegten. – Aber warum, Mütterchen, werden wir denn meine Bescherung mir so gar spät aufputzen?“
„Komm einmal her, mein Kind“, sagte die Mutter nach einer Pause, indem sie die Arbeit niedergelegt hatte; „lass uns einmal vernünftig miteinander sprechen, Du bist ein kluges Kind und wirst wohl verstehn, wie ich es meine. Sieh, ich bin recht arm, jetzt so, wie ich es ehemals nicht war. Nun bin ich meinem Wirt unten noch von vorigem Vierteljahr die Miete schuldig, der Bruder der guten Frau Gerstner, der Herr Sambach, hat mir auf ihre Bitte einiges Geld vorgeschossen, um das er mich auch oft dringend mahnt: Beide kann ich jetzt noch nicht bezahlen. Kämen sie nun zufällig zu mir herauf, und das kann ja jeden Augenblick geschehen, so wüsste ich nicht, was ich antworten sollte, wenn sie hier eine große Festanstalt von Lichtern und Geschenken antreffen würden. Darum gehen wir später, weil die Frau Gerstner noch zu mir kommt, und ganz spät, wenn alles schläft, oder in der eignen Familie oder fremder den Abend feiert, putzen wir unser Stübchen hier ein bisschen auf. Das ist das Elend der Armut, dass sie vor harten Menschen sich immer noch ärmer und bettelhafter anstellen muss, damit man von ihnen, auch wenn man ihnen nichts schuldig ist, nicht noch Vorwürfe anhören muss. Und nun gar die, die von uns etwas zu fordern haben.“
Das Kind sah vor sich nieder und schwieg still. „Bist Du verdrüsslich?“, fragte die Mutter.
„Nein“, sagte die Kleine, indem sie die großen Augen munter aufschlug, und sich zu lächeln zwang: „gar nicht verdrüsslich, aber doch traurig, dass ich freilich nicht so ausgelassen fröhlich sein werde, wie ich es mir heut den ganzen Tag und schon gestern und vorgestern vorgenommen hatte. Als wir uns mal da draußen im Wald verirrt hatten, voriges Jahr, ehe wir noch nach Berlin kamen, wie sahen wir uns an, wie wünschten wir nur einem einzigen Menschen zu begegnen, der uns wieder zurechtweisen könnte. Da kam nach langer Zeit, als ich weinte, und immer stärker weinte, ein wilder schwarzer Mann, ein Kohlenbrenner aus dem Busch, und es war uns, als wenn die Sonne aufginge; denn nun brachte uns der auf den rechten Weg. So dachte ich denn damals in meiner Dummheit: ach! Was muss das herrlich sein, in einer großen, großen Stadt zu wohnen, wo man nichts als Menschen und Menschen sieht, dass sie uns trösten, wohltun und uns erfreuen. Und nun sitzen wir so recht mitten unter den Menschen, und sie machen uns nur betrübt, wir müssen uns vor ihnen fürchten, wie im dunklen Wald.“
„Man ist oft“, erwiderte die Mutter seufzend, „im Gedränge der Menschen am einsamsten. Jeder hat mit sich und seiner eigenen Not zu tun und den Reichen und Vornehmen ist am wohlsten, wenn sie von uns nichts wissen und erfahren. Man sollte denken, alle Einrichtungen und Gesetze wären nur dazu gemacht, dass wir ihnen ja nicht zu nahe kommen sollen.“
Jetzt klopfte es an die Tür, und die erwartete Frau Gerstner trat herein. Das Kind, welches recht gut Blicke und Mienen der Mutter verstand, ging, nachdem es die eintretende alte Frau anständig begrüßt hatte, in das Kämmerchen, welches noch vom Vormittag her warm war, und wo die Betten standen. Minchen zündete sich selbst recht geschickt die Lampe an, und entfernte sich, um ihre Leseübung fortzusetzen, und von Zeit zu Zeit durch das verschlossene Fenster auf die Straße hinabzusehen.
„Ich bringe Ihnen keine Hülfe, liebe Frau Nachbarin“, begann die Fremde, denn mit meinem Bruder ist ein für alle Mal nichts anzufangen. Mein Mann hat nichts übrig, wie Sie wissen, und wenn er es hätte, würde er es nicht so zweifelhaft anlegen wollen. Mein eigensinniger Bruder will aber die fünf Taler, die Sie ihm noch schuldig sind, fahren lassen, wenn Sie auf seinen Vorschlag eingehen mögen.“
„Liebe Freundin“, sagte die Mutter mit traurigem, aber bestimmten Ton, „ich kann es nicht, wie Sie ja selbst einsehen müssen. Mit meiner schwachen Gesundheit mich in einen offenen Laden hinsetzen und die Käufer abwarten, bei dieser Witterung – und was sollte nachher aus meinem Kinde werden?“
„Liebe arme Frau“, erwiderte jene, „Sie haben freilich Recht, und doch auch wieder Unrecht. Ehe man ersäuft, rettet man sich doch lieber für den Augenblick auf einem schwachen Brett; vielleicht kommt nachher bessere Hilfe. Sie sehen ja doch, dass es mit der Stickerei nicht geht und ausreicht. Es ist wahr, Sie machen es schöner und besser, als ich es noch gesehen habe, aber Sie sind nicht persönlich mit den Vornehmen, oder auch den großen Kaufleuten bekannt. Der Bürgersmann braucht dergleichen nur selten, und so müssen Sie es immer auf Geratewohl unter dem Preise Leuten hingeben, die damit herumlaufen und es anzubringen suchen.“
„Sie haben Recht“, antwortete die Mutter, ich habe aber immer gehofft, Ihr Bruder, oder Ihr Mann, oder der Hauswirt hier unten, würde mir eine Stelle als Haushälterin bei einem Kaufmann, Witwer oder wohlhabenden Bürger ausfinden können, wohin ich dann auch mein Kindchen mitnehmen könnte.“