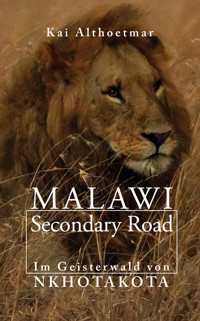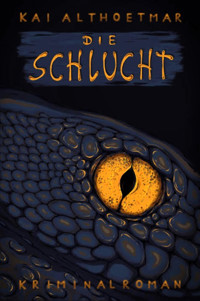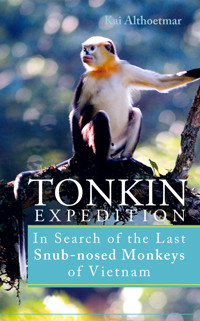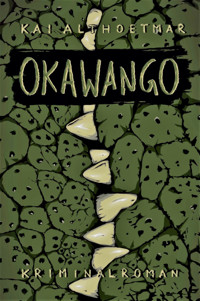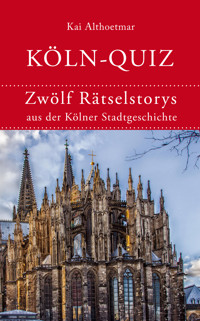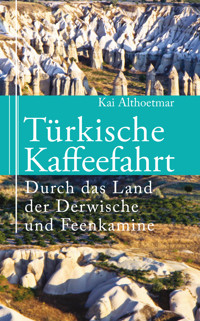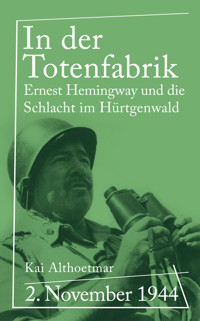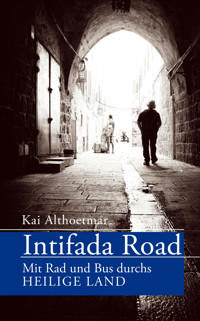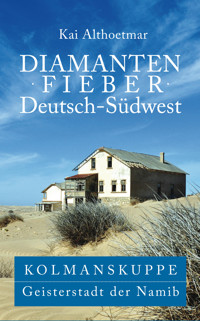7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nature Press
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ist Australiens Dingo ein Hund, ein Wolf oder eine eigene Art? Töten Löwen wirklich den Großteil eines jeden Geparden-Wurfs? Mit welchen Strategien geht der Fuchs dem Menschen aus dem Weg? Warum erschwert der Klimawandel den Eisbären nun auch die Fortpflanzung? Wie entwickeln sich Spezies auf Inseln im Laufe der Evolution? Und was läßt eine Schlangenpopulation in Florida kannibalisch werden? Feldforscher bringen laufend Erhellendes und Überraschendes aus dem Reich der wilden Tiere ans Tageslicht. Das Buch stellt neueste zoologische Forschungsergebnisse aus der weltweiten Zoologie in fünfzig Einzelgeschichten unterhaltsam, spannend und auch für Laien verständlich dar - ergänzt um Auszüge aus Interviews, die der Autor mit den Wissenschaftlern geführt hat. Eine so verblüffende wie fesselnde Rundreise durch die weltweite zoologische Forschung. - Illustriertes eBook mit zahlreichen Fotos. Auch als Taschenbuch- und Hardcoverausgabe erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Wunderwelt der Tiere
Kai Althoetmar
Wunderwelt der Tiere
Verblüffendes aus der zoologischen Forschung
Impressum:
Titel des Buches: „Wunderwelt der Tiere. Verblüffendes aus der zoologischen Forschung“.
Auch als Taschenbuch und Hardcoverausgabe erhältlich.
Ersterscheinungsjahr: 2018.
Inhaltlich Verantwortlich:
Verlag Nature Press
Kai Althoetmar
Am Heiden Weyher 2
53902 Bad Münstereifel
Deutschland
Alle Texte: © Kai Althoetmar.
Titelfoto: Schneeleopard. Foto: Bernhard Landgraf, CC-BY SA 3.0.
Verlag und Autor folgen der bis 1996 allgemeingültigen und bewährten deutschen Rechtschreibung.
Inhaltsverzeichnis:
1. Weder Wolf noch Hund. Australische Forscher weisen nach, daß der Dingo eine eigene Art ist.
2. Ein halber Freispruch für Isegrim. Iran: Wölfe fressen vor allem verendetes Nutzvieh und Pflanzliches.
3. In eisigen Höhen. Forscher lösen im Himalaya das Rätsel um die Koexistenz von Leopard und Schneeleopard.
4. Bloß nicht dem Fuchs begegnen. Um ihre Todfeinde zu meiden, jagen Altaiwiesel in Pakistans Pamirgebirge tagsüber.
5. Wer hat Angst vorm Nebelparder? Borneo: Wo Sunda-Nebelparder ausbleiben, machen Bartschweine die Nacht zum Tag.
6. Appetit auf Hund, Pferd und Kuh. In China ernähren sich Amurtiger ganz anders als in Rußland.
7. Wald ohne Tiger. In Nepal sind Tiger weit weniger verbreitet als bisher angenommen. Die Beutetierdichte ist entscheidend für ihr Vorkommen.
8. Appetit auf den Hausbüffel. Nepal: Für Viehrisse sind meist Leoparden und nicht Tiger verantwortlich.
9. Nur Fell und Knochen bleiben übrig. Tiger brauchen weniger Beutetiere als bislang angenommen.
10. Jedes Dritte kommt durch. Löwe und Gepard können doch koexistieren. Die Überlebenschancen neugeborener Geparde sind siebenmal höher als bislang angenommen.
11. Mit dem Schäferhund in die Savanne. Wo jedes andere Mittel versagt: Trainierte Suchhunde spüren in Afrika Geparden auf.
12. Gemeinsam sind sie furchtlos. Gnu, Büffel & Co.: Männliche Geparde verbünden sich zur Jagd auf große Beutearten.
13. Büffel tot, Reißzahn hin. Afrikas Raubtiere: Je gefährlicher die Art, desto schlechter die Zähne.
14. Löwenmänner brauchen Konkurrenz. Abschüsse durch Viehzüchter lassen Löwenbestände in Namibia genetisch verarmen.
15. Auch Aas kann sehr lecker sein. Wo Löwenbestände zunehmen, stellen Hyänen das Jagen weitgehend ein.
16. In die Falle getappt. Raubkatzen in freier Wildbahn zu zählen, ist knifflig. Schweizer Forscher erproben beim Luchs-Monitoring in den Alpen neue Zählmethoden. Vorherige Schätzungen der Bestände scheuer Raubkatzen waren oft allzu optimistisch.
17. Hauptsache Ruhe im Bau. Luchse mit Nachwuchs meiden Menschen um jeden Preis.
18. Erst eingewandert, dann ausgelöscht. In Spanien koexistierten einst zwei Luchsarten. Überlebt hat die schwächere.
19. Zwei Feinde fürs Leben. USA: In den Rocky Mountains engen Wölfe den Lebensraum der Pumas ein.
20. Beutelratte mit Biß. Forscher ermitteln in Südamerika das lebende Gegenstück zu prähistorischen Säbelzahnkatzen.
21. Im Eis verduftet. Eisbären finden durch Duftspuren zueinander, weisen Forscher erstmals nach. Dazu brauchen sie im Frühjahr intaktes Packeis. Der Klimawandel erschwert der Art nun auch die Fortpflanzung.
22. Meister Petz auf der Müllkippe. Braunbären reagieren unterschiedlich auf menschengemachte Nahrungsangebote.
23. Winterbuffet macht müde Bären munter. Zufütterung verkürzt die Winterruhe von Braunbären in den Dinarischen Alpen deutlich.
24. Friedliche Koexistenz. Der Vormarsch der Goldschakale nach Mitteleuropa muß für Füchse keine Konkurrenz bedeuten.
25. Landkarte der Angst. Den Tagesrhythmus von Füchsen prägt nicht das Beuteangebot, sondern der Mensch.
26. Alt werden die wenigsten. Frankreich: Fallenjagd und Autos gefährden den Bestand von Stein- und Baummarder.
27. Dann lieber tagsüber fischen. Patagonien: Wo Nerze auf Otter treffen, ändern sie ihren Lebensrhythmus.
28. Schreck, laß nach. Streß durch Freßfeinde kann die Fortpflanzung von Säugern noch Generationen später lähmen.
29. Der Trend geht zum City-Apartment. Wildkaninchen in Städten hausen ganz anders als auf dem Land.
30. Im Unterholz ist die Bache sicher. Treibjagden wirbeln die Sozialstruktur von Wildschweinen durcheinander.
31. Das Gesetz des letzten Urwalds. Wildschweine: Wo die Jagd auf Bachen ausbleibt, gesellen sich mehr Keiler zu den Rotten.
32. Nachruf der Evolution. Sikahirsche paaren sich gerne mit Rothirschen.
33. Im Winter ist Familientreffen. Je enger Rehe miteinander verwandt sind, desto mehr gesellen sie sich zueinander - außer zur Brunftzeit.
34. Kleiner Hirsch, großes Problem. Von fünf auf über 50.000: Großbritanniens Muntjak-Plage geht auf wenige ausgesetzte Tiere zurück und droht sich in Kontinentaleuropa zu wiederholen.
35. Bambi ohne Angst. Weißwedelhirsche zeigen wenig Scheu vor Menschen.
36. Lieber hungern als gefressen werden. Saigaantilopen nehmen zum Schutz vor Raubtieren viele Nachteile in Kauf.
37. Durstige Jäger der Nacht. Bayerischer Wald: Auch nährstoffarme Gewässer sind für heimische Fledermäuse überlebenswichtig.
38. Schnell verduftet. Schon der Geruch von Ameisen läßt Spinnen die Flucht ergreifen. Schädlinge verlieren damit Freßfeinde.
39. Verkaterte Insel. Azoren: Verwilderte Katzen plündern Seevogelgelege. Forscher sehen nur Ausrottung als Ausweg.
40. Im Süden bleibt es doch am schönsten. Trotz Klimawandels meiden Kormorane Grönlands Norden.
41. Ein sehr berechnender Vogel. Jagen nach Plan: Königspinguine bereiten ihre Tauchgänge strategisch vor.
42. Kleine Insel, große Echsen. Evolution auf Inseln: Wüstenechsen mit Revier werden im Laufe der Generationen größer. Ressourcen und nicht Freßfeinde entscheiden über die Entwicklung der Arten, fanden US-Forscher in der Wüste Nevada heraus.
43. Lurchi, wie er schrumpft und wächst. US-Forscher weisen erstmals bei Amphibien das Schrumpfen von Tieren nach.
44. Größere Mütter, größere Chancen. Die Überlebenschancen junger Wüstenschildkröten steigen analog zur Körpergröße der Mütter.
45. Bloß schnell aus dem Ei heraus. Bruttemperaturen bestimmen die Entwicklung von Schildkröten.
46. In der Wüste gibt es keine Fastenzeit. Weibliche Texas-Klapperschlangen jagen und fressen auch mit Nachwuchs im Bauch.
47. Schwarze Farbe, schneller Tod. Melanismus bedeutet für Aspisvipern in den Alpen Fluch und Segen.
48. Mit der Kreuzotter gekreuzt. Hybridisierung zwischen Aspisvipern und Kreuzottern in Frankreich.
49. Als die Schlangen kannibalisch wurden. Florida: Vogelkolonien und Grubenottern gehen einzigartige Symbiose ein.
50. Wenn Bär und Wolf guten Tag sagen. Wildschwein, Bär, Viper & Co.: Wo Natururlauber in Europa mit riskanten Kollisionen rechnen müssen.
Wunderwelt der Tiere
Ist Australiens Dingo ein Hund, ein Wolf oder eine eigene Art? Fressen Wölfe auch Melonen? Richtet der Fuchs seinen Tagesablauf nach dem Menschen aus? Wie wirken sich Müllkippen auf die Wanderungen von Braunbären aus? Töten Löwen wirklich den Großteil eines jeden Geparden-Wurfs? Warum erschwert der Klimawandel den Eisbären nun auch die Fortpflanzung? Und wie entwickeln sich Spezies auf Inseln im Laufe der Evolution? Die zoologische Wissenschaft bringt dank modernster Forschungsmethoden oft Überraschendes ans Licht. Das gilt nicht nur für exotische Arten, sondern auch für altbekannte Tierarten aus Grimms Märchen und Brehms Tierleben. Das zeigen neuere Forschungsergebnisse zahlreicher internationaler Zoologenteams.
Die in diesem Band vorgestellten Forschungsstudien haben Wissenschaftler im renommierten Journal of Zoology der Zoologischen Gesellschaft London sowie in dessen Schwestermagazin Integrative Zoology veröffentlicht. Der Autor hat - als einziger deutschsprachiger Wissenschaftsjournalist - über diese Forschungsarbeiten in deutschen, österreichischen und Schweizer Medien berichtet. Das vorliegende Buch ist eine Sammlung dieser Feldforschungsgeschichten, die die komplexen und akademischen englischsprachigen Fachchinesisch-Texte der Biologen in eine auch für Laien verständliche Form und Sprache überträgt und daraus „erzählte Zoologie“ gestaltet. Hintergrundinformationen zu den behandelten Tierarten und Auszüge aus Interviews mit den Forschern ergänzen die Texte, die den Leser auf eine verblüffende Rundreise durch die zoologische Wissenschaft mitnehmen.
Weder Wolf noch Hund
Australische Forscher weisen nach, daß der Dingo eine eigene Art ist.
Ist er ein Wolf, ein Hund oder eine eigene Art? Seit mehr als einem Jahrhundert streitet sich die Zoologie darüber, was der Dingo, Australiens größtes Landraubtier, eigentlich ist. Inzwischen haben australische Wissenschaftler das Rätsel gelöst. Der Dingo ist eine Art für sich und unterscheidet sich von Wolf und Hund gravierend, unter anderem durch die Form des Schädels und der Schnauze. Das weist ein Forscherteam um den Evolutionsbiologen Mathew Crowther von der University of Sydney nach (Journal of Zoology, Band 293, S. 192).
Zuvor galt der Dingo mal als Unterart des Haushundes, unter anderen Zoologen wieder als Unterart des Wolfs - aber nicht als eigene Art. Damit kehrt die Wissenschaft zum Jahr 1793 zurück, als der deutsche Naturalist Friedrich Meyer das Raubtier als Canis dingo klassifizierte. Die Einordnung erfolgte damals anhand einer nur rudimentären Zeichnung und Beschreibung in einer Zeitschrift des ersten Gouverneurs Australiens.
Versuche, den Dingo wissenschaftlich einzuordnen, waren in der Vergangenheit reihenweise daran gescheitert, daß ein Gros der Dingos längst das Erbgut von Haushunden in sich trägt. Die Hunde hatten europäische Siedler nach Australien gebracht. Sie verwilderten vielfach und paarten sich mit wilden Dingos. Somit fehlte es Forschern an reinrassigen Ur-Dingos, die als Maßstab dienen konnten. Durch die Paarung von Dingos und verwilderten Hunden entstanden Bastarde, sogenannte Hybriden. Genanalysen stifteten am Ende meist nur Verwirrung, weil nicht klar war, ob die untersuchten Tiere reine Dingos waren. Diesmal gingen es die Forscher anders an: Sie suchten sich in Naturkundemuseen Australiens, Amerikas und Europas - unter anderem im Berliner Museum für Naturkunde - Dingo-Skelette und -Felle aus der Zeit vor 1900. Bis dahin war Australien von den Europäern nur sehr dünn besiedelt, die Vermischung mit Haushunden so gut wie ausgeschlossen. 69 Skelette und sechs Felle fanden die Forscher.
Dingo-Illustration Peter Mazells von 1789 aus Arthur Phillips „Voyage of Governor Phillip to Botany Bay“.
Sie studierten Körperbau sowie Fellfarbe und -musterung der Museums-Dingos. Am Ende hatten sich klare Dingo-Merkmale herauskristallisiert, die die Art von Hund, Wolf und Hybriden mit wenig Dingo-Erbgut abgrenzen. Der reine Dingo hat einen relativ breiten Kopf mit langer Schnauze, aufrechte Ohren und einen buschigen Schwanz. Im Vergleich zum Wolf ist der Dingo kleiner, die Fellfarbe ist variantenreicher. Vom Hund unterscheiden ihn unter anderem die spitzere Schnauze und eine geringere Schädelhöhe. Damit gibt es eine klare Richtschnur, anhand der jedes dingoähnliche Exemplar - ob wilder Hund, Dingo oder Hybrid - gemessen werden kann.
Dingo-Illustration von George Stubbs, 1772. „Portrait of a Large Dog from New Holland'“. The Lost Gallery.
Mit ihrer Studie beantworten die Forscher nicht nur die Frage nach der Klassifizierung des Dingos. Sie beweisen auch den Wert klassischer Forschungsansätze der Anatomie und der Morphologie, des äußeren Erscheinungsbildes, und zeigen, daß der herrschende Forschungstrend - genetische Analysen - in die Irre führen kann.
Überraschend war die Farbpalette der Tiere: Echte Dingos müssen nicht gelb oder hellbraun sein, wie zuvor angenommen wurde. Unter den Museumsexemplaren waren auch solche mit rein schwarzem, weißem, rotbraunem oder auch gesprenkeltem Fell.
„Von einigen dieser Farbvarianten hatte man bislang auf Hybriden geschlossen“, sagt Mike Letnic, Biologe an der University of New South Wales und Mitautor der Studie. Die Studie beweise aber, daß Individuen mit unüblicher Fellfarbe „schon im 18. und 19. Jahrhundert gelebt haben, als Australien von Europäern nur sehr dünn besiedelt war, und sie daher kaum Hybriden gewesen sein können“.
Der Dingo ist damit eine eigene australische Art aus der Familie der Hunde. Zu ihrer Gattung Canis zählen unter anderem Wolf, Kojote und Goldschakal. Dingos sind damit keine direkten Abkömmlinge des Wolfs und unterscheiden sich vom domestizierten Hund.
Ursprünglich stammen Dingos aus Südostasien und Papua-Neuguinea. Vor über 3.500 Jahren haben Seefahrer sie nach Australien eingeführt. Die Tiere vermehrten sich teils isoliert in der Wildnis, teils lebten sie mit den Aborigines. Während dieser langen Isolation machten genetische Abweichungen und natürliche Auslese den Dingo zu einer eigenen unverwechselbaren Art, so die Studie.
In Australien sind Dingos vor allem unter Farmern verhaßt, weil sie Schafe und zuweilen auch Kälber reißen. „Den Namen Dingo verwenden die Farmer kaum“, berichtet Letnic. „Sie sprechen lieber von wilden Hunden, denn das löst weniger Mitgefühl aus als das Aborigines-Wort Dingo.“ Sein Kollege Crowther hat wenig Hoffnung, daß Viehhalter ihre Haltung zum Dingo ändern: „Farmer sehen Dingos immer noch als Plage.“ Für das ökologische Gleichgewicht leisten Dingos als größte Landraubtiere des Kontinents aber einen wichtigen Beitrag. Unter anderem dezimieren sie verschiedene Känguruh-Arten, die sonst keine oder kaum natürliche Feinde haben, und die von Europäern eingeführten Füchse, Kaninchen und verwilderten Ziegen. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) listet Dingos als „gefährdet“. In einigen australischen Bundesstaaten werden Dingos daher geschützt, die mit Hunden gekreuzten „Dingo-Dogs“ aber als Schädlinge verfolgt. Vor allem schwarze Exemplare werden systematisch getötet - zu unrecht, da es sich oft um Dingos handle, so die Studie. Crowther: „Unsere Studie zeigt, daß die Farbe kein gutes Merkmal zum Unterscheiden ist.“
Wie sollen Dingos zukünftig in der Alltagspraxis von verwilderten Hunden unterschieden werden? „In der Wildnis ist es schwer bis unmöglich“, sagt Mike Letnic. „Trotzdem würde ich sagen: Wenn es wie ein Dingo aussieht, ist es ein Dingo.“ Den Bestand artenreiner Dingos zu beziffern, sei schier unmöglich, so Crowther. „In den entlegeneren Gegenden gibt es wohl hauptsächlich reine Dingos. Aber in Regionen mit ausgedehnter Besiedlung sind viele Hybriden.“ Mike Letnic macht auch Anti-Dingo-Programme für die Hybridisierung verantwortlich. Die Abschüsse hätten die Populationen reiner Dingos erheblich reduziert. Hybriden und ihr Erbgut machten sich dann unter den Dingos noch mehr breit.
Die Herausforderung für den Artenschutz wird künftig sein, Hybriden mit eher geringem Dingo-Erbgut auszusondern. Verwilderte Hunde ohne Dingo-Gene gebe es nicht allzu viele, sagt Crowther. „Unter den Bedingungen Australiens können sie nicht gut überleben.“ Nach einer anderen Studie tragen weniger als fünf Prozent der wilden Hunde kein Dingo-Erbgut in sich. Ein einziges Jahrhundert hat genügt, die Bestände reinrassiger Dingos in fast ganz Australien mit Haushund-Genen zu durchkreuzen.
Ein halber Freispruch für Isegrim
Iran: Wölfe fressen vor allem verendetes Nutzvieh und Pflanzliches.
Dem Fabeldichter Äsop galt er noch als kluges Tier, Hirten in aller Welt ist er nur ein Greuel: Der Wolf ist als Viehdieb ersten Ranges verschrien. Während Meister Isegrim in Mitteleuropa verlorenes Terrain zurückerobert und strikt geschützt wird, lassen Schäfer und Ziegenhirten anderswo die Waffen sprechen. Im Iran ist der Glaube an den bösen Wolf so fest verankert, daß Forscher der Iranian Cheetah Society (ICS) dem Konflikt zwischen Wolf und Mensch tiefer auf den Grund gingen, um die Mär von den Fakten zu trennen.
Die ICS-Wissenschaftler, die sonst eher auf Persiens Geparde spezialisiert sind, untersuchten im Qamishlu-Wildreservat im Zentraliran zwei Jahre lang, wovon sich der Wolf genau ernährt. In dem 800 Quadratkilometer weiten trockenen Hochland ist der Tisch für Irans Wolfsunterart Canis lupus pallipes von Natur aus gut gedeckt. Mufflons, Kropfgazellen und auch Wildziegen gibt es in der von Bergen durchfurchten Steppenlandschaft reichlich. Dazu gesel-len sich ihre domestizierten Artgenossen - Herden von Schafen und Ziegen, die im Winter in das Wildreservat zum Grasen getrieben werden und seit jeher das Interesse des Wolfs wecken.
Das Team um Fatemeh Hosseini-Zavarei sammelte Hunderte Kotproben, analysierte Haarreste unter dem Mikroskop, interviewte Hirten und hielt selbst Ausschau nach Wölfen und Wolfsrissen. Im Journal of Zoology (Band 290, S. 127) veröffentlichten sie ihre Erkenntnisse. Der Befund übertraf vordergründig alle Klischees. „Obwohl es reichlich wilde Huftiere gibt, ernährt sich der Wolf in viel höherem Maße von Nutzvieh als erwartet“, schreiben Hosseini-Zavarei und Kollegen.
47 Prozent der fleischlichen Biomasse, die der Wolf zu sich nahm, lieferten Schaf und Ziege aus den Herden der Hirten. 27 Prozent entfielen auf Gazellen, 16 Prozent auf Wildschafe, der Rest auf Wildziegen, Vögel und Nager. Demnach hätten Wolfsangriffe, vor allem solche auf Schafherden, eine regelrechte Plage sein müssen. Befragungen der Hirten zeichneten aber kein so dramatisches Bild. Nicht ein Prozent einer Herde ging jährlich durch Wolfsattacken verloren. Auch war die Zahl der bei einer Attacke getöteten Schafe oder Ziegen mit 1,7 viel geringer, als es zum Beispiel aus Italien oder Polen bekannt ist - weil im Iran immer Hirten und Hütehunde zur Stelle sind. Außerdem bestehen die Wolfsrudel in der Provinz Isfahan wegen des dürren Klimas im Schnitt nur aus zwei erwachsenen Tieren - weltweit sind die dortigen Rudel der Größe nach damit Schlußlicht.
Wie aber kam das viele Schaffleisch in den Wolfsmagen? Die Geparden-Forscher lösten das Rätsel. Die Wölfe von Qamishlu fressen vor allem Aas: Schafe und Ziegen, die durch Krankheit oder Schwäche auf den Weideflächen zuvor verendet waren. Hinzu kam Vieh, das beim Weidegang versehentlich zurück-blieb und abends nicht in Koppel oder Stall zurückkehrte - ein Festmahl für Wölfe und Hyänen. Der Schaden durch Wolfsattacken betrug für einen Herdenbesitzer in zwei Wintern zusammen 472 US-Dollar, bilanzieren die Forscher. Der Verlust durch verendete und in der Wildnis zurückgelassene Tiere summierte sich pro Herde auf durchschnittlich 2.810 Dollar - fast sechsmal so viel. Den 89 ermittelten Wolfsattacken auf Herden standen 196 Abgänge durch Krankheit oder Schwäche und 55 Verluste durch versehentliches Zurücklassen gegenüber.
So sehen viele Hirten den Wolf am liebsten: ausgestopfte Wölfe im Naturhistorischen Museum Laibach, Slowenien. Foto: Kai Althoetmar.
Die Feldstudie lieferte den Forschern noch mehr Überraschungen: Unter den wilden Huftieren rissen die Wölfe weit überproportional Widder und Böcke. In den Wintermonaten sind die männlichen Mufflons und Gazellen durch die Brunft geschwächt. Ständig müssen sie ihr Revier und ihre Harems verteidigen - das erschöpft sie derart, daß sie leichte Beute für Wölfe werden.
Ein weiterer Befund: Irans Wölfe sind keine Verächter vegetarischer Kost. 60 Prozent der gefressenen Biomasse war kein Fleisch. Im Kot fanden sich auffallend oft Fragmente von Trauben und Melonen. Selbst Abfälle wie Papier und Bindfäden schmeckten den opportunistischen Jägern. Nicht nur Schaf- und Ziegenherden, auch Müllkippen und Obstplantagen locken Isegrim an, stellten die Wissenschaftler fest.
Den Forschern liefert die Studie gute Gründe für einen stärkeren Schutz des Wolfs im Iran. Für Asiens Wölfe gibt es bis auf Indien bislang kein Wolfsmanagement. Illegale Abschüsse, aber auch Kollisionen mit Autos setzen die Bestände unter Druck. Entschädigungen für Viehhalter seien auch im Iran an der Zeit, meinen die Autoren der Studie. Denn 85 Prozent der befragten Hirten stuften ihre Einstellung zum Wolf als „negativ“ ein. Handlungsbedarf sehen die Autoren auch an anderer Stelle: Es wäre hilfreich, wenn die Schäfer wie schon der biblische „gute Hirte“ abends kein Vieh in der Wildnis zurückließen. Zu diesem Thema hatten die Hirten nur höchst ungern Auskunft gegeben.
In eisigen Höhen
Forscher lösen im Himalaya das Rätsel um die Koexistenz von Leopard und Schneeleopard.
Kaum eine Großkatze ist so anpassungsfähig und so weit über den Globus verbreitet wie der Leopard. Von der Wüste Negev und den Bergwelten des Kaukasus und Anatoliens über die Savannen Afrikas bis zu den Tropenwäldern Südostasiens reicht die Heimat von Panthera pardus, von ebenen Flußlandschaften bis in eisige Höhen. Ernest Hemingway setzte der gefleckten Katze in seiner Erzählung „Schnee auf dem Kilimandscharo“ ein literarisches Denkmal, als er seinen sterbenden Helden über eine seltsame Begebenheit sinnieren läßt: „Dicht unter dem westlichen Gipfel liegt das ausgedörrte und gefrorene Gerippe eines Leoparden. Niemand weiß, was der Leopard in jener Höhe suchte.“ Die Geschichte hatte einen realen Hintergrund. 1926 entdeckte der Wolga-Deutsche, Pastor und Ostafrika-Missionar Richard Reusch bei einer seiner Kilimandscharo-Besteigungen auf 5.638 Meter Höhe am Rande des Kibo-Kraters ein solches Leopardenskelett - und animierte Hemingway zu dessen 1936 erschienener Erzählung.
Schneeleopard im Hemis-Nationalpark, Indien. Foto: Rodney Jackson, Wikimedia.
5.895 Meter hoch ist der höchste Berg Afrikas, eine Höhe, bis zu der allgemein nur der in Asien heimische Schneeleopard unterwegs ist. Im Himalaya indes treffen beide Arten aufeinander. Seit langem ist bekannt, daß die beiden Katzen in den Bergwelten Asiens, in denen sie zugleich vorkommen, möglichst verschiedenartige Habitate wählen. Leoparden ziehen die Wälder in den Hochtälern vor und machen Halt an der Baumgrenze. Im Himalaya liegt diese bei 4.400 Metern. Oberhalb liegt das Reich des Schneeleoparden: offene Gras- und Buschlandschaften, steinige und steile Bergmatten.
Während die Schneegipfel des Kilimandscharo schmelzen, setzt der Klimawandel auch den bedrohten Schneeleoparden zu. Die Baumgrenze dehnt sich mit wärmeren Temperaturen in die Höhe aus, Panthera uncia verliert so im Himalaya seine Reviere an den Leoparden. „Schneeleoparden im Himalaya sind gefährdet durch die Dezimierung seiner Beute, durch Wilderei und durch den Klimawandel“, sagt der italienische Verhaltensforscher Sandro Lovari von der Universität Siena. „All das kann für die Katze tödlich sein.“ Den Verlust von 30 bis 50 Prozent seiner Habitate im Himalaya sagt Lovari dem wenig erforschten Schneeleoparden voraus.
Warum sich die Streifgebiete von Schneeleopard und Leopard nicht überlappen, haben der Professor aus Siena und fünf Kollegen seiner Universität sowie des Umweltforschungsinstituts ISPRA in Ozzano Emilia bei der Feldforschung im Himalaya herausgefunden. Dabei widerlegten sie die bisherige Annahme, daß die zwei Großkatzenarten sich auf unterschiedliche Beutetierarten konzentrieren, frei nach dem Motto: dem Leoparden die Waldbewohner, dem Schneeleoparden alles Getier, was oberhalb der Baumgrenze kreucht, fleucht und kraxelt. Die überraschende Erkenntnis der Forscher: Die beiden nacht- und dämmerungsaktiven Pirschjäger haben fast den gleichen Speisezettel.
Das Team um Sandro Lovari hatte in Nepals Sagarmatha-Nationalpark in Höhen von 3.440 bis 4.750 Metern über vier Jahre hinweg Vorkommen und Ernährung beider Leopardarten erforscht. In der Region kommen beide Arten vor. Kotanalysen gaben Auskunft über die Beute, Kratzspuren und Fellhaare über Streifgebiete. „Entgegen unserer Annahme schlagen beide Leoparden ähnliche Beute“, schreiben die Forscher in ihrer im Journal of Zoology erschienenen Studie (Band 291, S.127). Das Beuteartenspektrum beider Katzen überschneidet sich zu 69 Prozent - im Winter zu 76 Prozent, im Sommer zu 60 Prozent. Leopard wie Schneeleopard ernähren sich zu Füßen von Mount Everest und Lhotse vor allem vom ziegenartigen Himalaya-Thar, vom Moschushirsch sowie von Vieh und Hunden der Hirten. Verblüfft stellten die Forscher bei den Kotanalysen auch fest, daß beide Großkatzen häufig Appetit auf einen lokalen Rispelstrauch hatten. Die Erklärung: Das Tamariskengewächs hilft bei Fleischvergiftungen.
Wie aber, fragte sich das Team, gelingt es den beiden Katzen, von den gleichen Beutetierarten zu leben und sich doch nicht in die Quere zu kommen? Die Erklärung: Die Beutetiere wechseln die Höhe. Die Thare ziehen im Winter von den Berghängen in die Täler und treffen dort auf Leoparden, auch die Yakherden der Hirten wandern mit der Jahreszeit auf und ab, während Moschushirsche ohnehin in Wäldern wie in offenen Landschaften vorkommen. Beide Raubkatzenarten können so in ihren Nischen bleiben.
Täten sie es nicht, käme es zu „interspezifischer Aggression“. Vor allem die Männchen verhalten sich intolerant. Der Verlierer einer Begegnung wäre in der Regel der körperlich unterlegene Schneeleopard. Für solche Tötungen unter Raubtieren gibt es anderswo Beispiele: In Afrikas Serengeti wird der Gepard von Löwen und Hyänen dezimiert, im Iran macht ihm der Wolf zu schaffen. Solche Tötungen, so Lovari, kämen vor allem zwischen Raubtierarten vor, die sich in der Körpergröße zwar merklich, aber nicht sehr stark unter-scheiden. Lovaris Studie erklärt erstmals, wie Leopard und Schneeleopard in einer Region koexistieren können. Die Tiere wählen unterschiedliche Habitate - nicht wegen des Beutevorkommens, sondern um sich konsequent aus dem Weg zu gehen. „Die kleinere Art meidet die größere“, heißt es in der Studie. „Getrennte Habitate bedeuten nicht immer, daß unterschiedliche Beute genutzt wird.“
Nur zur Partnersuche dringen Schneeleoparden in die Ausläufer der Leopardenreviere ein. Begegnungen sind daher äußerst rar. Lovari fand bei seinen Forschungen noch nie den Nachweis einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen Leopard und Schneeleopard. „Wenn das passiert, ist es ein seltenes Ereignis“, sagt der Biologe. Die geringe Dichte, in der die beiden Arten vorkommen, verhindere häufige Begegnungen. Auf 1.000 Quadratkilometer kommen nicht mehr als fünf bis zehn Individuen. Es fehlt schlicht an Biomasse, sprich Beutetieren. Die eher geringe natürliche Produktivität in den Höhenlagen des Himalaya ermögliche keine Raubtierdichte wie in Savannen oder tief gelegenen Wäldern, erklärt Lovari.
Im Sagarmatha-Nationalpark haben zudem Jagd und Wilderei die Beutetierbestände rasiert, die Säugetierfauna sei eher dürftig, berichtet Lovari. Wolf und Goldschakal sind dort längst ausgerottet, der Park sei „ein schlecht ausbalanciertes Ökosystem“. Der Schneeleopard hat es dort nicht leicht. Schon einmal war er lokal ausgerottet. Um das Jahr 2003 Jahren kolonisierte er die Everest-Region erneut. „Bevor es dort jemals stabile Bestände an Schneeleoparden gibt, wird es noch viel Fluktuation geben“, sagt Lovari. 4.500 bis 7.500 Schneeleoparden leben noch in zwölf Ländern Zentralasiens, die meisten in China. Vor allem in den Hochgebirgen Himalaya, Karakorum, Altai, Pamir, Hindukusch und Tian Shan kommen sie vor, aber auch in der Hochgebirgswüste Gobi mit ihren heißen Sommern. Die Pirschjäger werden vielerorts als Viehräuber verfolgt und wegen ihrer Pelze geschossen, ihre Knochen in China zu Quacksalbermedizin vermahlen.
Leopard. Foto: Patrick Giraud, CC BY-SA 3.0.
Bloß nicht dem Fuchs begegnen
Um ihre Todfeinde zu meiden, jagen Altaiwiesel in Pakistans Pamirgebirge tagsüber.
Scheu sind sie, wenig erforscht und tagsüber so selten zu sehen, daß es immer hieß, sie seien vor allem nachtaktiv: die Wiesel. Die Gattung der agilen Kleinräuber umfaßt 17 Arten, vom winzigen Mauswiesel über Hermelin und Waldiltis - allesamt in Europa heimisch - bis zum Altaiwiesel Zentralasiens.
Forscher aus Norwegen und Pakistan haben am Beispiel des Altaiwiesels nachgewiesen, daß es mit dem Nachtleben des Mäuse- und Kaninchenjägers nicht weit her ist. Das nur ein halbes Pfund schwere Wiesel Mustela altaica ist fast nur tagsüber unterwegs, und zwar um Fuchs und Steinmarder aus dem Weg zu gehen, wie die Wissenschaftler in ihrer Studie zeigen (Journal of Zoology, Band 293, S.