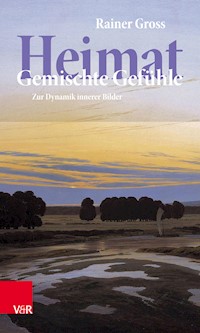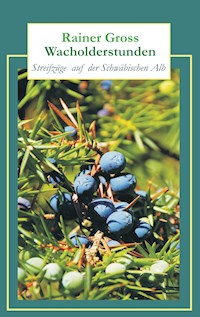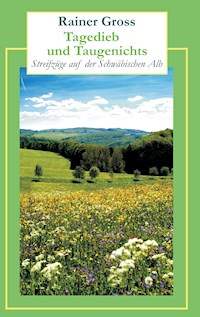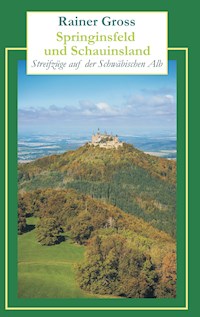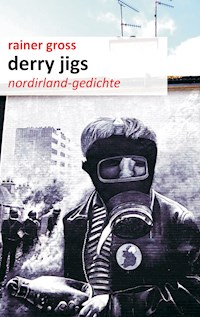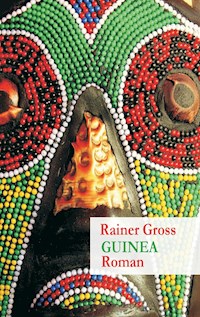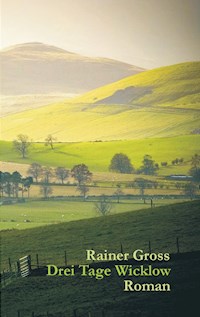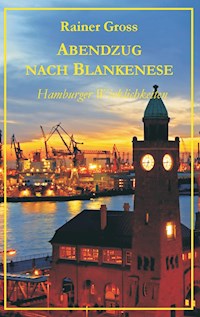21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Burnout und Depression sind inzwischen weit verbreitete Phänomene in der Arbeitswelt. Doch meist geht ihnen eine lange Geschichte voraus - eine Geschichte der Angst. Viele Menschen sorgen sich, den ständig wachsenden Anforderungen, der Beschleunigung und Optimierung, dem Druck an allen Fronten nicht mehr gewachsen zu sein. Sie haben Angst vor dem Scheitern, vor Exklusion, sozialem Abstieg, vor Kündigung. Oft fällt es schwer, zwischen äußeren Belastungsfaktoren und individuellen Befindlichkeiten zu unterscheiden. Rainer Gross analysiert die verschiedenen Formen der Angst in der Arbeitswelt und hilft Betroffenen, die Fähigkeit zur Selbstreflexion zu stärken. Was sind innere Muster, die diesen Ängsten zugrunde liegen, was hat es z. B. mit dem Zwang zum Erfolg auf sich? Warum können sich manche Menschen gegen Überforderung besser wehren als andere, und welche Rolle spielt dabei die Resilienz? Anhand von Fallbeispielen und eines Praxisteils bietet das Buch Betroffenen auch bewährte Hilfestellungen, z.B. zur Selbststeuerungsfähigkeit, zur Achtsamkeit und Empathie. Dennoch, so Rainer Gross, sei am Ende die Frage erlaubt: Reicht es wirklich, unser Verhalten zu ändern, oder braucht es auch eine andere Arbeitswelt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gross
Angst bei der Arbeit – Angst um die Arbeit
Verlag Hans Huber
Ratgeber Psychologie
Rainer Gross
Angst bei der Arbeit – Angst um die Arbeit
Psychische Belastungen im Berufsleben
Verlag Hans Huber
Lektorat: Dr. Mathilde Fischer, Wiesbaden
Herstellung: Adrian Susin
Umschlaggestaltung: Gesine Beson
Druckvorstufe: Claudia Wild, Konstanz
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Finidr, s. r. o., Cěský Těšín
Printed in Czech Republic
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Verlag Hans Huber
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
CH-3000 Bern 9
Tel: 0041 (0)31 300 4500
Fax: 0041 (0)31 300 4593
www.verlag-hanshuber.com
1. Auflage 2015
© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-456-95401-1)
(E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-456-75401-7)
ISBN 978-3-456-85401-4
Einleitung
Der Anlass, dieses Buch zu schreiben, war – wie bei mir immer – ein persönlicher, ein subjektives Unbehagen an meiner eigenen Arbeitssituation: Ich bin seit dreiunddreißig Jahren Psychiater und seit fast dreißig Jahren Psychotherapeut und Psychoanalytiker, leite seit zwanzig Jahren eine Abteilung für Akutpsychiatrie. Dreißig Jahre lang war ich mit meiner Arbeitssituation derart zufrieden, dass ich mich auch nach acht bis zehn Stunden Arbeit pro Tag kaum angestrengt, geschweige denn überanstrengt fühlte. Dementsprechend wenig Verständnis konnte ich auch für die Klagen mancher Kollegen über ihre Erschöpfung aufbringen: Das Jammern solle man eher den Patienten überlassen, so meine Botschaft. (Ich habe dies hoffentlich nicht offen gesagt – indirekt aber so ausgedrückt. Die Kollegen werden es wohl gespürt haben.)
Meine Arbeitszufriedenheit hat in den letzten Jahren massiv und schmerzlich nachgelassen: Durch steigende Anforderungen, vor allem immensem administrativem Aufwand und die immer schmerzlicheren ökonomischen Einschränkungen im Krankenhaus habe ich innerhalb weniger Jahre erfahren, wie schnell Überforderung zu Gereiztheit, Zynismus und Erschöpfung führen kann.
Dagegenhalten konnte ich nur mit Techniken, die ich seit vielen Jahren meinen Patienten in vergleichbaren Situationen anbiete: Selbstdistanzierung, einen möglichst neutralen Blick auf die eigene innere Not «wie von außen». Auf diese Weise kann eine Differenzierung, eine Trennung der inneren/intrapsychischen von den äußeren Auslösern der Krise beginnen. Noch wichtiger aber war mir immer das gemeinsame Nachdenken mit den Patienten über deren «Krankheitsgewinn»: Was ist der Zweck eines Symptoms, welche anderen (als noch schlimmer fantasierten) Bedrohungen kann ich durch die Aufrechterhaltung des Symptoms vermeiden, kann ich mir ersparen? In meinem eigenen Fall: Was würde denn passieren, wenn ich in der Arbeit etwas «nachlassen» könnte beziehungsweise würde? Würde es überhaupt jemand außer mir selbst bemerken? Wenn aber nicht – was würde das wieder bedeuten? Könnte es mich beruhigen, wenn die Reduktion meiner Leistung überhaupt niemand auffallen würde?
Öffentlich angesprochen habe ich dieses Unbehagen erstmals in einem Referat vor Politikern und Sozialarbeitern: Der dort vorgetragene Text war aber eher eine Polemik als eine Auflistung therapeutischer Strategien – er kam aber überraschend gut an und führte dazu, mich weiter in das Thema zu vertiefen.1
Schnell stellte ich fest: Das Leiden an der Arbeitssituation war nicht nur mein Problem, sondern auch das meiner Patienten und Kollegen.
In der Akutpsychiatrie behandeln wir täglich Menschen, die in akuter Verzweiflung nach einer Kündigung nicht mehr weiter wissen, oft sogar suizidal werden. Viele von ihnen haben Jobs verloren, deren Arbeitsalltag man nur als entsetzlich empfinden kann – trotzdem waren diese Arbeitsplätze das Zentrum ihres sozialen und seelischen Lebens.
Die Psychotherapie-Patienten in meiner Privatpraxis entstammen meist einer anderen sozioökonomischen Schicht, sind in ihren oft leitenden Positionen ungleich privilegierter, meist zweifelt niemand außer sie selbst an ihrer Kompetenz und an der Sicherheit ihres Jobs. Trotzdem klagen fast alle von ihnen über das Gefühl, nicht mehr zu genügen, überflüssig zu werden, nicht mehr gebraucht zu werden. Immer komplexer werdenden neuen Medien stehen speziell die älteren unter ihnen hilflos gegenüber.
Bei den jüngeren Ärztinnen und Ärzten an unserer Abteilung wiederum konnte ich oft verblüfft feststellen, wie unterschiedlich meine bis zu dreißig Jahre jüngeren Kolleginnen und Kollegen mit ihren Belastungen, mit ihren Ängsten vor Fehlern umgingen: Positiv formuliert, versuchten sie viel früher als meine Generation aktiv gegenzusteuern im Sinne einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. Negativ formuliert, so die Meinung vieler älterer Chefärztinnen und Chefärzte, seien die Jungen deutlich weniger bereit zur «Leistung», insbesondere zur Leistung von zahlreichen Nachtdiensten, schon bei relativ geringer Belastung klagten sie über Erschöpfung und Burnout.
In all diesen Gesprächen über Arbeitsbelastungen, all den zahlreichen Artikeln, Büchern, Fernsehsendungen der letzten Jahre geht es immer um die gleichen Begriffe: Belastung durch Beschleunigung, Überforderung, Erschöpfung, Depression – und natürlich Burnout. Deutlich seltener hören wir von der diskreteren Vorstufe der Erschöpfung und der allermeisten psychischen Erkrankungen – von der Angst.
Auf Nachfrage berichten viele Betroffene zwar von konkreten und anlassbezogenen Ängsten (vor zu viel Verantwortung, Überforderung durch immer größere Leistungsvorgaben, Angst vor Chefs und deren brutaler Kritik etc.). Diese Ängste können reflektiert werden, sind bewusstseinsfähig, allein das Gespräch darüber wirkt oft schon erleichternd. Kaum bewusst aber (und daher auch kaum artikulierbar) sind die dahinterliegenden Ängste vor Kontrollverlust und Ohnmacht (speziell in Belastungssituationen). Letztlich handelt es sich um Ängste vor Autonomieverlusten, Ängste vor der Abhängigkeit von anderen Menschen und von äußeren – unbeeinflussbaren – Vorgaben. Warum können diese Ängste kaum gespürt werden, warum sind sie auch in Therapien so schwer ins Bewusstsein zu holen? Eine meiner Hypothesen dazu lautet, dass jeder Autonomie-Verlust für unser Selbstbild eben höchst bedrohlich ist, weil jedes bewusst erlebte Gefühl der Abhängigkeit uns so sehr beschämt! Das heutige «Erfolgsmodell» des Menschen ist der rational-autonome, ja emotional fast schon autarke Homo oeconomicus, die allseits flexible und belastbare «Ich-AG». Das bewusste Erleben von Angst ist in diesem Modell nicht vorgesehen, darf keinen Platz haben.
Wenn die Angst aber doch gespürt wird, hören wir fast schon «wie von innen» die Reaktionen einer nur scheinbar mitfühlenden Umwelt: Alles nicht so schlimm – Angst hat doch jeder, das gehört zum Leben, schon der Urmensch und der Säbelzahntiger etc. etc. Wie alle banalen Weisheiten haben auch diese einen Anteil an Wahrheit: Natürlich kommt es darauf an, wie man mit der Angst umgeht – und hier unterscheiden sich einzelne Menschen in sehr hohem Maß! Fast alle scheuen bei ihrem Umgang mit Belastungen und – angstauslösenden – Überlastungen im Arbeitsleben die eine Frage: Warum tue ich mir das eigentlich an? Warum überfordere ich mich so – und das seit Jahren?
Welchen psychischen Zweck könnte das Symptom von Überlastung, ja von Selbstausbeutung bis zum Zusammenbruch haben?
Erst einmal werde ich mich dem Phänomen nach dem klassischen medizinischen Muster annähern: Beschreibung der Symptome und Syndrome, davon ausgehend eine Diagnose – doch dann wird es schwierig: Eine grundlegende «Therapie» zum Umgang mit dem heutigen Arbeitsleben bleibt eine vorerst fast unlösbare Aufgabe. Dennoch lohnt es sich, auch über solche unlösbaren therapeutischen Probleme nachzudenken – weil erst auf diese Weise klar wird, wie viele Aspekte der leidvollen Situation wir in unserem Denken und Fühlen bereits «naturalisiert» haben – also als unabänderlich empfinden – weil wir sie ja auch bisher nie verändert haben. Lassen Sie mich also beginnen im Sinne von Bertolt Brecht: «Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.»
Seltsamerweise habe ich während der Arbeit an diesem Buch die darin beschriebene Symptomatik höchst intensiv selbst erlebt: Das Thema erschien mir geradezu überwältigend, fast täglich fand ich neue Artikel, Bücher, Interviews, die ich unbedingt noch «einarbeiten» musste. Gleichzeitig erlebte ich ebenfalls fast täglich das bedrückende Gefühl, dass zu diesem Thema ja ohnehin schon alles gesagt sei – ich bestenfalls altbekannte Ergebnisse und Positionen nochmals aufbereiten und zusammenfassen konnte. Mein Grundgefühl war: Hilfe, es wird nie genug (Recherche) sein, gleichzeitig zerrinnt mir das Ergebnis unter den Fingern! Daher wurde ich manchmal schon müde, wenn ich nur daran dachte, welches Arbeitspensum ich mir fürs Wochenende wieder vorgenommen hatte. Am eigenen Fallbeispiel konnte ich so auch die Überschwemmung der Freizeit durch – selbst auferlegte – Arbeit erleben.
Trotzdem bemerkte ich auch, dass es nicht möglich war, den Arbeitsfortgang beliebig zu beschleunigen: Obwohl ich den nahenden Abgabetermin immer drängender spürte, jedes Kapitel, jeder Gedanke brauchte seine Zeit, bis er aus meinem Kopf aufs Papier gelangt war. Auch der (relativ) fleißige und motivierte Arbeiter ist also nur begrenzt beschleunigbar – quod erat demonstrandum!
Ich hoffe, mit diesem Buch alle Leserinnen und Leser zum Weiterdenken anzuregen, zum Nachdenken über einen leidvoll wie auch scheinbar unveränderlich erlebten Zustand der Angst. Ich würde mich freuen, wenn mein Text ein Anstoß zur Selbstreflexion, zur Solidarisierung – und somit auch zur Angstminderung – sein könnte.
1. Stress, Ängste und die Folgen
Was sind Stress, Sorgen, Ängste und Angsterkrankungen?
Der Begriff Stress ist heute mit Sicherheit eines der meistgebrauchten Worte in unserer Alltagssprache. Viele Menschen fühlen sich ständig und überall gestresst – beginnend mit dem Stress bei der Geburt über den Stress des Zweijährigen in der Kinderkrippe, gefolgt vom Schulstress, Prüfungsstress und nach einem langen stressreichen Arbeitsleben dann der Pensionsstress und Altersstress durch die verringerten körperlichen Ressourcen … Kaum vorstellbar, dass der Begriff vor 1936 (vor seiner Erfindung durch Hans Selye) nicht zur Verfügung stand …
Viele haben von den biologischen Grundmechanismen der Stressreaktion gehört, interessierte Mitbürger wissen vom berühmten Säbelzahntiger und der Adrenalin-Ausschüttung. So ist auch jeder fest von der Notwendigkeit eines vernünftigen Stressmanagements überzeugt, versucht sein Leben zu «entstressen», manchmal einfach nichts zu tun und nur vor sich hinzuschauen …
Doch auch dieses Nichtstun scheint heute schon Stress zu erzeugen: Ein Forschungsteam um Timothy Wilson (University of Virginia) zeigte in einer Reihe von Experimenten, «dass viele Personen das Alleinsein mit sich als unangenehm empfinden»2. Die Wissenschaftler baten College-Studenten, 15 Minuten in einem schmucklosen Raum ihren Gedanken nachzuhängen – und sonst nichts zu tun. Anschließend wurden die Studenten befragt, wie sie dieses Alleinsein empfunden hätten. Die Hälfte berichtete, es als unangenehm erlebt zu haben. Dann gaben die Wissenschaftler im zweiten Durchgang den Versuchspersonen die Möglichkeit, sich selbst einen leichten Elektroschock zu verabreichen – wenn ihnen das Nichtstun zu viel wurde, zu viel Stress erzeugte: Während der 15 Minuten entschieden sich 12 von 18 Männern und 6 von 24 Frauen dafür, sich selbst Stromschläge zu verabreichen! Lieber irgendetwas – auch etwas Unangenehmes – selbst aktiv tun, als gar nichts zu machen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!