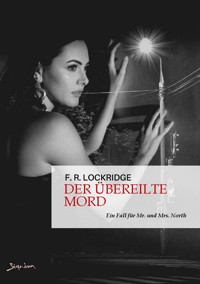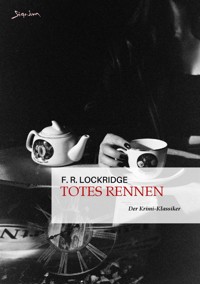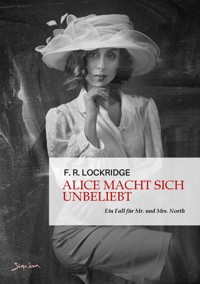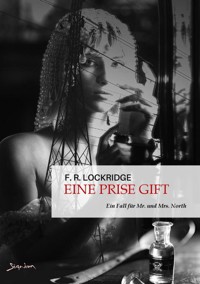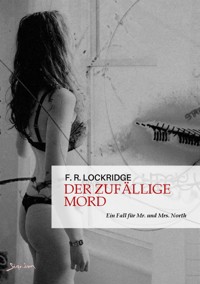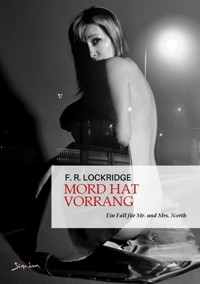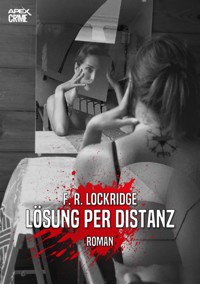6,99 €
Mehr erfahren.
Miss Howell, die geistesabwesend das weiche Fell des Katers streichelte, musste sich eingestehen, dass eine düstere Vorahnung sie quälte, als ob diese Angelegenheit noch lange nicht abgeschlossen wäre. Sie konnte sich des Gefühls nicht erwehren, etwas übersehen zu haben – und zwar etwas, das sich als sehr bedeutungsvoll und folgenschwer erweisen konnte...
Der Roman Angst vor Katzen von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1964; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
Angst vor Katzen
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
ANGST VOR KATZEN
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechszehntes Kapitel
Das Buch
Miss Howell, die geistesabwesend das weiche Fell des Katers streichelte, musste sich eingestehen, dass eine düstere Vorahnung sie quälte, als ob diese Angelegenheit noch lange nicht abgeschlossen wäre. Sie konnte sich des Gefühls nicht erwehren, etwas übersehen zu haben – und zwar etwas, das sich als sehr bedeutungsvoll und folgenschwer erweisen konnte...
Der Roman Angst vor Katzen von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1964; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im gleichen Jahr.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
ANGST VOR KATZEN
Erstes Kapitel
Es kam immer darauf an, von welchem Gesichtspunkt aus man die Sache betrachtete. Einerseits hatte er der alten Dame schon eine Menge Schwierigkeiten zu verdanken. Andererseits war sie es schließlich, die ihm zu verstehen gegeben hatte, dass es die ganze Mühe wert war. Ganz abgesehen davon – allzu schlimm würde es schon nicht werden. Eigentlich erwartete er sich einen ziemlich reibungslosen Ablauf. Für einen Mann seines Formats war dieser Fall doch ein kleiner Fisch. Da hatte er schon ganz andere Dinger gedreht – oho!
Mein Gott, all dies Geschwätz der alten Jungfer über gesetzliche Vorschriften. Er hörte sie direkt noch. Vom obersten, heiligsten Gesetz hatte sie geschwafelt. Der reinste Eiertanz, das Ganze. Dabei hatte er von ihr nichts weiter wissen wollen, als einen Namen und eine Adresse. Er war da ganz bestimmt auf der richtigen Spur – aber sie hatte ihm die Auskunft unerbittlich verweigert. Stattdessen war sie ihm mit ihren Vorschriften gekommen. Als ob Vorschriften nicht dazu da wären, umgangen zu werden. Wen interessierte es schon, zum Teufel, ob die Unterlagen streng vertraulich waren oder nicht. Absolut geheim für jedermann. Ja, hatte die alte Jungfer gesagt, das gilt auch für Sie! So lautet nun einmal die Vorschrift. Das ist bei uns heiligstes, oberstes Gesetz.
Jetzt stand er im Eingang eines Restaurants, das bereits geschlossen war. Hier schien alles zu schlafen. Die ganze, leer daliegende Straße. Die endlose Häuserfront. Jedes einzelne Fenster. Aber das spielte für ihn keine Rolle. Er stand unbeweglich im Schatten, wartete und ließ die gegenüberliegende Straßenseite nicht aus den Augen. Eine der beiden Flügeltüren des Hauses war offen. Drinnen saß der Alte, hell von einer Lampe beschienen, an seinem Pult, vor sich das unvermeidliche Buch. Das Buch, in das sich jeder eintragen musste, der nach Dienstschluss noch ins Haus wollte. Trotz der immer noch drückenden Schwüle hatte der alte Mann seine Schirmmütze nicht abgesetzt. Wahrscheinlich bedeutete sie eine Art Uniform für ihn, das äußere Zeichen seines Amtes. Sicher verlieh sie ihm ein Bewusstsein der Würde und Wichtigkeit. Selbst wenn – wie jetzt – niemand da war, es gebührend zu respektieren.
Der Mann im dunklen Torbogen warf einen Blick auf die Leuchtziffern seiner Armbanduhr. Eigentlich war es jetzt Zeit. Zumindest, wenn er sich nach gestern richten wollte. Höchstwahrscheinlich spielte sich dort drüben alles jeden Tag nach dem gleichen Rhythmus ab. Wenn ja, dann konnte es sich nur noch um Minuten handeln, bis der Alte hinter seinem Pult umständlich in der Tasche herumzuwühlen begann, seine altmodische Uhr zutage beförderte, den Deckel aufspringen ließ und sie prüfend betrachtete. Und dann...
Da, hatte er’s nicht gewusst! Der Alte zog die Uhr heraus und musterte sie stirnrunzelnd. Dann nahm er seine Schirmmütze ab, fuhr sich mit dem Taschentuch über die Stirn und rieb anschließend auch noch gründlich das Lederband im Inneren der Mütze trocken. Genau wie gestern Abend. Dann setzte er das Attribut seiner Würde wieder auf, schritt gravitätisch zur Eingangstür, machte den offenen Flügel zu und schloss die Tür vernehmbar ab. Sorgfältig rüttelte er noch einmal daran. Sodann schaltete er das Licht bis auf die eine Lampe über dem Pult, an dem er bis jetzt gesessen hatte, aus und verschwand im Hintergrund der Halle – aus dem Blickfeld des Mannes draußen auf der Straße.
Punkt zehn – genau wie gestern Abend. Wahrscheinlich wohnte der Bursche im Haus. Im Keller vielleicht. Der Mann im Schatten beschloss, noch eine Viertelstunde zu warten. Es lohnte nicht, es zu riskieren, dass er dem Alten in die Arme lief. Wo es sich vermeiden ließ, ging er Gewalttätigkeiten aus dem Wege. Schließlich – der Alte hatte ihm ja nichts getan.
Die alte Jungfer ebenso wenig, wenn man es genau nahm. Diese – wie nannte man sie doch gleich? Ach ja – diese Sozialhelferin, oder so ähnlich. Ihr Titel, wenn man so wollte. Vielleicht war sie ebenso stolz darauf, wie der Alte auf seine Uniformmütze. Jeder Mensch hat nun einmal seine Ideale, seine persönlichen Götzen, die er anbetet. Und es ist ein sinnloses Unternehmen, diese von ihrem Podest stoßen zu wollen. Sicher bedeuteten der Alten ihre heiligen Gesetze auch so etwas Ähnliches. In gewisser Beziehung mochten diese sogar ihre Berechtigung haben, wie alles im Leben. Sie existierten nun einmal und zogen unüberschreitbare Grenzen. Was – so hinderlich es ihm im Augenblick auch war – in anderen Fällen ganz gut sein konnte.
Trotzdem hatte die alte Jungfer ihm, ohne es zu wollen, allerhand verraten. Genug jedenfalls, um sein Interesse noch anzuspornen. Den Worten der Fürsorgerin nach, schien die Kleine ja das Große Los gezogen zu haben.
Ein Taxi kam langsam die Straße herauf. Er wartete, bis es vorbei war, dann schaute er abermals auf seine Uhr. Zwanzig nach zehn. Man sollte annehmen, dass der Alte inzwischen tief und fest schlief.
Lautlos glitt er aus seinem Versteck heraus und überquerte die Straße. Dicht presste er sich gegen die Haustür. Flüchtig glitt sein Blick die Fassade empor. Die gegen den dunklen Nachthimmel aufragenden fünf Stockwerke mussten gut und gerne ihre hundert Jahre auf dem Buckel haben. Hier, am äußersten Ende der 23. Straße, scherte sich kein Mensch darum. Die Stadt nahm sich nicht die Mühe, diese alten Kästen abzureißen, sondern überließ sie gleichgültig dem langsamen Verfall.
Vor der eigentlichen Eingangstür lag eine kleine Vorhalle. Manchmal hatte diese altmodische Pracht, diese mitleiderregend hässlichen Gemäuer, schon etwas für sich. Zum Beispiel erleichterte es jetzt erheblich seine Arbeit. Das Schloss war offensichtlich seit Bestehen des Hauses noch nicht erneuert worden. Ein vorsintflutliches, riesiges Schlüsselloch gähnte ihm entgegen. Die Sache ließ sich tatsächlich noch besser an, als er gehofft hatte. Eigentlich rührend – das alles hier. Die alte Dame, der gebrechliche Hausmeister mit seiner Schirmmütze und nun dieses altersschwache, primitive Schloss. In einer Welt wie der heutigen hatten alle diese Requisiten – seiner Überzeugung nach – keine Daseinsberechtigung mehr. Sie waren doch nichts als eine leere Fassade und beeindruckten nur den, der noch an derartige Überbleibsel einer vergangenen Epoche glaubte.
Nun, er gehörte nicht dazu. Hatte gar keine Zeit, sich in derartige Sentimentalitäten zu verlieren. Bei ihm zählte das Leben, das harte, nackte, unbarmherzige Leben. Ein Schloss sollte das sein? Dutzende von Schlüsseln würden dazu passen. Ihm genügten die paar, die er bei sich hatte. Schon der zweite fasste.
Behutsam zog der Mann die Tür hinter sich zu. Sekundenlang stand er da, den Rücken dagegen gelehnt, und lauschte. Totenstille. Rasch schlich er durch die Halle zu den beiden uralten Aufzügen und der linoleumbelegten Treppe daneben. Mannhaft widerstand er der Versuchung, sich das Treppensteigen zu sparen. Wer weiß, was für einen Lärm diese Fahrstühle machten, wenn man sie in Bewegung setzte. Es war bestimmt sicherer, bis zum dritten Stock hinaufzusteigen.
Also machte er sich auf den Weg. Bis zur ersten Etage, zur zweiten und schließlich zur dritten. Puh, fast ging ihm die Luft dabei aus. Wie in allen alten Häusern hatten die Räume auch hier sehr hohe Decken. Und dementsprechend steil waren auch die Stufen.
Der Flur war schmal. Ein Gemisch von muffiger Luft und Bohnerwachs schlug ihm entgegen. Unter dem fadenscheinigen Linoleum knarrten die Dielen. Schließlich blieb er vor einer Tür stehen. Er war am Ziel.
Die Tür war verschlossen. Diesmal handelte es sich um ein modernes Sicherheitsschloss. Hier würde er länger brauchen. Aber er hatte ja Zeit genug. Wenn es gar nicht anders ging, konnte er immer noch die Scheibe eindrücken und die Tür von innen öffnen. Dabei war natürlich ein gewisser Lärm nicht zu vermeiden. Aber der alte Hauswart schnarchte bestimmt schon lange, vermutlich irgendwo unten im Kellergeschoss. Kaum anzunehmen, dass er nächtliche Runden machte. Was hätte in diesen armseligen Büros hier schon gestohlen werden sollen?
Da – ein feines Knacken. Die Tür war auf. Er brauchte die Scheibe also nicht einzuschlagen. Das Schloss sollte ihm mal einer zeigen, das er nicht aufbekam!
Er zog die Tür leise, aber nachdrücklich, zu und ließ seine Taschenlampe aufflammen. Höchstwahrscheinlich war der ganze Zauber überflüssig, und er hätte unbesorgt das Licht anknipsen können. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, auch wenn die Dinge dadurch etwas umständlicher werden. Diesmal wollte er sich nicht den Vorwurf machen, aus Leichtsinn die Sache vermasselt zu haben. Diesmal nicht!
Er befand sich in einem kleinen Korridor, auf den eine erstaunliche Anzahl von Türen führte. Es war nicht zu übersehen, dass es sich um eine beachtliche Organisation handelte. Der Laden schien nicht schlecht zu laufen. Der Umsatz an ihrem speziellen Material musste beträchtlich sein. Und wo gehobelt wird, fallen Späne. Für sie würde dabei schon genug herausspringen, wenn sie es geschickt genug anfingen. Und wenn er sich so umsah, hatte es ganz den Anschein. Das war wohl auch der Grund, weshalb die alte Jungfer ihn so hatte abblitzen lassen.
Es dauerte eine Weile, bis er sich zum Archiv durchgearbeitet hatte. Es war der letzte Raum, hinten am Ende des Korridors. Angesichts der langen Reihen von Aktenschränken überlegte der Mann abermals kurz, ob er es nicht doch wagen sollte, Licht zu machen. Aber, besser doch nicht. Zwei große Fenster führten auf die Straße hinaus, und die Tür mündete auf den äußeren Hauptflur. Sicher schloss das alte Ding nicht dicht, und ein feiner Strahl könnte durch die Ritzen hinausdringen.
Mein Gott, Aktenschränke – nichts als Aktenschränke! Da – der dort drüben war es. D – E stand auf dem Zettel in dem kleinen Metallrahmen. Der Schrank war nicht einmal verschlossen. Nicht, dass es ein bemerkenswertes Hindernis für ihn bedeutet hätte. Aber das Öffnen eines Stahlschrankes ist nun mal unweigerlich mit Lärm verbunden.
Der gesuchte Ordner war dick angefüllt. Wenn solche Leute einmal anfingen, Berichte abzulegen, gab es nichts, was sie für zu unwichtig hielten, miteingeheftet zu werden. Das meiste war vollkommen uninteressant für ihn. Er suchte nach etwas Bestimmtem. Zwei, drei Unterlagen nur. Doch er machte sich seufzend klar, dass es nötig sein würde, alles durchzublättern und zumindest zu überfliegen.
Der Strahl seiner Taschenlampe wurde merkbar schwächer. Dabei hatte er, bevor er von zu Hause fortging, extra zwei neue Batterien hineingetan. Verdammter Mist! Heutzutage war auch alles Schund, was man kaufte. Na ja, schließlich musste jeder sehen, wie er zu seinem Geld kam.
Aber so, bei dem kläglichen Licht, konnte er unmöglich diesen Wälzer durchsehen. Also blieb ihm gar keine andere Wahl – er musste ihn eben mitnehmen. Eigentlich war das gar nicht seine Absicht gewesen. Sicher nahmen sie hier ohnehin die einzelnen Ordner nur alle Jubeljahre einmal in die Hand. Aber wie das Unglück es wollte – dieses eine Mal könnte ausgerechnet morgen sein. Und wenn die alte Jungfer hörte, dass ausgerechnet diese Akten nicht aufzufinden waren, kam ihr womöglich ein naheliegender Verdacht. Also – was tun? Den Ordner mit in seine Wohnung nehmen, heraussuchen, was er benötigte, und ihn dann schleunigst wieder an Ort und Stelle schaffen? Das würde ziemlich umständlich sein und brachte eine Menge Unannehmlichkeiten, mit sich. Ach, Unsinn. Die Chancen, dass der Verlust bemerkt wurde, standen hundert zu eins.
Es gab natürlich auch noch eine andere Möglichkeit. Er konnte den Ordner mit hinunternehmen und versuchen, im Licht über dem Pult des Hausmeisters das Gewünschte herauszufinden. Vielleicht hatte der Alte seine Mütze auf dem Tisch liegengelassen, sodass er diese aufsetzen konnte. Als oberflächliche Tarnung sozusagen, falls jemand von draußen hereinsah. Jeder würde dann annehmen, der gewissenhafte Hausmeister macht eben noch Nachtschicht. Wenn er dem Alten, weiß Gott, auch nicht gerade ähnlich sah.
Den Ordner unter den Arm geklemmt, ging der Mann auf die Tür zu, welche auf den Hauptflur führte. Er hatte die Hand bereits auf der Klinke, als er das Näherkommen schlurfender Schritte hörte. Nicht einmal das wohlbekannte, leise Knarren der Dielenbretter unter dem abgetretenen Linoleumbelag entging dem angespannt Lauschenden. Zum Teufel, also machte der alte Idiot doch nächtliche Runden. Damit hatte er allerdings nicht gerechnet.
Nicht, dass er sich gefürchtet hätte. Es war ihm im Grunde genommen vollkommen gleichgültig. Hier, in dem kleinen Büro, würde er schon nicht aufgestöbert werden. Aber die Notlösung mit dem Pult unten beim Eingang fiel damit aus.
Regungslos wartete er, bis die Schritte sich entfernt hatten und das Ächzen des morschen Holzes verklungen war. Scheppernd schloss sich eine Tür, vermutlich die Tür des altersschwachen Aufzugs. Steher konnte man es natürlich nicht wissen, aber vermutlich war der Alte wieder nach unten gefahren, um schleunigst in die warmen Federn zurückzukriechen.
Lautlos öffnete der Mann die Tür und zog sie hinter sich ins Schloss. Dann schlich er die Treppe hinunter. Bevor er sich in die Halle hinauswagte, blieb er noch einmal stehen, um angestrengt zu lauschen. Tatsächlich, der Fahrstuhl war ratternd in Bewegung gesetzt worden und verursachte dabei genauso viel Lärm, wie er vorhin vermutet hatte.
Hastig eilte der Mann durch die Halle auf die Straße hinaus. Hier hielt er aufatmend einen Moment an und ging dann, sich zu Langsamkeit zwingend, weiter. Den Ordner fest unter den Arm geklemmt, schritt er in der lauen Sommernacht dahin. Als er endlich die 23. Straße erreicht hatte, meinte er, weit genug entfernt zu sein, um ohne Risiko ein Taxi nehmen zu können. Nicht, dass überhaupt ein irgendwie geartetes Risiko bestanden hätte. Trotzdem, Vorsicht war immer besser als Nachsicht. So winkte er einen Wagen heran, stieg ein und nannte dem Fahrer die Adresse Ecke achte Avenue und 12. Straße. Von dort aus war es nicht mehr weit bis nach Hause. Und doch lag es nicht so nah, dass es ihm im Fall der Fälle hätte gefährlich werden können. Sollte der Chauffeur diese Anschrift ruhig in sein Fahrtenbuch eintragen. Ganz abgesehen davon, dass sich ja ohnehin niemand für das Fahrtenbuch interessieren würde.
Diese Sache würde ohne Komplikationen abgehen. Hübsch glatt und reibungslos. Alles war nahezu ein Kinderspiel. Es wurde ja auch Zeit, dass das Glück einmal auf seiner Seite war. In letzter Zeit war ja wirklich alles schiefgelaufen. Er war geradezu vom Pech verfolgt gewesen. Wer konnte denn auch ahnen, dass ausgerechnet ein Bursche, dem man sachte eins über den Schädel gab, nur, um ihn für eine Weile unschädlich zu machen, eine alte Kopfverletzung hatte und gleich dabei draufgehen würde. Du meine Güte, der Krieg war schließlich jetzt fast zwanzig Jahre vorbei. Und obendrein, wer eine derart empfindliche Schädeldecke hatte, sollte eben keinen Job als Nachtwächter annehmen. Das hieß das Schicksal doch geradezu herausfordern! Dumm nur, dass ausgerechnet er das Werkzeug dieses Schicksals hatte sein müssen.
Ach, du lieber Himmel, was hatte diese Geschichte Staub aufgewirbelt. Was für ein Geschrei deswegen. Alle Zeitungen waren voll davon gewesen, als ob in der großen, weiten Welt nichts Wichtigeres passieren würde. Die Daily News vor allem, die hatte den Fall am ärgsten ausgeschlachtet. Dummerweise war der Bursche auch noch Vater von vier kleinen Kindern gewesen. Na, und wenn schon. Viele Leute hatten Kinder. Und Kriegsveteran war der Kerl auch gewesen. Dem Lamento nach zu urteilen, hatten die Reporter schon lange darauf gelauert, ihre Federn an einem erschlagenen Kriegsveteranen mit unversorgt zurückbleibender Familie zu wetzen. Sie weideten sich geradezu daran, dieses Thema gründlich auszuschlachten und die Tränendrüsen ihrer Leser anzuregen.
So was las man alle Tage in der Zeitung. Aber nicht alle Tage war ausgerechnet er in den Mist verwickelt.
Nun, diesmal lagen die Dinge anders. Diesmal würde es keine Zwischenfälle geben. Niemand würde dabei auf der Strecke bleiben. Er würde herausholen, was herauszuholen war. Und dann würde er sich für eine Weile aus dem Staube machen. Sich absetzen, sozusagen. Heraus aus der Stadt, irgendwohin – weit weg. Nicht, dass das verdammte Bild ihm besonders ähnlich gewesen wäre. Er sah darauf aus, wie hunderttausend andere auch. Eine Skizze des Täters, angefertigt nach den Aussagen der Zeugen, hatte darunter gestanden. So ein Quatsch! Einen Dreck war die Zeichnung wert! Trotzdem, Vorsicht...
»Guten Abend, Joe«, grüßte Miss Eleanor Howell freundlich. »Wie geht es denn Ihrer Frau?«
»’n Abend, Miss Howell«, gab Joe zurück und erklärte, dass es seiner Frau unverändert ginge. Dann schloss er die Fahrstuhltür und drückte auf den zweiten Knopf. Oben angekommen, öffnete er zuvorkommend die beiden Flügel und sah ihr nach, bis sie in ihrer Wohnung verschwunden war.
Es muss ungefähr halb acht sein, überlegte Joe und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Richtig, auf die Minute halb acht. Nach Miss Eleanor Howell hätte man eine Uhr stellen können. Mit eintöniger Regelmäßigkeit kam sie jeden Tag gegen halb acht vom Sonnenblumen-Tea-Room zurück, wo sie ihr Abendessen einzunehmen pflegte. Es tat Joe jedes Mal direkt wohl, Miss Howell zu sehen. Er wusste selbst nicht recht, warum. Es sei denn, dass ihr Anblick, wie sie so ruhig und zielbewusst die Straße heraufkam und später den Flur hinunterschritt, einem ein Gefühl der Kontinuität verlieh und allen Dingen eine gewisse Ordnung und Beständigkeit.
Nicht, dass er es in Gedanken so klar formuliert hätte. Er empfand lediglich heute, wie jeden Tag, ein wohltuendes Gefühl der Wärme und Geborgenheit, wenn er sie sah.
Joe versank jedes Mal in Erinnerungen, wenn sich die Tür hinter Miss Howell geschlossen hatte. Er erinnerte sich an jene Tage, als das Haus in der 20. Straße noch neu und prächtig gewesen war, und er selbst noch jung und rüstig. Das war jetzt fast zwanzig Jahre her. Ja, damals, vor zwanzig Jahren, hatten noch eine Menge feiner Leute hier gewohnt, Leute wie Miss Howell. Und er war damals der Überzeugung gewesen, dass sein Dasein als Fahrstuhlführer lediglich der Anfang einer Karriere sein würde, die erste Sprosse auf der Leiter zum Erfolg. Jedem der Gebäude, die zusammen den Chelsea Block bildeten, stand damals ein Hausmeister, fast schon ein Verwalter, vor. Und mit fünfundzwanzig ist man noch so davon überzeugt, dass die ganze Welt offen vor einem liegt und dass man sich leichtfüßig emporschwingen wird, von Sprosse zu Sprosse. Mit fünfundvierzig sieht man weiter. Man begräbt seine Träume, kennt seine Grenzen und findet sich mit dem Alltag ab.
Jetzt gab es nicht mehr viele Mieter wie Miss Howell hier im Haus. Die Pracht war verblichen, das Ganze machte einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck. Von Verwaltern, Hausmeistern oder Portiers war schon lange keine Rede mehr. Und gleichzeitig waren nach und nach alle ordentlichen Mieter ausgezogen, einer nach dem anderen. Wenn man Joe fragte, lag das, seiner Meinung nach, an den Portorikanern. Diese waren in rauen Scharen in diesen Stadtteil gezogen und bevölkerten die ganze Nachbarschaft. Und die soliden Mieter empfanden ihre Nähe vermutlich als beunruhigend und hielten die Gegend nicht mehr für sicher. Was ihn anbetraf, so hegte Joe keinen persönlichen Groll gegen die Portorikaner. Im Gegenteil, sicher waren auch unter ihnen ganz ordentliche Leute, und im Großen und Ganzen machten sie wenig Scherereien. Nur waren sie einfach anders; fremdartig und dadurch vielleicht ein bisschen unheimlich. Wenn man Miss Howell so sah, hätte man gedacht, dass sie als eine der ersten das Feld geräumt hätte. Aber nein. Sie blieb. Sie war immer noch da.
Miss Howell war überhaupt ein Rätsel. Man hätte denken können, sie müsste schon lange verheiratet sein, glücklich verheiratet, müsste Kinder haben, die längst schon auf die höhere Schule gingen oder gar schon studierten. Sie war wie geschaffen dafür. Ihr Leben müsste ausgefüllt sein von einem Mann, Kindern, ja in absehbarer Zeit sogar Enkelkindern. Aber nichts von alledem. Sie war allein. Alle ihre Anlagen und Talente verkümmerten ungenützt. Was wieder einmal bewies – dachte Joe –, dass nicht alles im Leben so zu kommen pflegt, wie man es eigentlich erwarten würde.
Miss Howell war eine gesunde, zierliche Frau mit einem runden, hübschen Gesicht. Sie hatte eine feine, rosa getönte Pfirsichhaut. Nur unter den Augen zeigten sich die ersten Fältelten, unter Augen von strahlendem Blau, nebenbei bemerkt. Das weich gewellte, weiße Haar bildete einen leuchtenden Kontrast dazu.
Während Joe so seinen Gedanken über sie nachhing, betrat Miss Howell ihre kleine Zweizimmerwohnung, zu der noch ein Bad und eine winzige Küche gehörten. Die ganze Wohnung hätte eine Überholung nötig gehabt. So gut wie alle der mehr als hundert Wohnungen im Chelsea Block bedurften dringend einer Renovierung. Miss Howells kleines Reich strömte eine persönliche, anheimelnde und gemütliche Atmosphäre aus, wenn auch die Lehnen des kleinen, zweisitzigen Sofas und der Sessel verschlissen waren und teilweise bereits die Federn zum Vorschein kamen. Das war Tobys Werk, jetzt sprang er lautlos und graziös von einem der beschädigten Sessel herunter und kam schnurrend auf Miss Howell zu. Dicht vor ihr blieb der schwarze Kater erwartungsvoll stehen, bis sie sich bückte, um ihn hinter dem Ohr zu kraulen. Dann schmiegte er sich wohlig schnurrend an ihre Beine und strich daran entlang. Er hatte ihr großzügig vergeben, dass sie ihn den ganzen Tag über alleingelassen hatte.
»Nun, Toby? Wie geht’s? Wie hast du den Tag verbracht?«, erkundigte sich Miss Howell zärtlich. Toby antwortete mit einem kurzen, aber unmissverständlichen Laut, um ihr zu zeigen, wie albern diese Frage war. Natürlich war der Tag endlos gewesen. Es war ihm schlecht ergangen, äußerst schlecht. Sein Frauchen hatte leider am Morgen, bevor sie ging, daran gedacht, das auf die Feuerleiter hinausgehende Fenster zu schließen. Das Fenster, das für ihn zur Freiheit führte. Toby hatte einen nicht enden wollenden, langweiligen Tag hinter sich.
Miss Howell sah sich in ihrem kleinen Salon um und seufzte. Toby hatte sich eine neue, bisher noch unbeschädigte Ecke des Sofas vorgenommen. Und er war, wie immer, überaus erfolgreich gewesen. Sie musste wirklich einmal seine Krallen stutzen lassen, überlegte sie. Nur, dass Toby, geschickt wie er war, jedes nicht ganz sicher verschlossene Fenster aufmachte, um dann ungehindert auf Abenteuer auszugehen. Und ein Kater auf dem Kriegspfad ist ohne Krallen seinen Feinden hilflos ausgeliefert.
Ach, es war doch schön, von einem Lebewesen erwartet zu werden, wenn man nach Hause kam. Von einem Kater, der sich, nachdem er gefressen hatte, auf ihrem Schoß zusammenrollte und leise vor sich hin schnurrte, dass sein ganzer Körper leicht vibrierte. Natürlich möglichst direkt auf dem Buch, das inan gerade lesen wollte.
Sie machte Tobys Futter fertig und ließ sich erschöpft auf einen der misshandelten Sessel neben dem Fenster sinken. Sie öffnete es weit, um die laue Nachtluft einzulassen, die mit dem unvermeidlichen Benzingestank und Lärm der Großstadt vermischt war. Toby landete, nachdem er sich gründlich geputzt hatte, mit einem federnden Satz auf ihrem Schoß, um erst mit der rechten, dann mit der linken Pfote ihre Knie zu bearbeiten. Seine Krallen waren wirklich schon verteufelt scharf und äußerst schmerzhaft. Es half alles nichts, sie musste sie gelegentlich doch einmal stutzen lassen.
Sie griff dann jedoch nicht nach dem Buch auf dem kleinen Tisch, neben dem Sessel. Sie drehte auch nicht, wie sonst jeden Abend, den Radioapparat an, der um diese Zeit immer leichte Unterhaltungsmusik brachte, wie sie sie gerne hatte. Das hatte mehrere Gründe. Zum Teil kam es daher, dass sie sich müde und ausgelaugt fühlte. Ein Tag im Büro von kurz vor neun bis abends sechs Uhr war eben doch sehr lang. Besonders, wenn er, wie heute, nur Unannehmlichkeiten mit sich brachte. An diesem Abend wurde es Eleanor Howell, wie häufiger in letzter Zeit, bewusst, dass sie eben doch nicht mehr die Jüngste war. Im Grunde genommen lächerlich. Fünfundfünfzig Jahre – was war das schon! Aber, was nützte alle Vernunft – solche Stimmungen, solche Augenblicke der Erschöpfung kamen nun manchmal über einen, ob man wollte oder nicht.
Aber das alles war es ja gar nicht, was sie davon abhielt, das Radio einzuschalten. Während sie Toby gleichmäßig hinter seinen durchscheinenden rosa Ohren kraulte, waren ihre Gedanken weit fort und beschäftigten sich mit etwas ganz anderem. Dieser Mann von gestern wollte ihr einfach nicht aus dem Kopf. Der Mann, der sich so erbittert mit ihr über Sinn und Zweck von Vorschriften, die nun einmal unbedingt zu respektieren waren, gestritten hatte. Es war weniger seine Beharrlichkeit, die ihr zu schaffen machte. Manche Menschen konnten eben einfach nicht einsehen, dass Gesetze unterschiedslos für alle gelten. Nein, es war der Mann selbst. Es war etwas Böses an ihm gewesen.
Eleanor Howell war im Allgemeinen sehr vorsichtig bei der Beurteilung von Menschen und neigte stets dazu, zunächst das Positive an ihnen zu sehen. Wenn sie also einmal ein derart hartes Urteil fällte, so wog es doppelt schwer.
Es war deprimierend, mit solchen Problemen nach Hause gehen zu müssen. In ihrem Beruf war Eleanor Howell im Laufe der letzten dreißig Jahre mit ungezählten Menschen zusammengekommen. Mit den unterschiedlichsten Menschentypen. Und dabei gewiss auch mit Menschen, die auf den ersten Blick einen viel übleren Eindruck machten, als der Mann, der sie so beschäftigte. Gewiss, ebenso gut auch mit erfreulicheren. Aber einige waren schon darunter gewesen, die ihr die Haare hätten zu Berge stehen lassen – so wie sich Tobys Fell mitunter sträubte, wenn sie ihnen Gelegenheit gegeben hätte, sich auszutoben, sich zu zeigen, wie sie wirklich waren. Sie war Menschen begegnet, deren Anblick ihr fast das Herz gebrochen hätte, wäre diesen Unglücklichen damit geholfen gewesen. So wie heute Vormittag zum Beispiel. Die kleine Winifred, ein Kind von fünf Jahren, mit riesigen, braunen Augen und einem hübschen, runden Gesicht. Ein vergnügtes, fröhliches Kind unter anderen. Ein Kind, das spielte, das den Erwachsenen, auch ihr, unerschütterliches Vertrauen entgegenbrachte. Ein kleines Mädchen, das nicht gesehen hatte, wie der Arzt langsam den Kopf geschüttelt hatte. Dieses folgenschwere Kopfschütteln hätte dem Kind ohnehin nichts gesagt, selbst wenn es etwas bemerkt hätte. Eleanor Howell hingegen hatte dies Kopfschütteln zu deuten gewusst. Für sie hatte es eine unmissverständliche Sprache gesprochen. Nein hatte es geheißen. Nein, sie würde nie wieder gesund werden, die kleine Winifred; sie würde nicht mehr lange zu leben haben. Das Urteil war gefallen – sie hatte Leukämie.
So etwas konnte man doch nicht ohne weiteres hinnehmen. Man konnte nicht einfach hinterher zur Tagesordnung übergehen. Und doch musste man es – sie, Eleanor Howell zumindest, musste es jeden Tag aufs Neue. Musste es auch heute. Es gab nichts, was sie für das liebe, kleine Geschöpf mit seinen riesigen, braunen Augen hätte tun können. Tommy hingegen – Tommys Augen würde eine Operation helfen können. Und wenn Emily Saunders, eine ihrer Schützlinge, herausschrie, dass sie es nie sehen wollte, nie, nie, kein einziges Mal! – so musste Eleanor auch damit fertigwerden. Dafür war es ja dann auch eine große Freude, wenige Minuten später Dorothy Kemp, die auch erst neunzehn war, mit leuchtendem Gesicht versichern zu hören, dass sie es nun, nachdem sie sich alles noch einmal in Ruhe überlegt hätte, nie, um nichts auf der Welt, aufgeben würde. Dass sie lieber sterben würde, als sich von ihm zu trennen. Eleanor Howell hatte das Mädchen, das ja selbst noch fast ein Kind war, gelobt, ihr bestätigt, dass sie sehr tapfer wäre und jedermanns Hochachtung verdiene. Und anschließend hinzugefügt – nüchtern genug, wie sie hoffte – dass die Alternative des lieber Sterben allerdings keine große Hilfe, geschweige denn eine befriedigende Lösung wäre.
Alle diese Dinge gab es wirklich. Eleanor Howell konnte sie beeinflussen, oder zumindest aktiv darauf reagieren. Sie konnte sich einsetzen bis zur Grenze ihrer Möglichkeiten und sich selbst mit gutem Gewissen gegenübertreten. Man konnte versuchen, diese Dinge zu beeinflussen und war manchmal erfolgreich und ein anderes Mal nicht. Dreißig Jahre hatte Eleanor Howell alles in ihrer Kraft Stehende getan, um zu helfen. Im Verlauf dieser dreißig Jahre hatte sie vieles gesehen und vieles gelernt. Sie wusste, dass in dem Häusermeer der Stadt New York, hinter schweigenden Mauern, am Ende dunkler Flure und Gänge sich Dinge ereigneten, sich Schicksale erfüllten, von denen die meisten Polizeibeamten nicht die leiseste Ahnung hatten. Es gab immer noch vieles, was Eleanor Howell berührte; überraschen konnte sie schon lange nichts mehr.
Was an diesem Mann einen so niederträchtigen, gemeinen Eindruck auf sie gemacht hatte, war weniger greifbar. Es war nicht in Worte zu fassen und nicht zu erklären. Seine unsteten Augen zum Beispiel. Wenn sie ihn ansah, waren ihr unzählige andere Männer eingefallen, von denen die gleiche Ausstrahlung ausgegangen war: eine undefinierbare Verschlagenheit, ja Tücke. Nun, etwas Ungutes eben, etwas Böses, um es einfach auszudrücken. Sie hatte seiner Bitte ein schroffes Nein entgegengesetzt und ihm erklärt, dass die gewünschten Informationen streng vertraulich wären. Dass sie dem Siegel der Verschwiegenheit unterliegen, das sie nicht brechen werde. Weder heute noch ein andermal. Es hatte lange gedauert, bis er sich zufriedengegeben hatte. Sie hatte sich seinen Namen und seine Anschrift notiert, ihm aber gleichzeitig unmissverständlich klargemacht, dass sie wohl kaum Gelegenheit haben würde, davon Gebrauch zu machen, da ihre Antwort ein für allemal feststand. Sie hatte schließlich eine kurze Aktennotiz diktiert und Anweisung gegeben, diese sofort abzuheften. Und damit hätte die Angelegenheit für sie eigentlich erledigt sein sollen.
Das war jedoch keineswegs der Fall. Im Gegenteil. Miss Howell, die geistesabwesend das weiche Fell des Katers streichelte, musste sich eingestehen, dass eine düstere Vorahnung sie quälte, als ob diese Angelegenheit noch lange nicht abgeschlossen wäre. Sie konnte sich des Gefühls nicht erwehren, etwas übersehen zu haben – und zwar etwas, das sich als sehr bedeutungsvoll und folgenschwer erweisen konnte. Etwas, das mehr erfordert hätte als eine gewissenhaft diktierte und ebenso gewissenhaft abgelegte Aktennotiz. Es lag nicht nur an dem bedrückenden Eindruck, den sie von dem Mann gewonnen hatte, und an ihrer Überzeugung, dass es sich um einen ausgesprochen minderwertigen Charakter handelte, der darüber hinaus etwas Hinterhältiges im Schilde führte. Nein, es war noch etwas anderes. Irgendwo, in ihrem Unterbewusstsein, schlummerte es und vermochte nicht an die Oberfläche zu dringen. Wie manchmal, wenn man ein bestimmtes Wort suchte, das einem auf der Zunge zu liegen schien, und das einem einfach nicht einfallen wollte. Sie hatte das Empfinden, dass das, woran sie sich so krampfhaft zu erinnern suchte, auch schon lange zurücklag, fast verschüttet unter jüngeren Erlebnissen und Eindrücken. Vierzehn Jahre war es her.
Sie hatte aufgehört, Toby zu streicheln. Empört über diese Nachlässigkeit, erinnerte er sie nachdrücklich an seine Anwesenheit. Aber seine Herrin war jetzt von etwas anderem in Anspruch genommen. Beleidigt verließ er seinen vertrauten Platz auf ihrem Schoß und sprang hinüber auf das Sofa, um dort sein erfolgreiches Zerstörungswerk fortzusetzen. Erzürnt und heftig schlug er seine Krallen in den weichen Stoff. Er würde es ihr schon zeigen!
Vielleicht kommt es auch bloß daher, dass ich das Mädchen so gut kenne – so, wie sie sich entwickelt hat, wie sie heute ist grübelte Eleanor Howell weiter. Sie war hin und wieder mit ihr essen gegangen und hatte mit ihr geplaudert. Hier bestand ein persönlicher Kontakt. So hatte ihr das junge Mädchen beispielsweise kürzlich erst eine Fotographie gezeigt. Das Foto des Mannes, den sie heiraten würde. Ein ausgesprochen gutaussehender Mann. Und...
Ein Foto!, schrak Eleanor Howell auf. Ein Foto! Das war es. Hier lag der entscheidende Fehler. Ein Foto, das nicht passte.
Einen Augenblick lang verspürte sie fast ein Gefühl der Erleichterung, das aber nicht andauerte. Es war so ewig lange her. Vierzehn Jahre! Über eine derartige Zeitspanne hinweg verwischt sich m der Erinnerung ein Gesicht auf einer Fotographie. Trotzdem...
»Toby, lass das!«, schalt Eleanor Howell ihren Kater.
Dieser wandte träge den Kopf, warf ihr aus schmalen Augenschützen einen beleidigten Blick zu und fuhr dann unverdrossen mit seinem Zerstörungswerk fort.
Morgen – nahm sich Eleanor Howell vor –, morgen nehme ich mir die Zeit, die Unterlagen durchzusehen. Bestimmt! Ich muss einfach, sonst finde ich doch keine Ruhe. »Toby, du sollst das lassen!«
Er kannte das Leben zu gut und hatte sich den Wind zu lange um die Ohren wehen lassen, um noch leicht aus der Fassung zu geraten. Aber als er endlich gefunden hatte, was er suchte, verschlug es ihm doch zunächst einmal fast den Atem. Diesmal schien er wirklich ein gutes Blatt in der Hand zu haben. Er hatte zwar gewusst, dass sie auf die Butterseite gefallen war. Aber darauf war er doch nicht vorbereitet gewesen. Die alte Jungfer hatte von recht wohlhabend gesprochen und gesagt, er brauche sich wirklich keine Sorgen zu machen. Die schlaue alte Glucke hatte sich absichtlich so vage ausgedrückt und tiefgestapelt, damit er nicht etwa Lust bekam, der Sache auf den Grund zu gehen und womöglich ein Stück von der Torte für sich abzuschneiden. Oh, nein, sie war gewiss nicht dumm! Sie wusste ganz genau, was sie tat!
Ein Mann musste schon ein großes Tier sein, in der Politik oder im Geschäftsleben, wenn sich alle Zeitungen spaltenlang darüber verbreiteten, dass er zwar einen Herzinfarkt erlitten hätte, aber bereits auf dem Wege der Besserung sei und sich in Kürze vollkommen erholt haben dürfte. Wenn man, wie für ein Mitglied einer königlichen Familie sozusagen ein tägliches Bulletin herausbrachte. Der Bursche versprach ja, eine wahre Goldgrube für ihn zu werden!
Name und Adresse waren säuberlich in den Akten notiert, und die Telefonnummer stand sogar im öffentlichen Telefonbuch. Das war einer der wenigen Punkte gewesen, die ihm bisher Sorgen gemacht hatten. Es gab genug solche Wirtschaftskanonen, die auf Grund ihrer Sonderstellung eine Geheimnummer besaßen, die nicht im Telefonbuch verzeichnet war.
Dass der Bursche jetzt im Krankenhaus lag, bedeutete, dass er seinen Plan etwas abändern musste. Aber es führten ja bekanntlich viele Wege nach Rom. Er würde sich schon den sichersten und bequemsten heraussuchen. Wenn er es recht bedachte, konnte die veränderte Situation sogar ihre Vorteile haben. Ein kranker, ein schwerkranker Mann braucht unter allen Umständen seine Buhe. Das wusste jedes Kind.
Und jeder, der dem Kranken nahestand, musste und würde alles in seiner Macht Stehende tun, ihm diese Ruhe zu erhalten. Auch das wusste ein jeder.
Zweites Kapitel
Als sie am frühen Nachmittag die Wohnung betrat, kam ihr diese bedrückend groß vor. Es schienen plötzlich ganz andere Zimmer zu sein als im Winter. Obwohl schon damals alles viel zu weiträumig für nur zwei Personen gewesen war. Jetzt bedeutete die ehemals so vertraute Umgebung für sie nicht viel mehr, als eine Möglichkeit, sich irgendwo aufzuhalten, zu schlafen – und zu warten. Das einzige, was jetzt zählte, war, dass es von hier näher zum Krankenhaus war, als von New Canaan aus.
Er hatte sehr still ausgesehen und sehr – abwesend. Abwesend, weit fort, unerreichbar in einer ihr verschlossenen Welt. Vielleicht war daran hauptsächlich das Sauerstoffzelt schuld gewesen. Dieses Zelt, das nur eine Vorsichtsmaßnahme darstellte und keineswegs Anlass zur Besorgnis bot – wie man ihr versichert hatte. Und schon gar nicht zu der Befürchtung, dass seine Genesung nicht die vorausgesagten, langsamen, aber sicheren Fortschritte machte. Er hatte sie durch das durchsichtige Zelt hindurch angelächelt, ihr gezeigt, wie sehr er sich über ihren Besuch freute. Dann war die Schwester lautlos eingetreten und hatte in einem höflichen, aber keinen Widerspruch duldenden Ton geäußert, dass es für den Patienten besser wäre, sein Besuch ginge jetzt. Wir müssen uns hüten, uns zu überanstrengen, nicht wahr?, hatte sie gemeint. Und er hatte abermals zu ihr aufgelächelt. In diesem Lächeln hatte etwas Aufmunterndes gelegen und eine Spur von Belustigung. Es war fast sein gewohntes, leicht ironisches Lächeln gewesen. Er hatte schon wieder eine gewisse Ähnlichkeit mit sich selbst gehabt.
Es ist ungerecht, dachte sie. Ja, es ist gemein und ungerecht! Er ist ja noch nicht einmal sechzig. Vor einer Woche hat er noch Tennis gespielt. Andere Männer sind viel, viel älter als er und....
Sie riss sich verzweifelt zusammen. Es hatte keinen Sinn, sich derartig gehen zu lassen. Ob es nun gerecht war oder nicht, das änderte nichts an den bestehenden Tatsachen. Er konnte plötzlich gestorben sein, während sie vom Krankenhaus hierher unterwegs war. Weil es solch ein herrlicher Tag war, war sie ausnahmsweise einmal zu Fuß gegangen. Sie hätte doch fahren sollen. Zu Fuß dauerte der Weg mehr als eine halbe Stunde. Womöglich hatte man – während sie gedankenlos die Sonne genoss – verzweifelt versucht, sie telefonisch zu erreichen, um ihr zu sagen – was zu sagen? Was für Worte würde man gebrauchen? Würde man sagen, dass er von uns gegangen sei? Diese Phrase würde sie nicht ertragen können. »Ihr Vater ist tot.« Das war genug – und das klang erheblich besser. Wenn es hieß: »Ihr Vater ist tot«, ja, das würde sie vielleicht ertragen können. Oder: »Ihr Vater ist vor wenigen Minuten gestorben.« Auch das würde sie ertragen können. Aber nur dann konnte sie es ertragen, wenn der Arzt ehrliche, schlichte Worte gebrauchte.
Mein Gott!, dachte sie. Was machte sie? Welcher Wahnsinn, sich den Kopf über ihre Reaktion zu zerbrechen; nur an sich zu denken, statt an ihn! Wie hatte der Chefarzt es doch heute früh ausgedrückt? Alles spräche dafür, dass es jetzt aufwärts ginge. Dass die größte Aussicht bestünde, der Patient würde sich wieder vollkommen erholen. Man hatte sie freundlich ermahnt, sich keine übertriebenen Sorgen zu machen. Hatte betont, dass der Prozentsatz der so gut wie vollständigen Genesungen außerordentlich hoch läge. Man hatte ihr Hoffnung gemacht, dass er bei sorgfältiger Pflege noch viele Jahre vor sich haben konnte. Jahre, in denen er vollkommen oder so gut wie vollkommen normal leben durfte. Ja, er konnte, wenn er erst einmal so weit wiederhergestellt war, sogar wieder Golf spielen, wenn er Lust dazu verspürte. Natürlich musste er darauf achten, sich nicht zu viel zuzumuten. Papa spielte nicht Golf – mein Gott, wie sie es hasste, dieses scheinheilige, nichtssagende Gerede! Tennis spielte er! Und wie!
Dass sie sich hier so hemmungslos gehenließ – überlegte sie –, lag wohl daran, dass sie sich im Krankenhaus immer so eisern zusammennehmen musste. Dort musste sie lächeln und zuversichtlich aussehen. Ganz bestimmt nicht übertrieben besorgt – überhaupt nicht besorgt! Nein, nein, sie machte sich natürlich nicht die geringsten Sorgen! Weshalb auch? Es handelt sich doch lediglich um eine leichte Erkrankung der Koronargefäße, Papa. Nicht schlimmer, als wenn du dir – als wenn du dir den Knöchel verstaucht hättest. Wie oft hatte sie das nicht schon beteuert. Wie oft! – Doch nicht zu oft! Und immer schön gleichmütig. Nur so leichthin, ganz nebenbei.
Schluss jetzt damit!, befahl sie sich. Du bist doch niemand, der so ohne weiteres die Nerven verliert. Trinke einen Schluck Alkohol! Mach dir ein Sandwich! Das war immer gut. Das half immer. Und die Zeitung – Zeitung lesen lenkte immer ab.
Sie ging hinüber in die Bibliothek, trat an die eingebaute Hausbar und mixte sich einen Drink. Alles hier erinnerte sie an ihren Vater. Schließlich war es ja auch sein Zimmer. Gerade als sie die Flüssigkeit mit den kleinen, klirrenden Eisstückchen in das Glas gießen wollte, klingelte das Telefon. Es schrillte so laut durch die stille, leere Wohnung, dass ihr ein Schauer den Rücken hinunterlief. Der beschlagene Mixbecher entglitt ihrer Hand, fiel auf das vorbereitete Glas und zerschmetterte es in tausend kleine Scherben.
Als sie den Schreibtisch erreicht hatte, musste sie sich aufstützen und war unfähig, sofort abzuheben. Mit starren Fingern umklammerte sie den Hörer. Wieder und wieder schlug die Glocke an. Gereizt, ungeduldig. Als ob der kleine, schwarze Apparat es gar nicht erwarten könnte, ihr die grauenvolle Nachricht zu übermitteln. Endlich holte sie tief Luft, hob ab und meldete sich.
»Ja?«, fragte sie.
Eine Männerstimme meldete sich. Eine sehr leise, kaum hörbare Stimme. Als ob der Mann am anderen Ende der Leitung sehr schwach wäre, als ob es ihn ungeheure Anstrengung kosten würde, überhaupt zu sprechen.
»Ist dort Miss Sanderson?«, fragte die tonlose Stimme.
»Ja«, antwortete sie. »Ich kann Sie kaum verstehen.«
»Nora?«, flüsterte der Mann.
»Ja«, gab sie zurück. »Nora Sanderson. Aber ich kann Sie kaum verstehen. Wer spricht denn?«
»Dein Vater«, kam es zurück. »Dein Vater, Nora.«
Die ferne Stimme hatte, als der Mann seine ungeheuerliche Behauptung wiederholte, plötzlich kräftiger, deutlicher geklungen.
Ungeheuerlich deshalb, weil er nicht ihr Vater war! Diese verwischte Stimme war nicht die ihres Vaters. Nichts, nicht einmal tiefste Schwäche, konnte die Stimme ihres Vaters derartig verändern. Hier handelte es sich um – um einen abscheulichen Scherz, eine unglaublich niederträchtige.
»Sie müssen sich in der Nummer geirrt haben«, erklärte sie und zwang sich, entschieden zu sprechen. »Ich bin bestimmt nicht die Nora Sanderson, die Sie zu sprechen wünschen.«
»Das glaube ich kaum«, erwiderte der Mann, »ich bin doch mit Dexter Sandersons Wohnung verbunden, nicht wahr? In der er nannte eine Adresse, und sie stimmte. »Und Sie sind Nora Sanderson. Du hast doch gesagt, du bist Nora Sanderson?«
Sie schwieg.
»Ich bin dein Vater, Nora«, wiederholte er. »Dein richtiger, leiblicher Vater.«
»Ich glaube nicht...«, begann sie, verstummte dann aber wieder. Er ließ ihr Zeit.
»Thomas Davis«, fuhr er schließlich fort. »So heiße ich, Nora. Dein armer, alter Vater, nach so vielen Jahren.«
Dann seufzte er. Aber es klang mehr wie ein Schluchzen.