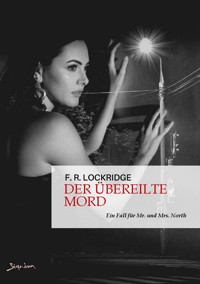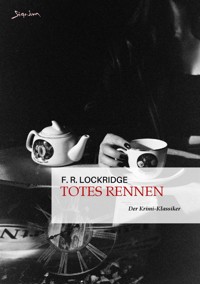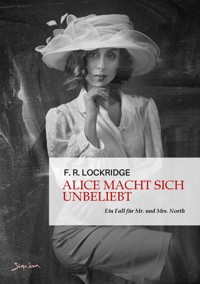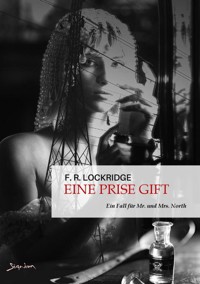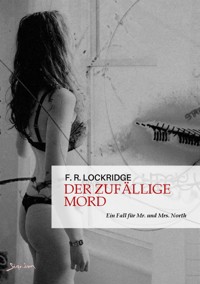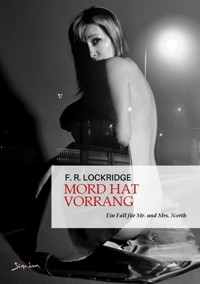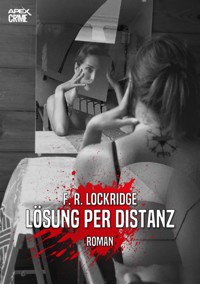5,99 €
Mehr erfahren.
Kriminal-Lieutenant Shapiro versteht nichts von Malerei. Deshalb hilft ihm die hübsche, grünäugige Doris Weigand, den Mord an dem bekannten New Yorker Maler Shackleford Jones aufzuklären.
Im Zwielicht des Künstlerviertels Greenwich Village nimmt der Mörder nun Doris ins Visier...
Der Roman Augen, grün wie eine Katze von F. R. Lockridge (* 26. September 1898 in St. Joseph, Missouri; † 19. Juni 1982 in Tyron, North Carolina) erschien erstmals im Jahr 1967; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1968.
Der Verlag DER ROMANKIOSK veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Thrillers aus der New Yorker Kunst-Szene in seiner Reihe DIE MITTERNACHTSKRIMIS.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
Augen, grün wie eine Katze
Roman
Die Mitternachtskrimis, Band 3
Der Romankiosk
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
AUGEN, GRÜN WIE EINE KATZE
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Das Buch
Kriminal-Lieutenant Shapiro versteht nichts von Malerei. Deshalb hilft ihm die hübsche, grünäugige Doris Weigand, den Mord an dem bekannten New Yorker Maler Shackleford Jones aufzuklären.
Im Zwielicht des Künstlerviertels Greenwich Village nimmt der Mörder nun Doris ins Visier...
Der Roman Augen, grün wie eine Katze von F. R. Lockridge (* 26. September 1898 in St. Joseph, Missouri; † 19. Juni 1982 in Tyron, North Carolina) erschien erstmals im Jahr 1967; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1968.
Der Verlag DER ROMANKIOSK veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Thrillers aus der New Yorker Kunst-Szene in seiner Reihe DIE MITTERNACHTSKRIMIS.
AUGEN, GRÜN WIE EINE KATZE
Erstes Kapitel
Sie bezahlte den Taxifahrer. Dann stand sie auf dem Bürgersteig und sah zu, wie das Taxi langsam die Straße hinunterrollte. An der nächsten Ecke hielt es einen Moment an und bog dann rechts ab. Das sei der richtige Weg, hatte sie dem Fahrer gesagt, um am einfachsten wieder aus dem Gewirr der Gassen herauszufinden, in das sie ihn hineindirigiert hatte. Als der Wagen außer Sicht war, stand sie noch eine kleine Weile vor dem baufälligen alten Haus. Sie wusste, dass sie es hinauszuschieben versuchte; sie wusste aber auch, dass es sinnlos war, es hinauszuschieben.
Die drei Treppen würden davon nicht weniger steil werden und die Stufen so eng bleiben, wie sie waren. Sie holte tief Atem und betrat das Gebäude. An der ersten Stufe zögerte sie noch einmal, diesmal nur ganz kurz; dann begann sie hinaufzusteigen, und wie jedes Mal erlebte sie das gleiche Schwindelgefühl. Die Stufen neigten sich schräg von der Wand weg, und ihr fiel ein, wie oft sie schon gedacht hatte, dass diese abbruchreife Hütte eines Tages in sich zusammenkrachen würde. Und gesagt hatte sie es auch oft genug, doch jedes Mal darauf eine grobe Antwort erhalten.
Oben, auf der letzten Stufe, machte sie eine Pause, um Atem zu holen.
Sie ging durch einen Flur und stand dann vor der vertrauten Tür. Sie holte den Schlüssel aus ihrer Handtasche, steckte ihn ins Schloss und versuchte ihn nach rechts zu drehen.
Er ließ sich nicht drehen.
Flüchtig kam ihr der Gedanke, er hätte das Schloss auswechseln lassen. Es sah ihm aber nicht ähnlich. Dann fiel ihr ein, dass sie wieder einmal den üblichen Fehler machte. Wenn der Schlüssel zu tief in das Schlüsselloch gesteckt wurde, schon um ein paar Millimeter zu viel, ließ er sich nicht drehen. Sie zog ihn diese paar Millimeter heraus, drehte, und das Schloss schnappte. Sie drückte die Tür auf und rief, schon während sie den großen, unaufgeräumten Raum betrat: »Shack? Bist du da, Shack?«
Sie rief laut, erhielt aber keine Antwort. Sie rief wieder. Und dann ging sie in den Raum hinein - in den riesigen Raum, der das ganze dritte Stockwerk dieses schäbigen Hauses einnahm. Sie kam nicht weit, bevor sie anhielt und beide Hände auf ihren Mund presste.
Er hatte viel Blut verloren. Er lag auf dem Boden vor der kleinen Staffelei. Das Blut hatte sich zu einer Lache unter seinem Körper ausgebreitet. Er lag mit dem Gesicht nach unten, und in seinem Hinterkopf, hinter dem rechten Ohr, war ein Loch. Der Revolver lag auf dem Fußboden, dicht neben seiner ausgestreckten rechten Hand.
Ihre Schreie hallten durch die Leere des riesigen Raumes. Sie konnte nicht aufhören zu schreien. Irgendwann drehte sie sich um und schwankte zur Tür. Das Schreien hörte noch immer nicht auf. Aber es schien, als käme es nicht mehr aus ihrem Mund.
Sie zog die Tür weit auf, und jetzt endlich formten sich Worte. »Hilfe!«, schrie sie. »Hilfe!«
Sie taumelte zur obersten Treppenstufe und beugte sich über das Geländer.
Erst meinte sie, von niemandem gehört zu werden. Sie begann die Stufen hinunterzugehen. Aber dann vernahm sie unten das Zuschlägen einer Tür und Schritte im Treppenhaus.
Sich noch immer am Geländer festklammernd, ließ sie sich auf die Stufe hinuntergleiten und blieb dort sitzen.
Der Mann, der durch den darunterliegenden Flur und dann die Treppe zu ihr heraufgerannt kam, war breit und untersetzt. Sein weißes Hemd stand am Kragen offen. Sobald er die Treppe zur Hälfte erklommen hatte, blieb er stehen und fragte: »Was ist los, Madam?« Er redete laut, schrie die Worte beinahe heraus.
Sie zeigte hinter sich und zog sich langsam hoch.
»Mr. Jones«, stammelte sie. »Dort drinnen.« Wieder zeigte sie auf die offene Tür. »Er ist - er ist tot! Er ist...« Ihre Stimme brach krächzend ab, und sie drängte sich an die Wand, um den breiten Mann vorbeizulassen. Dann redete sie wieder, mit leiser, zitternder, aber deutlich verständlicher Stimme. »Er hat sich umgebracht. Shade hat sich erschossen.«
Dann lehnte sie sich an die Wand und begann zu schluchzen.
Zweites Kapitel
Lieutenant Nathan Shapiro sah sich in dem riesigen Raum um und gestand sich, dass dies weit über seine geistigen Kräfte ging. Das war keine Überraschung für ihn. Er war an seine Unzulänglichkeit gewöhnt und nur darüber erstaunt, dass diese offenbar nicht allgemein bekannt war. Captain William Weigand, der Leiter des Morddezernats Süd, sollte, nach Shapiros Meinung, wahrlich der erste sein, der die Grenzen seines Untergebenen erkannte.
»Sieht wie Selbstmord aus, Nate«, hatte Weigand an diesem Juninachmittag gesagt. »Im Revier ist man damit zufrieden. Unser Doktor ist es nicht. Ihm gefällt der Schusswinkel nicht. Es geht also auf die Frage Selbstmord oder Mord hinaus. Sie können Tony Cook haben.«
Sergeant Tony Cook hatte Schwierigkeiten, die Little Great Smith Street zu finden. Der Polizeiwagen fuhr in zahllose falsche Abzweigungen hinein, bevor er endlich die richtige fand. Cook war erst kürzlich vom Polizeirevier Bronx zum Morddezernat Süd versetzt worden, und das aus Gründen, die ihn selbst verblüfften. In Bronx kannte er jede Hintergasse. Aber hier, in Greenwich Village, da war er verraten und verloren. Little Great Smith Street! Ganz Greenwich Village konnte ihm gestohlen bleiben.
Shapiro seufzte mitfühlend und gedachte wehmütig seiner Zeit in Brooklyn, wo er seine erste Streife gegangen war, was er, wenn man ihn nach seinen Wünschen gefragt hätte, immer noch tun würde.
»Könnten mal die nächste Abbiegung links probieren«, schlug er Cook vor, welcher erwiderte: »Sie sind der Boss«, und es probierte. Er musste auf den Randstein hinauffahren, um den Leichenwagen vorbeizulassen. Der Fahrer wies mit dem Daumen über die Schulter, um die Richtung zu weisen. Hinter einem Vorsprung war die enge Straße mit Polizeiwagen verstopft. Der Spezialwagen des Morddezernats, ein Labor auf Rädern sozusagen, musste auf dem Bürgersteig parken. Cook zwängte den Dienstwagen knapp dahinter.
Das baufällige Haus, vor dem sich die Wagen zusammendrängten, neigte sich nach Shapiros Schätzung beträchtlich zur Westseite. Aber die drei steilen Treppen, die sie nun hinaufkletterten, zeigten ein deutliches Gefälle nach Osten. Außerdem knarrten sie zum Erbarmen. Zwei von den Türen, an denen er vorbeikam, trugen Schilder, die eine im Erdgeschoss Imperial Nobelties, Inc., Perma-Snaps die im ersten Stockwerk. Das zweite Stockwerk des Gebäudes - eines Gebäudes, das, wie Lieutenant Shapiro missmutig dachte, schon vor zwanzig Jahren abgebrochen gehört hätte - war unbewohnt.
Die Tür der Wohnung im dritten Stock stand zur Hälfte offen. Ein Stück Papier war mit Reißzwecken befestigt, und auf dem Papier stand in schwarzen Druckbuchstaben, leicht ansteigend, ein einziges Wort: Shack. Wenigstens sah das Wort ungefähr wie Shack aus. Ungelenk gemalt von einem Kind, nahm Shapiro an. Von einem etwas zurückgebliebenen Kind, vermutlich. Er stieß die Tür weiter auf.
Vor ihm lag ein riesiger Raum, der das ganze Stockwerk einnahm. Ein schräges Atelierfenster bildete fast die Hälfte der Zimmerdecke. Nordlicht - natürlich. Es war unerwartet kühl hier. Wegen der Nordseite? Nein. Der Raum hatte eine Klimaanlage. Shapiro fiel die höllische Rechnung ein, die man ihm damals, als er in einem einzigen Zimmer seines Brooklyner Apartments eine Klimaanlage einbauen ließ, präsentiert hatte. Was es gekostet haben musste, diesen Saal - 15 m breit und 30 m lang, grob geschätzt - mit einer wirksamen Klimaanlage zu versehen, entzog sich seiner ohnehin nicht stark entwickelten Vorstellungskraft. Jedenfalls mehr, als das ganze schäbige Haus wert war, dachte er. In der ungefähren Mitte hielt ein einzelner Holzbalken die Zimmerdecke. Hoffentlich, dachte Shapiro. Der Stützbalken war schief wie alles andere.
Eine Anzahl von Männern bewegte sich geschäftig in dem Raum hin und her. Einer zeichnete mit sicheren, flinken Strichen den Plan des Zimmers in einen Skizzenblock. Zwei andere verteilten auf Holzstühlen und Holztischen im hinteren Teil des Raumes Puder zum Abnehmen von Fingerabdrücken. Sie ließen auch die Simse der Fenster am entfernten Ende nicht aus. Die Beamten des Polizeilabors erledigten ihre Pflichten, ob nun dabei etwas herauskam oder nicht. Lieutenant Jacobs von der Kriminalabteilung der Bezirksstation stand unter dem schrägen Atelierfenster und schaute nachdenklich auf den Fußboden.
Shapiro ging zu ihm. Jacobs hob den Kopf und übertrug nun seinen nachdenklichen Blick auf den langen, mageren Mann mit dem langen, traurigen Gesicht und den traurigen braunen Augen. »Sie haben es also aufgehalst bekommen, was, Nate?«, bemerkte er, und Shapiro sagte, mit einer Stimme so traurig wie sein Gesicht, dass es so aussähe. Er blickte sich wieder in dem Raum um und seufzte, schaute auf den Fußboden hinunter und auf den Kreideumriss. Da war eine Menge Blut innerhalb dieses Kreideumrisses und auch außerhalb der Linie. Das Blut war in die rissigen Bodenbretter eingesickert und dort geronnen.
»Hinter dem rechten Ohr«, sagte Jacobs. »Revolver auf dem Boden, dort, wo er gewesen sein könnte. Ein .32er.«
»Hinter dem rechten Ohr?«
»Ah, Sie und Doktor Simpson«, machte Jacobs. »Er könnte es durchaus fertiggebracht haben. Drückte mit dem Daumen auf den Abzug. Kommt vor. Sie wissen das selbst, Nate.«
»Kontakt?«
»Wirklich! Sie und der Doc! Schön, er wollte den Lauf nicht auf seinem Kopf fühlen. Selbstmörder machen die merkwürdigsten Sachen.«
»Der Revolver?«
»In Ordnung. Schmierflecken. Was wir bei Handwaffen immer kriegen. Die Ballistik-Leute haben ihn mitgenommen. Sie kommen reichlich spät, Nate.«
Shapiro nickte und sah sich wieder in dem Raum um. Dieser war vollgestopft mit ungerahmten Leinwandrechtecken. Sie standen aufs Geratewohl gegen die Wände geschichtet, lagen auf Bänken und Gestellen, lehnten auf mehreren im Raum verteilten Staffeleien. Auf der dem Kreideumriss auf dem Fußboden am nächsten stehenden Staffelei, dort, wo ein Mann gestürzt und gestorben war, war ein Bogen Zeichenpapier mit Reißzwecken befestigt, auf dem sich schwarze Striche befanden. Undeutlich und farbig schienen sie sich zu der Skizze einer Frauengestalt zusammenzufügen. Einer sehr abstrakten Frauengestalt. Vielleicht sollte es auch gar keine Frau darstellen. Shapiro schüttelte hoffnungslos seinen Kopf. Es hatte wirklich keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Was er hier sah, lag weit jenseits seines Fassungsvermögens, und so würde es auch bleiben.
Er versuchte ohne besonderen Erfolg die Bilder in seinem Blickfeld nicht anzusehen. Je länger er sich mit ihnen befasste, desto verwirrter wurde er. Er hätte nie gedacht, dass so viele Farbschattierungen existierten, oder dass man sie auf eine so verrückte Weise über eine Leinwand verteilen konnte.
»Sollen Gemälde sein«, unterbrach Jacobs seine stummen Betrachtungen. »Können Sie was damit anfangen, Nate?«
»Nein.«
»Die Schule, in die mein Junge geht, hat ein Unterrichtsfach, das sie dort Kunsterziehung oder so nennen«, fuhr Jacobs fort. »Geben den Kindern Farbe und Papier und sagen ihnen, sie sollen was damit anfangen. Jetzt passen Sie auf, Nate. Mein Kleiner ist erst sechs. Sie ließen ihn eines seiner Bilder mit nach Hause bringen, und man konnte auf der Stelle erkennen, dass er eine Kuh gemalt hatte. Gott allein weiß, wo er jemals eine Kuh gesehen hat, aber man konnte sofort sehen, es war eine Kuh.«
»Im Central-Park-Zoo«, sagte Shapiro. »Dort haben sie eine Kuh.«
Er schaute wieder auf die Staffelei, vor der, aller Wahrscheinlichkeit nach, Shackleford Jones gestanden hatte, als er beschloss, sich zu erschießen. Je länger er hinschaute, umso mehr glaubte Nathan Shapiro zu begreifen, was Jones zu seinem unabänderlichen Entschluss getrieben hatte. Mein Gott, hatte Jones sicher gedacht, das habe ich gemacht! Und ging und holte sich einen Revolver.
»Sein Revolver?«, fragte Shapiro.
Die Nachforschungen in dieser Richtung waren noch nicht abgeschlossen. Jones hatte einen Waffenschein besessen, so dass man in den Akten die Seriennummer feststellen und mit der des Revolvers, den man auf dem Boden neben der Leiche gefunden hatte, vergleichen konnte. Und der Pathologe würde die Kugel aus dem Gehirn des Malers holen und, wenn sie von dem Knochen, den sie zerschmettert hatte, nicht gar zu verbeult war, guckten sie sich die Männer von der Ballistik unter einem Vergleichsmikroskop an. Aber, hundert zu eins, hatte Shackleford Jones seinen eigenen Revolver dazu benutzt, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen. Tausend zu eins, wenn es nach Lieutenant Myron Jacobs’ Berechnung ging.
»Einige von diesen jungen Ärzten...«, fing Jacobs wieder an.
Shapiro ging nicht darauf ein. Sich eigenhändig in den Hinterkopf zu schießen war zumindest eine verdammt umständliche Methode. Einen Revolver in einiger Distanz vom Kopf zu halten, hieß das Risiko eines Fehlschlages einzugehen. Andererseits durfte man bei einem Menschen, der auf diese Weise Farbe auf Leinwand verteilte, schönes Zeichenpapier mit solchen Skizzen verdarb, beinahe jeden möglichen Schwachsinn erwarten.
»Wir sind demnächst fertig«, bemerkte Jacobs mit einem Blick auf zwei von seinen Leuten, die das Atelier der Länge nach durchquerten. »In dieser verdammten Bude hat offenbar noch nie jemand abgestaubt«, sagte der eine im Vorbeigehen. »Wo man hinschaut sind Fingerabdrücke.«
»Das macht doch Spaß«, entgegnete Jacobs und drehte sich nach Shapiro um. »Und Ihnen auch, wenn Sie die Sache erst mal in die Finger bekommen«, fügte er hinzu. »Ihnen und Ihrem Sergeant. Der ist neu im Morddezernat, stimmt’s?«
»Sie meinen Cook. Wurde von Bronx hierher versetzt. Hat den Burnside-Mord aufgeklärt. Mehr oder weniger allein, glaube ich. Ja, wir wollen uns hier noch ein bisschen umsehen. Obwohl ich mir nicht denken kann, dass dabei etwas herauskommt. Hat er hier gewohnt?«
Shackleford Jones war nicht berechtigt gewesen, im Atelier zu wohnen; zumindest besagten das die gesetzlichen Bestimmungen.
Seit mehreren Jahren protestierten Maler einzeln und in Gruppen gegen diese Zwangsmaßnahme. Außerdem hatten sie eine Reihe von Möglichkeiten ausgeknobelt, wie man diese Bestimmungen umgehen konnte.
»Damit ist es nichts«, winkte Jacobs ab. »Dort hinter dem Gerümpel steht zwar ein Feldbett, aber nichts beweist, dass Jones es benutzte. Nach dem, was diese Kunsthändlerin von ihm sagt, hat er drüben in der East Eighth Street eine Wohnung. Wir haben das schon nachgeprüft.«
Nathan Shapiro prägte seinem Gedächtnis die Adresse ein. Da hatte er jedenfalls etwas, womit er anfangen konnte. Es war verdammt lästig, erst vier Stunden nachher aufzukreuzen, wenn sich bereits Gott und die Welt mit dem Fall befasst hatten. Von einem Beamten des Morddezernats erwartete nun natürlich jeder, er würde alles das herausfinden, was die anderen übersahen. Solch hochgespannte Erwartungen waren, zumindest nach Shapiros Meinung über sich selbst, höchst ungerechtfertigt. Bloß, weil ein Kerl ein oder zweimal Glück hatte und mit einem Revolver anständig umzugehen verstand – so viel gestand sich Shapiro zu -, kamen die Leute auf wer weiß was für überspannte Ideen.
»Ich werde mal eine Weile in der Sache herumstochern«, sagte Shapiro zu Lieutenant Jacobs. »Wie kam er zu dem Waffenschein?«
Jacobs hatte keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte Jones zu irgendjemandem eine Verbindung gehabt. Könnte auch sein, dass es ihm gelungen war, diesem Jemand einzureden, das Zeug hier in seinem Atelier sei wertvoll. Jacobs sah sich um. »Himmel!«, brummte er. »Soweit ich sehen kann, gibt’s hier nichts mehr zu tun. Sie sperren ab, wenn Sie fertig sind, nicht wahr? Ist ein Schnappschloss.«
Shapiro dachte missmutig, dass ohnehin schon alles, worauf es ankam, von Leuten erledigt wurde, die weitaus fähiger als er selbst waren. Laut sagte er: »Mach’ ich, Jake. Wir brauchen nicht lange.«
Er schlenderte die eine Seite des langen Raumes entlang und sah sich die Bilder an, und Sergeant Anthony Cook tat dasselbe auf der anderen Seite.
Ein Gemälde, das auf einer Staffelei stand, zeigte in grellen, starken Farben ein Durcheinander von Formen. Soweit Shapiro sehen konnte, hatten die Formen keinerlei Zusammenhang, keinerlei Bedeutung. Trotzdem stand er mehrere Minuten lang vor der Staffelei, weil das Ding ihn irgendwie herausforderte - geradezu aufreizte.
In der unteren rechten Ecke der großen Leinwand stand das Wort Shack. Die Buchstaben waren so ungelenk und primitiv wie die auf dem Zettel an der Tür. Die Signatur des Malers vermutlich. Sollte die Tatsache, dass er das Ding signiert hatte, bedeuten, dass er es für fertig hielt? Shapiro schüttelte schon wieder den Kopf, seufzte und wandte sich ab, um sich das oberste von einem Stapel, der an der Wand lehnte, anzusehen.
Wieder ein Durcheinander von Formen und Farben; aber diesmal riefen sie in ihm immerhin eine vage Vorstellung wach. Er wusste nicht, wieso und warum es ihn an einen Autofriedhof erinnerte; aber das war es, was er dabei fühlte - beileibe nicht sah. Er kippte es ein wenig nach vorne und sah sich seine Rückseite an. Es war gerahmt. Auf der Rückseite des Rahmens war ein mit Schreibmaschine getipptes Schild befestigt. 37. Stillleben. Und nach dem Wort Stillleben folgten Zahlen. 4500. Der Preis? Nun, wenn dem so war, hatte man sicher versehentlich eine Null zu viel angehängt und das Komma vergessen. Das Gemälde sollte wohl eine Blumenvase darstellen. Andererseits würde die Vase, wenn es sich um eine solche handelte, auf eine unmögliche Weise schief dastehen. Und das Ding neben ihr - das konnte doch wohl kein Ei sein? Eine Blumenvase, die ein Ei gelegt hatte? Ein grünes Ei mit weißen Tupfen drauf?
Shapiro sah ein, dass es keinen Sinn hatte, damit weiterzumachen. Es wurde immer mehr klar, dass die Leute von der Bezirkspolizeistation mit ihrer Annahme richtig lagen: Ein Mann namens Shackleford Jones, der sich der Hoffnung hingab, ein Maler zu sein und genug Geld besaß, sich Leinwand und Farbe zu kaufen, hatte sich auf dem Dachboden, den er sein Atelier nannte, umgesehen und erkannt, was aus seinen Hoffnungen geworden war und sich, verständlicherweise, in den Hinterkopf geschossen.
Shapiro stand still da und ließ seinen Blick in die Runde schweifen. Einen Moment lang war ihm, als würde der riesige Raum mit Farben und Formen tönen, als könnte er beinahe verstehen, was er sagte.
Wenn die Bilder in diesem Raum sprachen, wenn sie das Geschrei ihrer eigenen Farben zu übertönen versuchten, wenn sie versuchten, sich verständlich zu machen, dann redeten sie jetzt nur mit Lieutenant Shapiro und Sergeant Cook, denn der Rest der anderen Polizeibeamten war fortgegangen, um sich einer sinnvolleren Tätigkeit zuzuwenden. Es war höchste Zeit, fand Shapiro, dass er und Cook ihrem Beispiel folgten.
Cook stand in der entferntesten Ecke des Ateliers, in der Nähe der schmalen Fenster. In einem von ihnen war die Klimaanlage installiert; durch das andere konnte man eine Feuerleiter sehen. Cook wurde halb von einer Staffelei verdeckt. Er hielt ein Stück Papier vor sich hin und sah es an. Als er bemerkte, dass Shapiro ihn beobachtete, winkte er ihn mit seiner freien Hand heran. Shapiro ging zu ihm hin und beguckte sich, was Cook ihm entgegenhielt.
Was er sah, überraschte ihn. Es war eine Skizze, die diesmal ohne Zweifel eine Frau darstellte - eine nackte Frau. Keine Frau kann jemals genauso ausgesehen haben wie die Frau, die hier mit Kohle auf das weiße Zeichenpapier porträtiert worden war, sagte sich Shapiro. Aber die seltsamen Entstellungen, Verzerrungen in der Zeichnung strahlten eine unheimliche Bedeutung aus.
»Sieht aus, als würde sie fliegen«, meinte Cook. »Tolles Ding, was?« Es war ein tolles Ding. Und es war kaum zu glauben, dass derselbe Mann, der den Autofriedhof gemalt hatte, auch diese Skizze angefertigt hatte. Aber in der unteren rechten Ecke war die Signatur, und sie lautete Shack.
Worauf es hinausging, dachte Shapiro, war, dass der Mann zeichnen konnte; und zwar mit Meisterschaft und Phantasie zeichnen konnte, so dass die Skizze mehr ausdrückte als die bloße Wirklichkeit. Und Nathan Shapiro, zu seiner absoluten Überraschung, verspürte urplötzlich den Wunsch, diese Skizze mit nach Hause in sein Apartment nach Brooklyn zu nehmen und sie dort an die Wand zu hängen. Rose würde es zwar nicht recht sein, dass die Frau nackt war, aber sie würde, genau wie er, wünschen, sie könnten es behalten.
»Das andere Geschmier versteh’ ich nicht«, sagte Cook.« Ein Haufen verrücktes Zeug, wenn man mich fragt. Aber das da...«
Er verstummte, und beide Männer drehten sich um und schauten zum anderen Ende des Ateliers. Ein Schlüssel knirschte im Schloss, und das Schloss schnappte. Die Tür ging auf, ganz ohne jede Vorsicht. Wer immer da in Shacklefords Atelier hereinkommen würde, hatte bestimmt nicht erwartet, hier jemanden vorzufinden.
Eine Frau trat ein, ganz selbstverständlich, ohne sich auch nur umzusehen. Es lag auf der Hand, dass sie die beiden Männer, die mehr oder weniger von der Staffelei verdeckt wurden, überhaupt nicht bemerkte. Sie standen stockstill.
Die Frau war groß und sehr mager. Sie trug eine enge schwarze Hose und einen schwarzen Pullover mit Rollkragen, der fast bis zum Kinn hinauf reichte. Sie war nach Shapiros Schätzung über 180 cm groß und mochte so an die Fünfundzwanzig sein.
Sie ging direkt auf die Staffelei zu, vor der auf den Boden der Kreideumriss gezeichnet war. Der Umriss schien sie in keiner Weise zu überraschen und, wenn sie das Blut dort auf den Bodenbrettern bemerkte, dann schien es ihr jedenfalls nicht der Beachtung wert zu sein.
Der Bogen Zeichenpapier mit jener Skizze, die eine in die Länge gezerrte Frau darstellen mochte, war auf einem Brett, das in den Rahmen der Staffelei eingepasst war, befestigt. Die große, schwarzgekleidete Frau begann methodisch die Reißzwecken im Holz zu lockern.
Dann kam Bewegung in Shapiro. Seine Schuhe machten einen Höllenlärm auf dem groben, unebenen Bretterboden. Die Frau fuhr herum, in der rechten Hand eine Reißzwecke. »Suchen Sie etwas, Miss?«, fragte Shapiro. Sie machte eine schnelle Bewegung, als wollte sie zurück zur Tür gehen, blieb aber stehen und blickte den Männern entgegen, die auf sie zukamen.
»Es gehört mir, Mister«, erklärte sie. »Er sagte, dass ich es bekomme. Denn das bin ich.«
Die Zeichnung kippte vom Staffeleibrett herunter. Im Moment wurde Shapiro klar, weshalb ihm an der jungen Frau, als sie mit ihren langen Beinen ins Atelier hereinspaziert war, etwas bekannt vorgekommen war: Sie hatte für diese Skizze Modell gestanden. Und nun war sie gekommen, um diese zu beseitigen.
»Wer sind Sie überhaupt?«, wollte sie wissen. Ihre Stimme war unerwartet dunkel.
»Polizei. Sie standen Modell für diese Zeichnung, Miss?«
»Natürlich. Das bin ich. Und Shack sagte...« Sie sagte nicht, was Shack gesagt hatte. »Er schuldet mir noch mein Honorar dafür. Also gehört sie mir, oder etwa nicht?« fügt sie hastig hinzu.
Das war nun ganz und gar unbegreiflich, fand Shapiro. Was hatte das Geld, das ihr der Maler offenbar schuldete, mit der Skizze zu tun? Verrückt. Es wäre absolut vernünftig gewesen, wenn sie den Wunsch verspürte, die Skizze zu vernichten, dafür zu sorgen, dass sie niemand zu sehen bekam. Shapiro gab sich Mühe, sich seine Verwirrung nicht anmerken zu lassen.
»Nein«, sagte er. »Ich weiß noch nicht, wem sie am Ende gehören wird, nun, da Mr. Jones tot ist. Sie wussten, dass er tot ist, als Sie hereinkamen, nicht wahr?«
»Selbstverständlich. Jeder weiß es. Es kam im Radio.«
Na, so etwas! Wenn das wahr war, dann verstand er überhaupt nichts mehr, dachte Shapiro. Warum sollte ein Sender dem Selbstmord eines verrückten Malers in Greenwich Village die geringste Wichtigkeit beimessen? Das Mädchen log vermutlich. Vielleicht hatte sie auf anderen Wegen erfahren, dass der Mann, der sich Shack nannte, tot war. Was für ihn - Shapiro - interessant sein könnte...
Ihr Name war Rachel Farmer, falls es die Herren etwas anging. Man klärte sie darüber auf, dass es sie etwas anging. Sie bewohnte ein Apartment in der Gay Street, wenn sie es unbedingt wissen mussten. Sie war ein Berufsmodell. Sie posierte für Künstler. Manchmal auch für Fotografen.
Ihre Antworten kamen schnippisch, als wollte sie Shapiro zu verstehen geben, wie lächerlich sie seine Fragen fand.
Sie ist wachsam, dachte Shapiro und wunderte sich, warum.
Sie wusste nicht, weshalb man ihr diese Fragen stellte und...
Nein, sie wollte sich nicht setzen, weil sie nicht müde war und außerdem eine Verabredung hatte. Und stimmte es etwa nicht, was alle sagten, dass Shack Selbstmord begangen hatte?
»Es sieht so aus, Miss Farmer«, sagte Shapiro. »Wir versuchen uns zu vergewissern, dass es wirklich so war. Aber wie kommt es, dass Sie einen Schlüssel zum Atelier haben, Miss Farmer?«
»Ein Haufen Leute haben einen, Mister«, antwortete sie. »Shack verteilte massenhaft Schlüssel, damit er nicht jedes Mal, wenn jemand kam, zur Tür gehen und die Besucher einlassen musste. Außer, wenn ein Zeichen an der Tür war.«
»Zeichen?«
»Wenn er nicht gestört werden wollte, schrieb er Geh weg auf einen Zettel und befestigte ihn mit einer Reißzwecke draußen an der Tür...«
»Wann waren Sie zuletzt hier, Miss Farmer? Um für ihn Modell zu stehen?«
»Vorgestern.«
Nach dem Bericht des Polizeiarztes war Shackleford Jones zwischen zwanzig und vierundzwanzig Stunden tot gewesen, als Myra Dedek ungefähr um 10.00 Uhr an diesem Donnerstagvormittag das Atelier betreten, die Leiche entdeckt und zu schreien begonnen hatte. Sie musste laut geschrien haben, weil man sie zwei Stockwerk tiefer gehört hatte. Sie musste verzweifelt geschrien haben, weil der Besitzer der Perma-Snaps die Treppe heraufgerannt war. Benjamin Negly, so hieß der Besitzer; und er war es gewesen, der die Polizei benachrichtigt hatte. Der Anruf war um 10.08 Uhr an diesem Vormittag erfolgt.
»Nicht gestern?«, fragte Shapiro Rachel Farmer.
»Vorgestern. Das war - was haben wir heute?«
»Donnerstag.«
»Am Dienstag also. Um drei Uhr Nachmittag. Ich war pünktlich, und ich stand dort...« Sie zeigte mit einer ungenauen Handbewegung dorthin, wo sie gestanden hatte. »Zwei Stunden. Und wenn man sich rührte, solange er arbeitete, brüllte er einen an. Und dann erklärte er, er habe keinen Cent, er würde das nächstemal zahlen. So war das oft.«
»Zahlte er aber?«
»Worauf Sie sich verlassen können. Glauben Sie, ich stehe mir zwei Stunden lang die Beine in den Leib, nur so zum Spaß?«
Sie gibt sich hartgesotten, dachte Shapiro. Härter als sie ist. Aber ich tauge nicht dazu, den Leuten hinter die Schliche zu kommen. Und von Leuten wie dieser jungen Frau - Modelle und Maler und so - weiß ich überhaupt nichts. Lasst mich in Brooklyn wieder meine Streife gehen; dort bin ich am richtigen Platz, davon verstehe ich was.
»Sie kamen zurück, um diese Skizze zu holen, die er vorgestern von Ihnen anfertigte«, sagte er schließlich. »Ich meine, Sie kamen, nachdem Sie gehört hatten, dass er tot ist, um sie an sich zu nehmen. Warum?«
»Sie gehört mir. Er hat mich nicht dafür bezahlt.«
»Ja«, meinte Shapiro, »ich verstehe schon. Was hatten Sie damit vor, Miss Farmer?«
»Was denken Sie, Mister? Oder sind Sie Captain oder was sonst?«
»Lieutenant«, sagte Shapiro, mit einer Spur trauriger Resignation in der Stimme. »Hatten Sie vor, die Zeichnung zu verkaufen? Glaubten Sie, jemand würde sie kaufen?«
Sie sah ihn überrascht an. Die ganze Zeit über hatte sie versucht, den Ausdruck überlegener Gleichgültigkeit beizubehalten. Doch als er ihr diese letzte Frage stellte, verwandelte sich ihre Gleichgültigkeit in eine fast kindliche Überraschung.
»Denken Sie doch mal nach«, sagte sie. Sie war sehr geduldig mit dem Uneingeweihten. »Es ist seine letzte Arbeit, nicht wahr? Und Sie fragen, ob ich glaube, dass sie jemand kaufen würde!« Sie schüttelte den Kopf. »Er pflegte zwei- bis dreihundert für eine Skizze zu bekommen. Wenn er bereit war, sie zu verkaufen. Natürlich verkaufte er nur solche, mit denen er nicht zufrieden war, wenn er Geld brauchte.«
Sie brach ab und schüttelte wieder den Kopf.
»Die anderen? Was tat er mit ihnen?«
»Er behielt sie. Arbeiten, die er wirklich gut fand, ließ er nicht mal jemanden sehen. Myra Dedek schickte immer Leute her, die sich seine Sachen ansehen mussten. Museumsdirektoren und dergleichen. Er zeigte ihnen nur solche Bilder, an denen ihm nicht viel lag. Und Myra platzte fast vor Wut. Man kann es ihr nicht mal übelnehmen. Schließlich ist es der Beruf einer Kunsthändlerin, Bilder zu verkaufen, nicht wahr?«
Unfreiwillig schweiften Shapiros Augen wieder durch den riesigen Raum mit den zahllosen Bildern und kamen zurück zu der jungen Frau.
»Es gab also Leute, die seine Bilder kauften? Für Hunderte von Dollars?«
Er hörte selbst die Ungläubigkeit in seinem Ton, und als sie ihm antwortete, hörte er die gleiche Ungläubigkeit in ihrem.
»Hunderte?«, wiederholte sie. »Haben Sie den Verstand verloren, Mister?« Nathan Shapiro hielt das für durchaus möglich. Die Schwarzhaarige band ihm natürlich einen Bären auf. Eine Menge Leute tun das, ohne speziellen Grund, wenn sie mit Polizeibeamten reden.
»Sie wollen damit andeuten, dass manche Leute mehr als Hunderte bezahlten?«, erkundigte er sich vorsichtig.
»Sie verstehen nicht viel von diesen Dingen, was?«, fragte sie ihn.
Er schüttelte den Kopf. »Wieviel mehr?«
»Hören Sie, ich habe nicht seine Bücher geführt. Fragen Sie Myra Dedek. Sie tat es. Und wie! Halbe-halbe.«
Er begriff nun gar nichts mehr.
»Man sagt, er verlangte enorme Preise«, klärte ihn Rachel Farmer auf. »Stellte verrückte Forderungen. Einmal ließ er ein Gemälde für hunderttausend Dollar versichern, als es zu Myras Galerie befördert wurde. Das war natürlich ein großes Bild gewesen. Ein enormes Ding. Sie mussten es mit einem Drehkran oder so was vom Atelier herausholen. Mit so einem Ding, mit dem man Klaviere transportiert.«
»Ja, ich verstehe schon«, versicherte ihr Shapiro. »Aber, Sie wollen damit sagen, dass es jemanden geben würde...« Er hatte Mühe, ein Zittern in der Stimme zu unterdrücken »...der eventuell hunderttausend Dollar für eines seiner Bilder hinlegen würde?«
»Es war ein großes«, gab das Mädchen zu bedenken. »Das größte, das er jemals malte, denke ich. Natürlich...«
Sie brach ab, und Shapiro wartete.
»Ich nehme an, dass er nicht erwartete, soviel dafür zu bekommen. Wenn er etwas nicht verkaufen wollte, machte er einfach einen irrsinnigen Preis dafür. Andererseits hielt er sich selbst für genauso gut wie Picasso. Oder fast.«
»Haben Sie eine Vorstellung, wieviel er für dieses Gemälde verlangt hätte, wenn sich ein ernsthafter Käufer eingestellt hätte? Für dieses größte seiner Bilder?«
»Die Hälfte der Versicherungssumme? Ich weiß es nicht. Manchmal redete er eine Menge überspanntes Zeug. Viele von ihnen tun das, wissen Sie.«
Shapiro wusste es nicht. Er hielt es aber für wahrscheinlich. An diesem Nachmittag war alles wahrscheinlich.