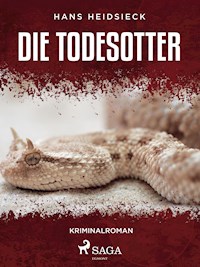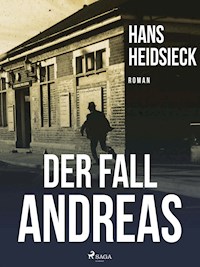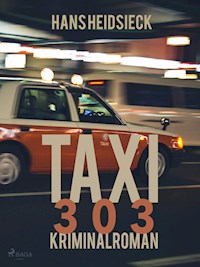Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Försterei bei Arlon mitten in den Ardennen wartet Madame Dupont mit Tochter Susanne ängstlich auf die Rückkehr ihres Mannes. Noch nie war er solange abends im Wald. Doch als sein Hund alleine zurückkommt, ist klar: ihm muss etwas passiert sein. Als der Förster ermordet im Wald gefunden wird, sind die örtlichen Inspektoren mit dem Fall überfordert und lassen den erfahrenen Kommissar Didier aus Brüssel kommen. Doch der tut sich ungewohnt schwer, aus den eigenbrötlerischen Einwohnern etwas herauszubekommen. Jeder scheint Dreck am Stecken zu haben oder etwas zu verschweigen und zu wildern. Soll das das Mordmotiv gewesen sein? Eine erste Spur führt in das Zimmer von Gaston Declerc, Sohn des Wegemeisters, bei dem das Jagdgewehr des Försters gefunden wird. Dann wird Francois Mathieu beschuldigt, der Mörder gewesen zu sein. Aber was hat es mit dem Mantel auf sich, den ein fremder Gast im Wirtshaus dem alten Robinot geschenkt hat? Plötzlich führt eine Spur vom verunglückten Expresszug Brüssel–Paris nach St. Hubert und nach Amerika. Dabei hat der Kommissar das fehlende Mosaiksteinchen in dem kleinen Ort schon längst in den Händen ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Das dritte Gesicht
Kriminalroman
Saga
Das dritte Gesicht
German
© 1955 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508640
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
„Wo bleibt nur der Vater so lange?“ fragte Madame Dupont besorgt, während sie in dem zwar kleinen, aber behaglich eingerichteten Wohnraum des Forsthauses das Geschirr für das Abendessen bereitstellte, „er müßte längst aus dem Walde zurück sein. Sagte er nicht, er wolle um sechs Uhr nach Hause kommen?“
Susanne, ein hübsches Mädchen von untersetzter Statur, blickte verlegen an der Mutter vorbei. „Er wird schon bald kommen“, erwiderte sie, mit diesen Worten zugleich sich selber beschwichtigend. Es war immer die gleiche Sorge, die sofort auftauchte, wenn der Revierförster Philippe Dupont einmal länger blieb, als er angesagt hatte, — zumal er im allgemeinen die Pünklichkeit selber war. Namentlich in der letzten Zeit war die Sorge groß, da man gehört hatte, daß ein verwegener Wilddieb in den Wäldern um St. Hubert sein Unwesen trieb.
Unlängst erst hatte der Förster bei einem Kontrollgang in der Ferne Schüsse vernommen, war dem Schall sofort nachgegangen, hatte bald auch die Schweißspur eines Hirsches entdeckt und stand endlich vor dem gerade verendeten Wild, das von seinem treuen Begleiter, dem braven Hund Lux, laut verbellt wurde. Von dem Jagdfrevler aber war keine Spur mehr zu entdecken.
Daß drei Tage später dem Förster selbst zwei Kugeln scharf um die Ohren pfiffen, als man aus einem Hinterhalt auf ihn schoß, hatte er zu Hause gar nicht erzählt. Er wußte nur zu genau, wie sehr seine Frau und seine Tochter sich darüber aufgeregt haben würden. Hätte er damals nicht blitzschell hinter einem dicken Eichenstamm Deckung genommen, würde ihn eine dritte Kugel durchlöchert haben. Er hatte zwar seine Drillingsbüchse in Anschlag gebracht, — doch er suchte vergeblich nach einem Ziel. Lange stand er, spähte, lauschte und wartete. Den Hund hielt er bei sich zurück, da zu befürchten war, daß Lux, wenn er ihm freien Lauf ließ, kurzerhand niedergeknallt werden würde.
Endlich, nach langem Warten, nahm das feine Gehör des Försters ein fernes Knacken von Zweigen wahr. Gleich darauf sah er im Dämmerlicht einen Schatten in raschen Sprüngen zwischen den Stämmen davonhuschen.
Dupont jagte zwei Schüsse hinter der flüchtenden Gestalt her, suchte ihr auch eine Weile zu folgen, — doch der andere war auf einmal wie vom Boden verschluckt und spurlos verschwunden.
Da er keine Furcht kannte, war Dupont heute auch wieder in den Wald gegangen, um dort im Jagen 23 einige Stämme anzuzeichnen, die später zu schlagen waren. — —
Ein kalter Novemberwind peitschte den Regen gegen das Forsthaus, während drinnen im Ofen das Holzfeuer prasselte und gegenüber dem Toben draußen eine behagliche Atmosphäre schuf. Aber Mutter und Tochter war es durchaus nicht behaglich zumute. Ihre Besorgnis wuchs mit jeder Sekunde. Es war, als zitterten die Worte Susannes noch durch den Raum: ‚Er wird schon bald kommen!‘ — Worte, an die sich die beiden unbewußt während der nächsten Viertelstunde noch immer klammerten, bis die Mutter verzweifelt seufzte: „Mein Gott! Mein Gott!“ Sie war eine schlanke knochige Frau mit vergrämten Zügen. Um ihren aufgeworfenen Mund, dessen Winkel scharf nach unten gezogen waren, lagen unzählige Falten. Sie sah dadurch älter aus, als sie in Wirklichkeit war. Gegen das frische Gesicht ihrer Tochter stach sie nicht gerade angenehm ab. Doch nicht nur äußerlich, — auch dem Wesen nach stand sie in einem Gegensatz zu Susanne. Während diese den Dingen mit jugendlichem Optimismus entgegensah, erblickte die Mutter in allem vorwiegend das Ungünstige und schenkte den unerfreulichen Ereignissen mehr Beachtung, als den angenehmen. Sie suchte und fand auch bei jeder Sache, wie man zu sagen pflegt, ein Haar in der Suppe, so daß sie fast immer ‚verdrießlich‘ war.
Susanne ist schweigend ans Fenster getreten. Sie blickte durch ein herzförmiges Loch in der Lade und sah einen Augenblick dem nächtlichen Treiben der Elemente zu. Wäre der Vater pünktlich nach Hause gekommen — so überlegte sie — würde er dem erst seit einer halben Stunde niederströmenden Regen entgangen sein. Sollte er irgendwo Unterschlupf gefunden haben? Das war kaum anzunehmen. Dem abgehärteten Mann machten Wind und Wetter schon lange gar nichts mehr aus. Und wo überhaupt sollte er in der ausgedehnten Waldung Unterschlupf finden?
Frau Dupont hatte das Zimmer verlassen und hantierte jetzt in der Küche. Sie stieß einen verzweifelten Seufzer nach dem anderen aus und flehte im stillen den Himmel an, ihren Mann zu beschützen. Mechanisch stellte sie einen Topf auf den Herd. Dann wischte sie in nervöser Hast an einem Deckel herum, obwohl da gar nichts zu wischen war. Schließlich wurde sie sich nicht mehr recht bewußt, was sie tat. Ihre Unruhe war nicht mehr zu bändigen. Verzweifelt kreisten ihre Gedanken um ihren Mann; düstere Ahnungen lösten in ihrer Brust einen stechenden Schmerz aus. Wenn Philippe nicht in der nächsten Minute kam — —
Immer wieder verhielt sie einen Augenblick lauschend, ob sie draußen nicht seine Schritte hörte. Aber da waren nur der sausende Wind und der niederprasselnde Regen.
Sie zuckte zusammen. Das Telefon hatte angeschlagen. Gleichzeitig mit ihrer Tochter Susanne stürzte sie in das Arbeitszimmer des Försters, wo der Apparat auf dem Tisch stand. Mit einer hastigen Geste nahm sie der Tochter den Hörer ab, den diese schon von der Gabel gehoben hatte.
„Hallo! Frau Dupont!“ rief die Stimme des Oberförsters, „kann ich ihren Mann sprechen?“
„Tut mir leid“, erwiderte Frau Alice mit bebender Stimme, „er ist noch im Wald.“
„Wie, bitte? Jetzt in der Dunkelkeit und bei dem Hundewetter?“ fragte der Oberförster verwundert.
„Ach ja — mein Gott — — ich mache mir ja auch schon die schwersten Gedanken, Herr Oberförster. Um sechs Uhr hat er spätestens wieder zu Hause sein wollen. Nun ist es schon viertel nach sieben. Ich bin ganz verzweifelt.“
Es dauerte einen Augenblick, bis der Oberförster erwiderte, daß man doch nicht gleich zu verzweifeln brauche. Er konnte der Frau ja nicht sagen, wie sehr er bei ihren Worten selber erschrokken war. Ihm hatte Dupont den unheimlichen Vorfall im Walde erzählt. Und nun — alle Wetter ja —!
„Hören Sie, Frau Dupont“, sagte er, wieder nach einer kurzen Pause, „sollte ihr Mann in einer Stunde noch nicht zurück sein, dann rufen Sie mich bitte an!“
Die Förstersfrau nickte nur mit dem Kopf, als ob das der andere sehen könnte, legte den Hörer in die Gabel zurück und sank weinend auf einen Stuhl.
Eine Viertelstunde verstrich — und noch eine weitere. Frau Dupont saß noch immer auf dem Stuhl, auf den sie niedergesunken war. Neben ihr stand Susanne und sprach ihr tröstende Worte zu, obwohl sie selber vor Angst und Sorge um ihren Vater bebte.
Draußen rüttelte weiter der Wind an den Fensterläden. Der Regen ließ langsam nach.
Was war das? Schlug da nicht eben ein Hund an? Horch! Das konnte nur Lux sein. Die beiden Frauen atmeten auf. Also kam doch der Vater endlich!
Susanne hastete aus dem Zimmer, durcheilte den kleinen Flur und riß die Haustür auf.
„Was, Lux — du allein? Und der Vater?“ kam es von ihren bebenden Lippen, als sie erkannte, daß der Förster nicht da war.
Lux bellte laut, lief hin und her, stieß das Mädchen mit seiner Schnauze an, winselte, — rannte zum Gartentor und wieder zurück, immer wieder hin und zurück. Dann stieß er ein lautes Gebell aus, — und wieder begann er zur Gartenpforte zu rennen.
Eine furchtbare Ahnung durchzuckte Susanne.
Da stand auch die Mutter schon in der Tür. Der Wind zerrte an ihren Haaren, zauste an ihrem Kleid. Alles flatterte an den beiden Frauen.
„Mädel, was ist denn los?“ rief Frau Alice, „mein Gott — was ist geschehen? Der Hund — —?“
„Ja, Mutter — ich weiß nicht — — er läuft immer hin und her, offenbar will er uns zu verstehen geben, daß wir ihm folgen sollen.“
Frau Dupont stürzte ins Haus zurück. „Komm, komm, Susanne!“ rief sie verzweifelt, „zieh deinen Mantel an. Wir müssen ihm folgen. Dem Vater wird etwas passiert sein!“
Eine Minute später hasteten beide dem Hunde nach, der ihnen durch die Gartenpforte voraus über die an dem Hause vorbeiführende Landstraße hinweg in den Wald sprang. Hier war es stockfinster.
Susanne hielt ihre Mutter zurück. „Aber das geht doch nicht!“ sagte sie, „wir brechen uns alle Knochen. Ich werde Herrn Meunier rufen. René kann vielleicht auch gleich mitkommen. Außerdem ist es besser, wenn du zu Hause bleibst, falls der Vater kommt. Was soll er denken, wenn niemand da ist!“
Lux sprang kläffend an den beiden Frauen empor, als wäre er ungeduldig, weil sie ihm nicht weiter folgten.
Meuniers waren die Gastwirtsleute, die das größere Haus nebenan bewohnten und hier auch eine Tankstelle betrieben. Beide Häuser lagen hier vollkommen vereinsamt im Walde, nur durch den Schienenstrang einer Kleinbahn und das Straßenband mit der weiteren Welt verbunden. Mit René, dem ältesten Sohn der Gastwirtsleute, war Susanne verlobt.
Nun stürzte das Mädchen in wilder Hast auf das Haus zu, nachdem es die Mutter beschworen hatte, zu warten. Bald darauf kehrte sie mit den beiden Männern zurück. Der alte Meunier trug eine brennende Sturmlaterne. Er legte Frau Dupont seine schwere Hand auf die Schulter und sagte gebietend: „Sie bleiben hier! Was soll ihr Mann sagen, wenn er nach Hause kommt, und das Nest ist leer?“
Die Frau schaute ihn verwirrt an. In ihrem Blick las man Furcht und Entsetzen. „Aber er ist doch — — mein Gott! Oh, mein armer Mann! Sehen Sie doch wie der Hund — —“ sie brach ab, barg das Gesicht in den Händen und wankte dem Hause zu.
Die anderen drangen, dem Hunde folgend, in den Wald ein.
Frau Alice hatte kaum wieder das Haus betreten, als das Telefon abermals klingelte. „Nun, Frau Dupont“, fragte der Oberförster, „ist Ihr Mann inzwischen nach Hause gekommen?“
Mit überstürzenden Worten berichtete die Förstersfrau, was sich inzwischen ereignet hatte. Wie der Hund plötzlich, Klagelaute ausstoßend, vor der Haustür aufgetaucht sei, und daß man im Walde nach dem Förster suche.
„Donnerwetter ja!“ entfuhr es dem Oberförster, das ist allerdings — — hören Sie, Frau Dupont, ich werde mit meinem Wagen zu Ihnen kommen. Aber natürlich brauchen Sie nicht gleich zu verzagen. Vielleicht hat sich Ihr Gatte nur einen Fuß verstaucht und kann nicht mehr laufen. Also ich komme. In einer halben Stunde werde ich bei Ihnen sein.“
Frau Alice taumelte nach diesem Gespräch in die Stube zurück. ‚Nur einen Fuß verstaucht‘ — murmelte sie vor sich hin, ‚nein, es ist schlimmer, viel schlimmer; ich fühle es, ich ahne es!‘
Ein lautes Meckern riß sie aus ihren trüben Gedanken. Das mußte Hexchen, die Ziege sein, die ihr Futter verlangte. Ach ja — die Tiere! Sie mußten gefüttert werden. An die hatte sie schon überhaupt nicht mehr gedacht. Während sie sich mit einem Schürzenzipfel die Augen wischte, eilte sie in den neben der Küche liegenden Stall, wo ihr Hexchen aus grellen Augen meckernd und klagend entgegenblickte, — vorwurfsvoll, weil sie auf einmal so vernachlässigt wurde. Auch die kleine Juliette neben ihr in der anderen Box trampelte unruhig auf ihrem Stroh hin und her. Was wußten die guten Tiere auch von den kleinen und großen Sorgen des menschlichen Lebens! Hier hatte alles seinen gewohnten Gang zu gehen, ihr instinkthaftes Dasein kannte nur Fressen, Verdauen und die allen Lebewesen eigene Sorge um ihre Nachkommenschaft. Mochte ein Mensch irgendwo einsam im nächtlichen Wald verbluten, — wer fragte schon danach? Das Leben ging unerbittlich seinen Gang weiter und forderte schließlich von allen den gleichen Tribut, den Tod . . .
Auch die Schweine im Nebenstall erinnerten Frau Alice an Ihre Pflicht. Mechanisch schüttete sie den Ziegen das Grünfutter zu, holte einen Trog mit gekochten Kartoffelschalen aus der Küche herbei und schüttete sie in den Schweinekoben. Dabei stolperte sie und schlug lang hin. Aber das merkte sie kaum. Jedenfalls war sie sich ihres Tuns nicht bewußt. Sie handelte wie in Betäubung, als sei ihr Geist plötzlich ausgeschaltet. Mit einem dumpfen Laut richtete sie sich wieder auf und kehrte zu ihren Hantierungen in der Küche zurück, immer wieder von Zeit zu Zeit lauschend, ob draußen nicht Schritte nahten oder die Hupe des Autos vom Oberförster zu hören war.
Plötzlich wurde sie wieder von Furcht und Grauen gepackt. Ihr Geist beschäftigte sich erneut mit den Geschehnissen der letzten Stunden. Sie stieß einen Schrei aus.
Endlich erscholl eine Hupe. Man hörte draußen den Wagen bremsen. Der Oberförster! Er hatte die sechzig Kilometer von Arlon hierher tatsächlich in einer halben Stunde zurückgelegt. Ein gütiger, aufrechter Mann, der Dupont sehr gewogen war. Nun stand er da in seiner stämmigen Breite und blickte die ratlose Frau selber recht ratlos an.
Kurz nach ihm traf auf seinem Motorrad auch noch der Gendarm von St. Hubert ein, den der Oberförster für alle Fälle telefonisch herbeizitiert hatte. Beide Männer sprachen beruhigend auf die verzweifelte Förstersfrau ein, — nicht bedenkend, daß ihre Gegenwart gerade eine gegenteilige Wirkung auslösen mußte.
Inzwischen streiften die Suchenden weiter durch den nächtlichen Ardennenwald. Es war ein mühsames Vordringen, teilweise ohne Weg und Steg, steile Hänge hinauf und hinunter, von einem Plateau auf das andere. An der Spitze marschierte Herrr Meunier senior mit der Sturmlaterne, deren Licht rings die Stämme streifte und immer nur ein kurz begrenztes Stück des Weges aus dem Dunkel riß. Er folgte dem vorauseilenden Lux, dessen Standort man oft nur nach seinem Gebell, das nicht abriß, festellen konnte. Dem Alten folgte sein Sohn René, der Susanne fest bei der Hand hielt und nach sich zog. Alle schwiegen. Sie waren mit ihren eigenen besorgten Gedanken beschäftigt. Nur einmal sagte René zu Susanne, es wäre wohl besser gewesen, sie hätte sich ihnen nicht angeschlossen. Sie hatte dazu nur energisch den Kopf geschüttelt und keine Antwort gegeben.
Immer noch fuhr der heftige Wind durch die Kronen der Bäume, deren Äste krachend zusammenschlugen. Es brauste, rauschte und zischte rings. Oft hörte man auch einen pfeifenden Ton.
Als sie fast eine Stunde gewandert waren, blieb der Hund plötzlich stehen und stieß dermaßen klagende Laute aus, daß sie den ihm folgenden Menschen durch Mark und Bein gingen. Der alte Meunier war als erster zur Stelle. Er zuckte heftig zusammen, als er vor sich eine regungslose Gestalt liegen sah. Zaghaft nur leuchtete er ihr ins Gesicht. Es war der Förster! Aus einer kleinen Wunde an seiner Stirn war Blut gesickert und schon verharscht. Er war tot.
Susanne stieß einen markerschütternden Schrei aus und warf sich über die Leiche des Vaters. Die Männer standen einen Augenblick ratlos daneben. Dann hob der Alte das Mädchen mit kräftiger Hand empor, und René schloß sie in seine Arme, mit unbeholfenen Worten ihr Trost zusprechend.
Der Alte beugte sich nieder und untersuchte den Toten genau. Nein — da war nichts mehr zu retten. Er richtete sich wieder auf und sagte, sich an seinen Sohn wendend: „Merke dir die Lage genau, René! Wir können ihn hier nicht lassen, sonst machen sich noch Tiere über ihn her. Spuren können wir auch nicht verfolgen, jetzt in der Nacht. Außerdem ist es ja auch nicht unsere Sache. Aber wir müssen die Stelle genau markieren.“
Er riß einige Blätter aus seinem Notizbuch und heftete sie an die nächsten Bäume, — so daß der Platz davon eingekreist war. Für den Fall, daß die Blätter davongeweht oder sonst auf irgendeine Weise entfernt würden, kerbte er mit dem Taschenmesser auch noch verschiedene Stämme ein.
Dann hoben die beiden Männer den Leichnam auf und trugen ihn unter großer Mühe den Weg zurück, den sie gekommen waren. Susanne schritt wie betäubt mit der Laterne voran. Sie schluchzte immer wieder laut auf. Lux wich nicht von der Seite seines geliebten, jetzt toten Herrn.
Es war bereits kurz nach zehn, als die traurige Karawane beim Forsthaus ankam.
Als Frau Alice begriff, was geschehen war, brach sie lautlos zusammen.
Der Mord an dem Förster erregte im ganzen Departement ein gewaltiges Aufsehen, — hatte sich doch ein solcher Fall seit über sechs Jahren nicht mehr ereignet. Außerdem war Dupont sehr beliebt gewesen. Der stille, ruhige, stets gütige und freundliche Mann hatte sich zahllose Herzen erobert. Wo er irgend jemandem helfen konnte, da hatte er das immer gerne getan, ohne auf Dank zu rechnen. Auch alle seine Kollegen und Vorgesetzten hatten ihn sehr geschätzt. Als er nun in St. Hubert zu Grabe getragen wurde, folgten seinem Sarge über zweihundert Menschen.
Was sich bisher an Verbrechen — doch eigentlich konnte man bloß von Vergehen reden! — Ja, was sich in dieser Hinsicht bisher ereignet hatte, dessen waren die örtlichen Polizeibehörden immer mit Leichtigkeit Herr geworden. Langwierige und scharfsinnige Untersuchungen waren gewöhnlich dabei nicht erforderlich, da es die Täter an Umsicht und Raffinesse hatten fehlen lassen, so daß sie leicht zu ermitteln waren.
Hier aber lagen die Dinge anders. Hier handelte es sich um ein Kapitalverbrechen, begangen von einem Menschen, der zweifellos alles daransetzte, seine Spur zu verwischen. Dies ergaben bereits die ersten Mitteilungen, die von einem aus Arlon herbeigerufenen Inspektor angestellt wurden. Dieser war einsichtig und bescheiden genug, sich die Lösung des Falles nicht allein zuzutrauen. Daher regte er an, aus Brüssel den in Mordsachen äußerst erfahrenen Kommissar Didier kommen zu lassen.
Immerhin blieb dem Inspektor nichts anderes übrig, als die ersten Untersuchungen am Tatort selbst vorzunehmen. René Meunier führte ihn und einen Segeanten, der sich in Begleitung des Inspektors befand, zu der einsamen und entlegenen Stelle im Wald. Auch der alte Meunier schloß sich an. René mußte sich auf die Erde legen, in gleicher Weise, wie man den Toten gefunden hatte. So versuchte man alles zu rekonstruieren.
Als dann der Inspektor fragte, wo denn er Drilling des Försters gelegen habe, schauten Vater und Sohn sich betreten an. Jetzt erst kam ihnen zu Bewußtsein, daß sie Duponts Gewehr nicht gesehen hatten.
Die Untersuchung des Bodens ergab, daß ein Kampf, das heißt ein Handgemenge zwischen den beiden Gegnern nicht stattfand. Dupont mußte aus dem Hinterhalt und aus weiter Entfernung niedergeknallt worden sein. Der Inspektor glaubte dies um so eher, als der Förster vor kurzer Zeit schon einmal einen ähnlichen Zusammenstoß hatte. Hierüber hatte der Oberförster den Inspektor informiert.
Der Inspektor brachte seine spärlichen Beobachtungen gewissenhaft zu Protokoll. Eine eingehendere und genauere Untersuchng wurde erst unternommen, als folgenden Tages der Kommissar Didier aus Brüssel erschien.
Didier war ein Mann, dem nichts Außergewöhnliches anhaftete. Nichts an ihm ließ darauf schließen, daß er der beste, erfolgreichste und intelligenteste Beamte der belgischen Kriminalpolizei war. Er sah eher wie ein biederer Spießbürger aus, — und so gab er sich auch gewöhnlich. Erst wenn man ihn über berufliche Dinge reden hörte und in seiner überlegenen Weise handeln sah, kam man dahinter, daß er in kriminalistischen Fragen geradezu ein Genie war.
Das Protokoll seines Kollegen aus Arlon hatte er schon mit allen Einzelheiten im Kopf. Es war dürftig genug und löste bei ihm lediglich ein nachsichtiges Lächeln aus. Man mußte zu besseren und greifbareren Resultaten kommen.
Als treuen Helfer hatte er sich seinen Sergeanten Knox mitgebracht.
Außer Knox und dem Sergeanten aus Arlon mußte René bei der Untersuchung wieder zugegen sein, von dem sich Didier alles noch einmal erklären ließ. Als der junge Mann sich erneut so hingelegt hatte, wie man den toten Förster vorfand, stutzte der Kommissar. „In Wirklichkeit“, sagte er, sich an den Inspektor wendend, „hatte der Tote zuerst anders gelegen, und zwar gerade nach der entgegengesetzten Seite zu.“
Die anderen blickten ihn verblüfft an. „Aber wieso denn?“ fragte René.
Didier wies auf kaum sichtbare Spuren, die dem Inspektor entgangen waren. „Allerdings muß man schon sehr genau hinsehen“, sagte er, „wenn man sie finden will. Aber sehen Sie bitte hier die Eindrücke von den Hacken des Försters! Vergleichen wir sie mit den anderen, — und es stimmt!“
„Und warum sollt der Mörder die Leiche in eine andere Richtung gelegt haben?“ fragte der Inspektor verwundert.
„Zur Irreführung“, erwiderte Didier gelassen, „damit man die Richtung, aus welcher der tödliche Schuß kam, falsch annehmen sollte.“ Der Kommissar zog einen Kompaß aus der Tasche. „Dort ist Norden“, zeigte er mit dem Finger, „und wenn man die Lage, in der man den Förster fand, als richtig bezeichnen wollte, müßte der Schuß ihn aus nördlicher Richtung kommend getroffen haben.“
„Dort habe ich auch alles abgesucht“, erklärte der Inspektor betreten.
Didier lächelte. „War ja auch naheliegend“, entschuldigte er den anderen, „aber in Wirklichkeit hat der Schütze dort im Süden gestanden. Wir werden gleich festzustellen versuchen, ob ein Feuerkampf zwischen den beiden Gegnern stattfand,— was ich vermute.“
„Sie glauben also, Herr Kommissar“, sagte René, „daß man den Förster nicht aus dem Hinterhalt niederschoß?“
„Nein — das glaube ich kaum“, erwiderte Didier, „sonst wäre er nicht in die Stirn getroffen worden, das werden Sie doch wohl einsehen.“
René schwieg und folgte mit den anderen dem Kommissar, der in südlicher Richtung die Umgebung der Mordstelle abzusuchen begann, wobei er auch gleich eine von dort kommende und dorthin zurückführende, allerdings auch wieder schwer sichtbare Spur entdeckte. Während der nicht nur den Boden, sondern auch jeden Baum untersuchte, erklärte er, wie sich seiner Meinung nach der Vorfall abgespielt haben müsse. Daß der Förster, nachdem er schon einmal von seinem geheimnisvollen Gegner aus einem Hinterhalt überrascht worden worden war, achtlos und ohne besondere Vorsicht durch den Wald schlenderte, wäre nicht anzunehmen. Wahrscheinlich habe er diesmal den Wilderer seinerseits überrascht und ihm ein donnerndes Halt! zugerufen. Der andere sei wohl daraufhin stehengeblieben, habe aber auch gleich, hinter einem Baum stehend, gegen den Förster angelegt und auf diesen geschossen. Daß Dupont jedoch vorher nicht auf den anderen schoß, als er sah, daß dieser die Waffe hob, war so gut wie undenkbar. „Ich bin überzeugt“, sagte Didier zum Schluß, „Ihnen das, was ich eben behauptete, auch beweisen zu können.“
Eifrig suchte er weiter Boden, Bäume und Sträucher ab. Plötzlich wurde er aufmerksam. „Bitte hier!“ wies er auf einige niedergetretene Farnkräuter und mehrere zerbrochene, winzige Zweige, „hier, hinter diesem Baum hat der Schütze gestanden. Er ist auch in weiterem Umkreis der einzige, der einem Mann volle Deckung bietet. Sie werden sehen, daß ich recht habe.“
Alle staunten, als der Kommissar auf ein kleines Loch in der Buche wies. „Hier“, sagte er, „hat eine Kugel des Försters in den Stamm eingeschlagen. Wir müssen uns jetzt schon die Mühe machen, sie dort herauszupuhlen, — und wenn der Baum deswegen gefällt werden sollte. — Knox, vielleicht machen Sie einmal den Versuch!“
Der Sergeant zog sein Taschenmesser hervor und suchte das Loch zu erweitern, um gegen die Kugel vorzudringen, die noch im Stamm stecken mußte.
Didier deutete auf ein Stückchen abgesplitterter Rinde. „Und hier“, sagte er, „sehen Sie, wo eine andere Kugel des Försters hinschlug. Genau in Brusthöhe übrigens, wie auch die andere Kugel. Hätte der Mörder in jenem Augenblick nicht genau hinter dem Stamm gestanden, würde ihn diese Kugel bestimmt getroffen haben.“
Der Kommissar trat von dem Baum zurück und visierte scharf an dem Stamm vorbei in der Richtung, in die beide Kugeln geflogen waren. Dann deutete er auf einen entfernteren Baum und meinte, in ihm müsse die eine Kugel noch stecken. Tatsächlich zog man sie bald darauf aus der Rinde. Sie hatte, durch ihren ersten Anprall bereits geschwächt, nicht mehr tief in diesen Baum eindringen können. Nachdem sie der Kommissar von allen Seiten betrachtet und genau untersucht hatte, erklärte er: Ja — diese Kugel muß aus dem Drilling des Försters stammen. Es ist sein Kaliber, während das seines Mörders einen Millimeter kleiner ist. Hier, bitte vergleichen Sie!“ Er besaß auch die bei der Obduktion aus der Leiche des Försters entfernte Kugel, die er gegen die andere hielt. Der Inspektor und Knox mußten zustimmen, daß er recht hatte.
Das Auto des Kommissars hielt in St. Hubert vor dem Häuschen, das der Führer einer Holzschlägerkolonne, Meister Henry Ribot bewohnte. Ribot war ein stattlicher Mann, der mit dem Förster stets in bestem Einvernehmen gearbeitet hatte, und dem Duponts Tod deshalb besonders nahe ging.
Ribot erzählte dem Kommissar auf Befragen, daß er am Mordtage im Hochwald, und zwar im Jagen 22, also nicht weit von der Stelle, wo später der Mord geschah, mit dem Förster zusammengetroffen war, mit dem er hier an Ort und Stelle die Anlage einer neuen Schneise besprach. „Ich wunderte mich noch darüber“, sagte der Holzfäller, „daß Dupont keine Bedenken hatte, um die Zeit der Dämmerung noch allein durch den Wald zu gehen und schlug ihm vor, ihn zu begleiten. Außerdem hatte ich ihm auch gesagt, daß ich glaubte, erst vor kurzem im Walde Schüsse gehört zu haben. Er lächelte aber nur dazu. Ob ich glaubte, er habe Angst, fragte er mich gekränkt, da sollte ich ihn doch besser kennen. Auch werde er schon auf der Hut sein, — ja, das sagte er, — und dann stapfte er mit seinem Lux wieder davon.“
Didier fragte, wann das gewesen sei. Der Holzfäller gab die Zeit zwischen achtzehn und achtzehn Uhr dreißig an.
Der Kommissar überlegte. Es war ihm um eine möglichst genaue Zeitbegrenzung zu tun. Um neunzehn Uhr fünfundvierzig war, wie er festgestellt hatte, Lux vor dem Forsthaus erschienen. Der Hund mochte die Strecke von der Leiche seines Herrn bis nach Hause in etwa einer halben Stunde zurückgelegt haben. Demnach war das Unglück wahrscheinlich um neunzehn Uhr fünfzehn geschehen. Jedenfalls mußte die Mordzeit zwischen achtzehn Uhr und neunzehn Uhr fünfzehn liegen.
„Sie glauben nicht, Herr Kommissar“, fragte Ribot, „daß man den Förster aus einem Hinterhalt niederschoß?“
„Nein“, sagte Didier bestimmt, „zwischen ihm und dem Verbrecher hatte ein kurzer Feuerkampf stattgefunden, wie ich bereits ermitteln konnte.“ Didier erläuterte freimütig und mit gewisser Ausführlichkeit, wie er zu dieser Erkenntnis gekommen war. „Als dann der Förster getroffen war“, fuhr er fort, „ist der Mörder noch zu ihm hingelaufen, nahm ihm jedoch weder Börse noch Uhr ab, sondern ließ lediglich Duponts Waffe mitgehen.“
„Seinen Drilling?“
„Ja. Sie kennen die Waffe gewiß genau. Nach ihr muß vor allem geforscht werden.“
„Ich werde die Augen offen halten, Herr Kommissar!“
„Der Töter trug einen graubraunen Mantel“, fuhr Didier fort, „merken Sie sich das bitte auch.“
Der Holzfäller staunte. „Woher wissen Sie das?“
„Ja, mein Lieber“, engegnete Didier, „es hat mich viel Mühe gekostet, bis ich das feststellen konnte. Vier Stunden lang habe ich gestern noch einmal die Umgebung des Tatortes abgesucht. Dabei entdeckte ich einen Tuchfetzen, den eine Kugel des Försters aus dem Mantel des Mörders herausgerissen haben muß, — wahrcheinlich dieselbe Kugel, die auch ein Stück von der Baumrinde mitnahm — Schuhgröße 41.“
„Wie, bitte?“
„Der Täter hat die Schuhgröße einundvierzig, wie aus seiner Fußspur hervorgeht.“
„Ich muß doch staunen“, erklärte Ribot in ehrfurchtsvoller Bewunderung, „wie genau Sie gearbeitet und was Sie schon alles herausgekriegt haben, Herr Kommissar! Das wären ja wirklich schon wichtige Anhaltspunkte.“
„Hm — wie man’s nimmt“, erwiderte Didier knurrend, „vielleicht kann man schon was damit anfangen. Aber nun sagen Sie bitte: wissen Sie irgend jemanden hier im Ort oder auch in der Umgebung, der als Mörder möglicherweise in Frage käme?“
Ribot erwiderte, daß er darüber auch schon angestrengt nachgedacht habe. Immerhin sei es verantwortungslos, irgendeinen Verdacht zu äußern, solange man dazu nicht überzeugende Gründe habe.
„Jedenfalls wissen Sie jemanden“, sagte der Kommissar überzeugt, „auf den vielleicht ein Verdacht fallen könnte!?“
Der Holzfäller zögerte einen Augenblick. Dann sagte er: „Ich traf einmal einen gewissen Declerc mit einem Stutzen im Walde an.“
Der Kommissar horchte auf. „Declerc? Wer ist das?“
„Der Sohn unseres Wegemeisters. — Der Förster, dem ich den Vorfall gemeldet hatte, stellte den jungen Mann damals gleich zur Rede, wobei es zu einer recht heftigen Auseinandersetzung gekommen war. Immerhin war dem Declerc nicht nachzuweisen, daß er etwa gewildert hätte.“
Didier fragte den Holzfäller nach dem jungen Mann weiter aus, — was er für ein Mensch sei, wo er lebe und was für eine Tätigkeit er habe.
„Er ist Telegraphist bei dem hiesigen Postamt“, erklärte der Holzfällermeister, „übrigens ein recht hübscher, doch sehr vorlauter und verwegener Bursche, der dem Fräulein Susanne, der Tochter Duponts, einmal ernstlich den Hof gemacht hat, bevor sie sich mit dem jungen Meunier verlobte.“
„Das ist mir sehr interessant“, sagte der Kommissar, „ich glaube, dem jungen Mann sollte man mal auf die Finger sehen.“
„Sagen Sie aber bitte nicht, daß ich Ihnen — —“
„Aber ich denke gar nicht daran! Mein lieber Monsieur Ribot, was wir beide gemeinsam besprechen, geht keinen Dritten was an. Das behalten wir beide für uns, nicht wahr?“
Der Holzfäller fühlte sich sehr von Didier angezogen. Nichts war an diesem berühmten Kommissar, was als Hochmut oder Überheblichkeit hätte ausgelegt werden können; im Gegenteil: Didier gab sich so schlicht und vertraulich, daß man gleich mit ihm warm werden mußte und ihm selber das größte Vertrauen schenkte. Er spricht mit mir so — dachte Ribot bei sich — als ob ich ein alter Freund von ihm wäre und legt mir die Ergebnisse seiner Nachforschungen so offen dar, als ob ich mit ihm den Fall zu bearbeiten hätte. Aber so wird er es wohl nicht bei jedem machen. Der Mann besitzt Menschenkenntnis und weiß sofort, wen er vor sich hat! — —
Diese Einsicht schmeichelte dem biederen Holzfäller ungemein.
Zwei Tage später fiel Schnee, der jedoch an der Erde gleich wieder verging. Nur in den höheren Gebirgsschichten blieb er liegen, wo aus der Ferne flimmernde Kuppen herübergrüßten. Man sah auch den Gipfel des Baraque de Fraiture, der sich immerhin über 650 Meter hoch gegen den Himmel erhob.
Durch den Wald ging ein Förster mit einem langen, bereits von weißen Fäden durchwobenen Vollbart. Es mochte wohl der vom Oberforstamt in Arlon bestellte Nachfolger des ermordeten Revierförsters Dupont sein. Neben ihm, brav bei Fuß, lief ein rassiger Polizeihund her.
Plötzlich erscholl in der Ferne ein Schuß. Förster und Hund horchten auf. Der Förster rief: „Hasso — lauf zu und faß!“ und ließ das Tier in der Richtung fortstürmen, aus welcher der Schall gekommen war. Hastig folgte er dem Hund.
Da hörte er, wie das Tier klagende Laute von sich gab. Näher kommend, entdeckte er, daß sich Hasso in einem Eisen verfangen hatte, das zweifellos gegen das Wild ausgelegt war. Knirschend vor Wut machte der Förster das Tier wieder frei, das erheblich an seiner rechten Vorderpfote verletzt war und jetzt nur noch humpeln konnte. Trotzdem versuchte es der aufgenommenen Fährte weiter zu folgen.
Der Förster eilte noch etwa zweihundert Meter weiter, rannte dann aber, außer Atem gekommen, nicht mehr, sondern ließ nur noch den Hund weiter Witterung nehmen und folgte ihm im normalen Schritt, bis er an einen breiten Weg gelangte, wo die Spur plötzlich abbrach. Hier hatte, wie man leicht feststellen konnte, an einer Erle ein Fahrrad gestanden, auf dem der verdächtige Schütze die Flucht ergriff.
Der Förster ging auf der Spur ein Stück zurück und wunderte sich, als Hasso auf einmal zur Seite ausbrach und laut anschlagend vor einer Hecke stehen blieb, wo er aufgeregt mit dem Schwanz wedelte. Hier entdeckte der Förster die Innereien eines kunstgerecht ausgenommenen Rehs, — und ganz in der Nähe lag auch das Tier, das der Wilddieb, als er das Nahen des Försters bemerkte, offenbar kurzerhand liegen ließ, um unbeschwert die Flucht ergreifen zu können.
Während der Förster noch immer damit beschäftigt war, alles zu untersuchen, schlug der Hund wieder an und humpelte einige Schritte in der Richtung davon, aus der man gekommen war. Da erblickte der Förster einen Mann, in dem er alsbald den Holzbauermeister Ribot erkannte.
Ribot, als er herangekommen, starrte den Förster verwundert an. Dann, in einer plötzlichen Erkenntnis, sagte er lachend: „Ach — Sie sind es, Herr Kommissar! In diesem Barbarossabart hätte ich Sie wahrhaftig kaum wiedererkannt.“
Die Männer reichten einander die Hand und begrüßten sich herzlich. Didier deutete auf den vor ihm liegenden Rehkadaver. „Und was sagen Sie dazu, Ribot?“