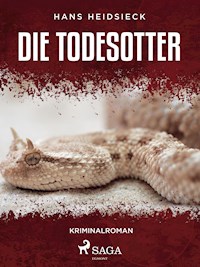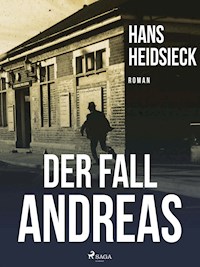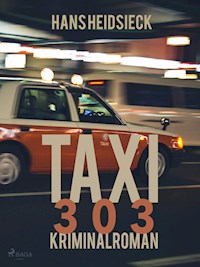Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fast schon zu deutlich finden sich die Fingerabdrücke des "Feuerteufels" auf dem Benzinkanister, der in der Nähe eines halbverbrannten Autos in London gefunden wird. Mit verbrannt ist die Franelli, die bekannte Varieté-Tänzerin der Rialto-Bar. Während zunächst ihr Manager Dotto in Verdacht gerät, gibt es einen neuen Brand. In den Viktoria-Chemie-Werken wird eingebrochen und Feuer gelegt. Und wieder finden sich die Fingerabdrücke des bei Scotland Yard bestens bekannten Verbrechers. Kommissar Lester ahnt, dass jemand mit der Feuermethode von sich ablenken will. Als ein Raubmord dem anderen folgt, in Paris und in Oslo Verbrechen fast gleichzeitig stattfinden und überall die Fingerabdrücke geradezu präsentiert werden, gerät er unter Druck. Dann kommt das Gerücht auf, der Feuerteufel sei ermordet worden. Aber plötzlich taucht der Getötete wieder auf. Der routinierte Kommissar lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Motto "Das Wichtigste zuerst" listet er alle Ereignisse der Reihe nach noch einmal auf – und bekommt auf einmal die entscheidende Idee. Ein spannender Krimi!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Der Feuerteufel
Kriminalroman
Saga
Der Feuerteufel
German
© 1952 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508657
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Donnernd und knatternd jagte der große Fernlastzug durch die Nacht. Geisterhaft reckten sich rechts und links die Chausseebäume auf, die das Licht der Scheinwerfer aus dem Dunkel schälte. Auch in der Höhe wurden sie angestrahlt, so daß man den Eindruck gewinnen konnte, als fahre man unter einem Lichtdom hindurch.
Die sehnigen Hände des Fahrers hielten das Steuer umklammert, das unter den Stößen des starken Dieselmotors vibrierte. Der Blick des Mannes war starr nach vorn gerichtet. Sein Beifahrer, in sich zusammengesunken neben ihm hockend, schlief, den Kopf gegen die Scheibe gelehnt.
Plötzlich betätigte der Fahrer die Luftdruckbremse. Der schwere Fünftonner verlangsamte sein Tempo. Was war das? Dort vorn, in der vertrauten, nicht ungefährlichen Kurve, ein flackernder Feuerschein! Züngelnde Flammen schießen empor — schon ist der Laster ganz nahe herangekommen. Ein brennendes Auto!
Der Fünftonner hält. Der Beifahrer schrickt empor und starrt zunächst fassungslos vor sich hin. Der andere muß ihn erst in die Rippen stoßen: „Hallo, Bob! Da ist was passiert — los, los, besinn’ dich nicht lange!“
Schon springen beide auf die Straße hinunter und nähern sich dem brennenden Wagen. Aber der ist schon fast vollständig ausgebrannt, — nur hie und da schlagen aus dem glühenden Gestänge noch ersterbende Flammen heraus.
Vorne am Steuer erkennt man eine halb verkohlte Gestalt. „Mein Gott — eine Frau!“ entfährt es dem Lastzugfahrer. Die Glut hindert ihn, näher heranzugehen.
Was sollte man tun? Löschen? Womit? Und wozu noch? Hier war doch nichts mehr zu retten.
Hilflos schauen die beiden Fahrer einander an. Plötzlich steht noch ein dritter Mann neben ihnen, ein kleiner gedrungener Kerl. Sie sehen ihn in dem Flackerschein grinsen: „Schöne Bescherung, was?“
„Mensch — wo kommst du denn her?“ fragen die beiden Fahrer zugleich. Der eine von ihnen greift unwillkürlich an seine Hosentasche, in der er seine Waffe verwahrt hält.
„Nichts für ungut“, erwidert das Männchen kichernd, „hattet mich zwar nicht eingeladen, aber — übrigens ist eurer Anhänger verdammt schlecht gefedert, das muß ich schon sagen. Da werden einem ja sämtliche Gedärme durcheinandergeschüttelt!“ Er deutete auf das brennende Wrack: „Glaube hier können wir nichts weiter tun, als das Ding brennen lassen und inzwischen die nächste Polizeistation alarmieren.“
„Nein!“ rief da der erste Fahrer, der den Lastzug gesteuert hatte, „zunächst müssen wir einmal Umschau halten, ob nicht noch jemand verunglückt ist — möglicherweise aus dem Wagen geschleudert.“ Er eilte zu seinem Führersitz, nahm einen Handscheinwerfer und leuchtete die Umgebung ab.
Es war nichts zu entdecken.
„Komm, Bob!“ sagte er dann, zu seinem Kollegen gewendet, „der Mann hat recht.. Bis zum nächsten Ort sind’s nur noch acht Kilometer. Dort werden wir die Polizei alarmieren.“ Er klopfte dem ‚blinden Passagier‘ auf die Schulter, „also los, aufgestiegen! In Gottes Namen, — komm mit in die Führerkabine! Damit deine Gedärme in Ordnung bleiben. Können dich auch nicht gut allein hier in der Nacht herumgeistern lassen. Mit der verkohlten Frau da am Steuer ist nichts mehr zu flirten!“
„Ihr seid doch anständige Leute!“ sagte das Männchen, wiederum grinsend, „daß ihr mich weiter mitnehmen wollt. Und dazu noch in der Fahrerkabine.“
„Los, los — nicht lange gefackelt, Mann!“ rief der Fahrer und half ihm in die Kabine hinauf.
In rasender Fahrt ging es zum nächsten Ort.
Der Polizeigewaltige von Brixton zeigte sich äußerst mürrisch, als er durch den Fernfahrer aus seiner Ruhe aufgescheucht wurde. Was? Ein Auto — vollständig ausgebrannt, mit einer Leiche am Steuer?
Hinter dem Fahrer stand Bob und nickte gewichtig. Er hielt das Männchen fest bei der Hand, das sich vergeblich zu befreien versuchte.. Gegen den Kleinen war in dem Fahrer plötzlich ein Verdacht aufgekommen, namentlich, als er sich bei Ankunft vor der Polizeistation rasch zu verdrücken suchte. Deshalb hatte er Bob den Auftrag gegeben, den ungebetenen Gast festzuhalten und mit hereinzuführen. Jetzt fuhr er fort, auf den Kleinen deutend: „Und der da — der stand plötzlich neben uns, als wir uns die Geschichte besahen. Zwar behauptete er, heimlich mit uns gefahren zu sein, aber —“. Ein Achselzucken ergänzte, was der Fahrer nicht aussprach.
Statt sich sogleich auf den Weg zu machen, nahm der Polizeisergeant zunächst ein umständliches Protokoll auf. Der Fahrer mußte ihm möglichst genau den Vorfall schildern. Dann ließ er sich alles von Bob, dem Beifahrer, noch wiederholen, — und auch das Männchen, das sich William Wilson nannte und behauptete, ein stellungsloser Schlosser zu sein und auf billige Weise nach Manchester zu seinem Bruder gelangen zu wollen, mußte noch einmal alles haarklein erzählen, bis der Sergeant ihn unvermittelt anfuhr: „Und Sie behaupten, in dem Laster gesessen zu haben, als er an die Unglücksstelle gelangte?“
Der Kleine zuckte zusammen. „Gesessen ist wohl zuviel gesagt, Sergeant, hin und her geflogen bin ich in dem Anhänger, daß mir noch jetzt sämtliche Rippen schmerzen.“
„Beweis?“
„Was — Beweis? An einer Tankstelle bin ich hinaufgeklettert.“
„Das ist kein Beweis!“ Der Sergeant winkte einen anderen Beamten heran: „Einsperren!“ befahl er, „später werden wir sehen —“
Wilson brauste auf: „Unerhört — wenn ich Ihnen doch sage, Sergeant!“
„Sie können viel sagen. Das wird sich noch klären. — Und jetzt, Griffins“, wandte er sich dem anderen Beamten zu, „fahren wir zu der Unglücksstelle, nachdem Sie diesen Verdächtigen gebührend in Gewahrsam gebracht haben.“ Er musterte die beiden Fahrer mit einem düsteren Blick. „Sie, meine Herren, sind entlassen. Ihre Personalien habe ich ja. Good bye!“
Eine halbe Stunde später langte der Sergeant mit Griffins im Beiwagenkrad vor den rauchenden Trümmern des verunglückten Wagens an. Dicht dabei befand sich ein zweiter Personenwagen, dem ein Herr und eine Dame entstiegen waren. Sie blickten den Beamten mit verstörten Gesichtern entgegen. Die beiden behaupteten, vor wenigen Minuten hier eingetroffen zu sein. Sie hätten gerade zur nächsten Polizeistation fahren wollen. Nun sei es ja gut, daß die Polizei bereits da sei.
Der Sergeant ließ sie stehen und ging mit gewichtiger Miene zunächst einmal um den verunglückten Wagen herum. Dann brummte er vor sich hin: „Wahrscheinlich zu schnell gefahren, aus der Kurve geschleudert und gegen den Baum.“
Die Dame aus dem anderen Personenwagen näherte sich ihm. „Keine Bremsspur!“ erklärte sie ruhig, „ich habe den Boden schon abgeleuchtet. Auch keine Anzeichen dafür, daß der Wagen gerutscht ist.“
Der Sergeant starrte sie an. „Wie meinen Sie das?“
„Ich finde das auffällig!“ sagte die Dame und zündete sich eine Zigarette an.
Griffins hatte sich vorn am Baum das verbrannte Auto betrachtet und meinte: „Der Stoß kann nicht sehr heftig gewesen sein, Sergeant. Die Geschwindigkeit des Wagens hat beim Anrennen an den Baum höchstens 25 bis 30 Stundenkilometer betragen.“
„Das habe ich auch schon festgestellt“, mischte die Dame sich wieder ein. Ihr Begleiter nickte und sagte: „Auch eine sehr auffällige Tatsache!“
„Und die Lage der halbverkohlten Frau am Steuer läßt darauf schließen“, ergänzte die Dame, „daß sie erst nachträglich dorthingesetzt worden ist. Kurzum, — ich glaube an einen fingierten Unfall, dem ein Mord zugrunde liegt.“
Der Sergeant war verblüfft. „Wie kommen Sie darauf, Mylady?“ fragte er mit heiserer Stimme, „ich verstehe nicht — wer sind Sie denn überhaupt?“
Die Dame lachte. „Nicht wahr — Sie wundern sich über meine detektivischen Fähigkeiten? Die Erklärung ist einfach. Ich bin als Schwester des bekannten Privatdetektivs Piet Orlans selber eine Zeitlang bei ihm als Detektivin tätig gewesen. Mein Name ist Kitty Leaf.“
„Was?“ rief der Sergeant, „Piet Orlans — der schon mehrfach mit Kommissar Lester zusammen gearbeitet hat?“
„Richtig. Nun werden Sie auch verstehen, daß mir hier gleich mancherlei auffiel.“
„Sie glauben also tatsächlich, daß —?“
„Prüfen Sie selber noch einmal alles nach! Dann werden Sie mir wohl recht geben müssen. Selbst mein Mann. der an sich von solchen Dingen wenig versteht, mußte mir zugeben, daß ich mit meiner Vermutung wahrscheinlich recht habe — nachdem ich ihm alles gezeigt und erklärt hatte. — Übrigens liegt neben dem Wagen noch ein unversehrter Benzinkanister, von dem sich vielleicht Fingerabdrücke nehmen lassen. Ich habe ihn nicht berührt.“
„Stellen Sie den Kanister vorsichtig sicher!“ befahl der Sergeant seinem Kollegen. Dann wandte er sich wieder Mrs. Leaf zu. „Ich bin Ihnen für Ihre Hinweise sehr dankbar, Madame“, sagte er, „werde alles von diesem Gesichtspunkt aus noch einmal genau untersuchen. Schon kommt es mir auch so vor, als ob Sie recht haben könnten.“
Mrs. Leaf beteiligte sich noch eine Weile an der Untersuchung, während ihr Gatte die Vorgänge mit Spannung beobachtete. Dann trat das Ehepaar die Weiterfahrt an.
Erst als der Tag graute, kehrte der Sergeant mit Griffins nach Brixton zurück. Er meldete das Ergebnis seiner Untersuchung nach Scotland Yard.
Kommissar Lester nahm persönlich die Meldung entgegen. Er stellte verschiedene Fragen, nach deren Beantwortung auch er davon überzeugt war, daß es sich um einen Mordfall handelte.
„Und Mrs. Leaf war, sagten Sie, an der Unfallstelle?“
„Ja. Sie gab mir sofort die richtigen Tips.“
„Sieht ihr ähnlich. Verdammt tüchtiges Frauenzimmer. Schade, daß sie nicht mehr Detektivin ist. Höchstens noch, wie in diesem Fall, amateurweise. Immerhin—wenn die sagte, daß es sich um einen Mord handelt, dann ist es auch einer!“
Der Sergeant war gekränkt. „Erlauben Sie, Kommissar — — ich habe das ja auch festgestellt.“
„Ja. Hinterher. Aber egal. Ich werde den Fall in die Hand nehmen, Sergeant. Die Nummer des Wagens haben Sie mir ja schon durchgesagt. Ein wichtiger Anhaltspunkt wäre damit gegeben. — Wahrscheinlich werden wir uns heute noch sehen. Bis dahin — — good bye, Sergeant!“
Lester legte den Hörer auf und wandte sich seinem treuen Mitarbeiter und Assistenten zu, dem Kriminalsekretär Dix, der, in einem Protokoll blätternd, am Fenster vor seinem Arbeitstisch saß.
„Interessanter Fall, Dix“, sagte er und erläuterte kurz, was er eben vernommen hatte. Dix hörte ihm aufmerksam zu. Dann strich er über seine Warze am Kinn und meinte brummend: „Kann vielleicht interessant werden. Werde zunächst mal feststellen, wem das Auto gehörte.“
„Darum wollte ich gerade bitten“, erwiderte Lester, „und dann machen Sie sich zu einer Fahrt nach Brixton bereit!“
Signorina Litti öffnete vorsichtig die Tür zu Signora Franellis Zimmer. Die Vorhänge waren noch zugezogen. In dem Raum herrschte ein mystisches Dunkel.
„Hallo — Signora Franelli!“ erklang zögernd und fragend die Stimme der kleinen Litti.
Nichts rührte sich. Niemand antwortete. Die Litti trat näher und warf einen Blick auf das Bett, das sich, nachdem sie sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte, schemenhaft ihren Blicken darbot. Das Bett war leer. Die junge Tänzerin eilte zum Fenster und zog die Vorhänge hoch. Helles Tageslicht strömte in den Raum.
Signorina Litti faßte sich an den Kopf. Verwirrt blickte sie um sich. Die Franelli war also in der vergangenen Nacht nicht nach Hause gekommen.
Die junge Italienerin verließ hastig das Zimmer, um sofort ihren Manager Signor Dotto aufzusuchen.
„Was?“ rief Dotto, „die Franelli ist nicht nach Hause gekommen?“ Er strich sich mit einer verlegenen Geste über das spärliche Haar, „merkwürdig. Ich entsinne mich — gestern Abend nach der Vorstellung ist sie mit ihrem Wagen davon gefahren. — Na, warten wir erst einmal ab! Vielleicht kommt sie bald.“
Er faßte die Kleine am Kinn und blickte ihr in die Augen. Sie senkte den Kopf. Doch er hob das Köpfchen mit einer energischen Bewegung wieder empor, riß sie in seine Arme und küßte sie.
„Antonio!“ rief sie, nachdem sie sich, nicht eben energisch, von ihm befreit hatte, „du sollst doch nicht —!“
Er lachte: „Ich tu es aber. Wer könnte deinem Kußmäulchen auch widerstehen? Wann heiraten wir?“
„Niemals!“
Er lachte noch lauter: „Das wird sich finden!“
Sie lehnte sich gegen die Wand und blickte ihn aus ihren schwarzen Augen funkelnd an. „Als ob ich nicht wüßte, daß Du doch nur die Franelli wirklich liebst!“
„Pah!“ rief er, „Theater! Das ist längst vorüber. Sie ist meiner überdrüssig, — und umgekehrt auch. — Aber lassen wir das! Du wirst jetzt beobachten, ob sie kommt, und wenn sie da ist, teilst du mir das sofort mit!“
Er versuchte, sich wieder der Kleinen zu nähern. Aber sie wich ihm aus und huschte durch die Tür davon, bevor er sie noch erfassen konnte.
Dotto hatte sich nachdenklich an seinen Schreibtisch gesetzt. Das Telefon klingelte. Er meldete sich. „Ja — bitte? Wie, bitte? Autonummer 58362? Ob das die Nummer des Wagens von Frau Franelli ist? Muß ich erst feststellen, Sir. — Was? Ob Sie die Dame sprechen können? Bedaure, — sie ist seit gestern abend noch nicht zurückgekehrt.“
Die Stimme am anderen Ende der Leitung stieß ein ‚Aha!‘ aus, als ob der Betreffende diese Antwort erwartet hätte.
„Wer spricht denn dort überhaupt?“ wollte Dotto wissen.
„Kommissar Lester von Scotland Yard!“ erklang eine scharfe Stimme zurück.
Der Manager fuhr unwillkürlich zusammen. „Um Gottes Willen, Herr Kommissar — ist was passiert?“
„Allerdings. Aber ich bitte Sie: schweigen Sie vorläufig darüber, daß ich Sie anrief! Jetzt ist es ein Uhr. Ich werde um zwei Uhr bei Ihnen sein. Frau Franelli brauchen Sie vorläufig nicht mehr zu erwarten.“
„Mein Gott — sollte sie etwa — —?“
„Später, Signor Dotto, später. Ich werde Ihnen alles erklären. Halten Sie sich also bitte zu einer Besprechung um zwei Uhr bereit!“
Der Manager erhob sich nach diesem Gespräch und schritt im Zimmer aufgeregt hin und her. Sein Herz klopfte zum Zerspringen. Zweifellos war mit der Franelli irgend etwas geschehen. Sollte sich‘s um ein Verbrechen handeln? Wenn Scotland Yard schon im Spiele war — — dazu noch einer der tüchtigsten Konlmissare, den jeder kannte — —?
Dotto fühlte, wie ihm schwindelig wurde. Er mußte sich wieder setzen. Bettina Franelli — — sie war, wie er selber zu ihr scherzhaft immer wieder gesagt hatte, ‚der Traum seiner schlaflosen Nächte‘. Ein Aas, eine Sphinx. Und doch konnte man von ihr nicht mehr loskommen. Die kleine Litti hielt er sich nur in Reserve. Er zweifelte immer wieder daran, ob es ihm je gelingen werde, Bettina ganz für sich zu gewinnen. Sie war glatt wie ein Aal. Immer freundlich, stets liebenswürdig, — doch im Untergrund ihres Wesens schillerte Kälte. Sie war klug und berechnend, — doch er konnte nicht klug aus ihr werden. Er konnte auch nicht behaupten, daß er der einzige von ihr Bevorzugte sei. Es war zum Verzweifeln — aber da gab es auch andere noch, die sich in ihrer unverkennbaren Zuneigung sonnen konnten, verschiedene andere, auf die sich Dottos unversöhnlicher Haß konzentrierte. So wurde er dauernd zwischen Hoffen und Zweifeln herumgeworfen. Der einzige ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht war die kleine Litti, bei der er Trost und Verständnis suchte. —
Pünktlich um zwei Uhr erschien der Kommissar. Dotto blickte ihn forschend an, suchte schon zu erraten, was ihm der andere wohl eröffnen würde.
Er bat den Kommissar, Platz zu nehmen, und reichte ihm Zigaretten. Lester lehnte dankend ab. Er schwieg zunächst und betrachtete sein Gegenüber mit einem forschenden Blick.
„Reden Sie bitte, Kommissar!“ bat Dotto fiebernd, „was ist mit der Franelli geschehen?“
„Sie waren mit der Dame befreundet?“ fragte Lester dagegen.
„Wie man‘s nimmt“, erwiderte der Manager mit einem trüben Lächeln, „jedenfalls habe ich sie hier bei der Rialto-Bar angebracht.“
„Das ist keine präzise Antwort auf meine Frage!“ erwiderte der Kommissar und trommelte auf den Tisch.
„Hm.“ Dotto rückte auf seinem Stuhl hin und her, „Ich gebe zu, daß ich recht viel für sie übrig habe. Sie ist eine vorzügliche Künstlerin.“
„Gewesen!“ erwiderte Lester kühl.
Dotto fuhr jäh empor. „Wie habe ich das zu verstehen?“
„Signora Franelli ist tot.“
„Tot!!!“ Es klang wie ein Schrei. Dotto rannte wie ein wildes Tier hin und her. Er faßte an seine Krawatte, hob die Schultern hoch, fuhr sich über die Augen, stöhnte laut auf. „Tot!“. Er blieb plötzlich wie angenagelt vor dem Tisch stehen.
„Ja. Mit dem Auto verunglückt. So sieht es wenigstens auf den ersten Blick aus. In Wirklichkeit dürfte es sich um einen Mord handeln, der durch ein fingiertes Unglück vertuscht werden sollte.“
„Tot!“ wiederholte Dotto noch einmal. Dann riß er sich gewaltsam zusammen. „Und wen haben Sie in Verdacht, Herr Kommissar?“
„Bisher noch niemanden“, erwiderte Lester sachlich kühl, „ich komme eben zu Ihnen, um die ersten Anhaltspunkte zu gewinnen. Gerade Sie haben doch mit der Franelli in näherer Beziehung gestanden. Vielleicht können Sie mir einen Wink geben.“
Dotto fühlte den forschenden Blick des Kommissars auf sich ruhen, als ob dieser ihn in den Bereich der Verdächtigen mit einbezog. Das empörte ihn. Was aber sollte er sagen? Es war eine üble, verzwickte Situation.
„Haben Sie mich etwa auch in Verdacht, Herr Kommissar?“ fragte er geradezu.
Um Lesters Lippen spielte ein feines Lächeln. „Sie? Wieso? Habe ich das etwa gesagt?“
„Nein. Aber — — vor den Herren Kriminalisten ist doch kein Mensch sicher, — daß er nicht in Verdacht kommen könnte.“
„Um in dieser Beziehung gleich Klarheit zu schaffen, brauchen Sie mir ja nur Ihr Alibi nachzuweisen, Mister Dotto!“ erwiderte Lester und spielte mit einem Bleistift, der auf dem Tisch lag.
„Für welche Zeit?“ fragte der Manager.
„Für die vergangene Nacht natürlich“, erwiderte der Kommissar.
„Nach der Vorstellung“, sagte Dotto, ein wenig zögernd, „bin ich, weil ich wie immer recht müde war, schlafen gegangen. Da ich allein schlafe, habe ich allerdings keine Zeugen dafür. Das heißt doch — halt! Fräulein Litti sah mich in mein Zimmer gehen.“
„Wer ist Fräulein Litti?“
„Ein Mitglied des Franelli-Ensembles.“
„Wieviele Mitglieder hat das Ensemble?“
„Sechs. Fräulein Litti ist nach Frau Franelli die hübscheste von allen!“
„Auf die sie wohl auch ein halbes Auge geworfen haben?“ fragte der Kommissar verschmitzt, dem der begeisterte Unterton in der Stimme Dottos nicht entgangen war.
Dotto erwiderte errötend: „Sie mögen da nicht so unrecht haben, Herr Kommissar.“
„Also die Litti könnte bezeugen, daß Sie auf Ihr Zimmer gegangen sind?“
„Unbedingt.“
„Wer aber bürgt mir dafür, daß Sie es nicht wieder verließen?“
„Herr Kommissar“, sagte Dotto ernst, „Frau Franelli ist nach der Vorstellung noch mit ihrem Auto davongefahren. Das hat auch Fräulein Litti gesehen. Ich aber ging viel später auf mein Zimmer.“
Der Kommissar schob einen Briefbeschwerer hin und her. „So“, sagte er, „Frau Franelli ist noch davongefahren? Allein?“
„Ja. Allein. Darüber habe ich mich auch gewundert. Ich war sehr betroffen darüber. Aber ich habe sie nicht mehr fragen können, wo sie noch hinwollte in der Nacht. Auch hätte sie sich wohl nicht ausfragen lassen.“
„Sie schirrten daraufhin sofort Ihren Wagen an und fuhren ihr heimlich nach?“ sagte der Kommissar mit einem impertinent lauernden Blick. Dotto wurde wütend. „Aber ich habe Ihnen doch eben gesagt!“ schrie er, „daß ich auf mein Zimmer ging. Fragen Sie nur die Litti!“
Lester wehrte ab. „Kann später auch noch geschehen. War ja nur eine Frage. Nichts für ungut, Mister Dotto. — Was vermuten Sie nun, wo die Franelli noch hinfuhr?“
„Keine Ahnung, Herr Kommissar, — das heißt — hm — — vielleicht — — ja, da hatte sie doch ein Industrieller mal eingeladen, ein Mister Dunleight. Für den schien sie ein gewisses Interesse zu haben.“
Lester machte sich eine Notiz. „Dunleight“, wiederholte er, „wissen Sie, wo er wohnt?“
„Gar nicht weit. Zwölf Kilometer. In Shellingtown. Soll dort eine feudale Villa besitzen.“
„Hm. — Können Sie mir weitere Männer nennen, mit denen sie irgendwie in Beziehungen stand?“
Dotto überlegte. „Da war noch ein junger Mensch — das heißt, Mitte dreißig mag er auch schon gewesen sein, aber — — ich kenne weder den Namen, noch die Adresse. Und dann ein gewisser Lufter, Bildhauer, auch in Shellingtown wohnend. Der hat ihr einmal ein silbernes Zigarettenetui geschenkt.“
„Ich sehe“, erwiderte der Kommissar lächelnd, „Sie konnten sich über Konkurrenz nicht beklagen, Mister Dotto. Wem war, Ihrer Ansicht nach, Frau Franelli nun am meisten zugeneigt?“
„Absolut undurchschaubar, Herr Kommissar, diese Frau war eine Sphinx. Man konnte nicht klug aus ihr werden. Aber Sie können es sich wohl schon denken, — gerade das war die größte Anziehungskraft, die sie besaß. — Abgesehen davon, daß man sie mit Fug und Recht auch als eine Schönheit bezeichnen konnte.“
„Sonderbar“, sagte Lester und trommelte wiederum auf den Tisch, „haben Sie denn niemals versucht, sich von ihr klaren Wein einschenken zu lassen?“
Dotto lachte rauh auf. „Klaren Wein? Gut gesagt! Aus ihr war einfach nicht klug zu werden. Oft genug habe ich es ja versucht. Doch immer wieder entglitt sie mir — wie ein Aal.“
„Worunter Sie natürlich sehr gelitten haben!“
„Gelitten ist gar kein Ausdruck. Aber was soll das jetzt alles, Herr Kommissar! Wenn sie tot ist — —“
Dotto starrte düster vor sich hin. Kleine Schweißperlen sind auf seine Stirn getreten. Er atmete schwer ...
Lester fuhr nach Shellingtown. Dort suchte er zunächst Mister Dunleight auf. Die feudale Villa lag in einem riesigen Park, der einen äußerst gepflegten Eindruck machte. Eine marmorne Freitreppe führte zu dem Hause hinauf.
Mister Dunleight war ein blasierter, äußerst vornehm gekleideter Mann, etwa Mitte der Dreißig. Wie der Kommissar bereits ermittelt hatte, galt er als Erbe eines gewaltigen Industrie-Unternehmens. An Komfort fehlte es in der Villa nicht.
„Sie sind mit einer gewissen Mrs. Franelli befreundet?“ fargte der Kommissar gerade heraus.
Dunleight stritt es nicht ab. Doch er war sehr schockiert darüber, daß der Kommissar erschien und ihn befragte. Er machte einen äußerst nervösen Eindruck.
„Frau Franelli ist gestern Abend noch bei Ihnen gewesen?“ schlug der Kommissar auf den Busch.
„Nein, wieso?“ erwiderte Dunleight erbost, „wie kommen Sie überhaupt dazu, mich hier aufzusuchen und auszufragen? Ich sah die Frau seit drei Tagen nicht.“
Lester ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. „Sie wissen aber“, fuhr er unbeirrt fort, „daß die Dame noch mehrere Verehrer besaß?“
Der Fabrikant schlug wütend mit der Faust auf den Tisch. „Dämliche Frage! Was geht Sie das an?“
„Sehr viel“, erwiderte Lester, vollkommen ruhig bleibend, „es handelt sich um die Frage, wer als ihr Mörder in Frage kommt.“
Sein Gegenüber verfärbte sich. „Mörder?“ fuhr er hoch, „wollen Sie damit etwa behaupten — —?“
„Jawohl. Frau Franelli ist ermordet worden. Und meine Aufgabe ist es, der Angelegenheit auf den Grund zu gehen.“
Der Industrielle räusperte sich und wischte mit der Hand auf dem Tisch hin und her. „Und welcher Grund“, sagte er verhalten, „sollte für mich bestehen, die Frau ermordet zu haben?“
Der Kommissar blickte ihn forschend und durchdringend an. „Der häufigste Grund in solchen Fällen“, behauptete er, „ist die Eifersucht. Sie hat schon viel Unheil angerichtet.“
Dunleight lachte. „Eifersucht! Bei solchen Frauen das Blödsinnigste, auf das man sich einlassen kann.“
„Wie meinen Sie das? Bei solchen Frauen!“
„Nun — wenn Sie es noch nicht wissen sollten — Frauen, bei denen Treue ein unbekannter Begriff ist. Spielzeug!“
„Für Sie also auch nur Spielzeug, Mister Dunleight?“
„Wie Sie es nehmen wollen. Meinetwegen. Und nun lassen Sie mich bitte mit Ihren lächerlichen Verdächtigungen zufrieden!“
Lester verabschiedete sich hier mit dem Eindruck, an der verkehrten Stelle gewesen zu sein. Er entschuldigte sich und verließ die Villa, zumal ihm der Industrielle auch noch ein einwandfreies Alibi nachweisen konnte.
Anschließend suchte er den Bildhauer auf. Das war ein kleiner, gedrungener Mensch mit einer vollendeten Glatze. Er besaß in der Hauptstraße ein äußerst geschmackvolles Atelier, hinter einem gewaltigen Miethaus im Garten gelegen. Das ganze Dach bestand aus Glas, so daß in dem Raum eine blendende Lichtfülle herrschte.
Lufter sagte, nachdem sich Lester vorgestellt hatte: „Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, Herr Kommissar. Man hat von Ihnen schon allerlei gehört und gelesen. Für Berühmtheiten habe ich nun einmal eine gewisse Schwäche. Kommen Sie, um sich von mir modellieren zu lassen? Gar keine üble Figur! Man könnte Sie sogar als Apollo darstellen.“
„Danke“, erwiderte der Kommissar, vor Lachen prustend, „solche hochtrabenden Ambitionen habe ich nicht. Ich komme, wie Sie sich vielleicht auch schon denken können, in einer kriminellen Angelegenheit.“
„Puh!“ sagte der Bildhauer, das Gesicht mit den Händen verdeckend, „kriminell! Höchst unangenehm. Und wen soll ich umgebracht haben?“
„Ich bitte, die Angelegenheit nicht ins Lächerliche zu ziehen“, sagte der Kommissar, „es ist ernst genug. Sie kannten eine gewisse Frau Franelli?“
„Sehr gut sogar“, gab der Maler zur Antwort, „dort — bitte!“ Er deutete auf eine Plastik, „Venus im Bade!“
Lester starrte die Statue an. „Das also ist sie?“
„Jawohl. Ein fabelhaftes Weib, sage ich Ihnen! Sehen Sie sich doch nur den Körper an! Nichts daran auszusetzen. Eine wirkliche Venus.“
Lester mußte zugeben, selten eine so vollendete Figur gesehen zu haben.
„Sie sind also mit ihr befreundet gewesen?“ fragte er weiter.
„Zugegeben!“ sagte der Maler.
„Wie habe ich das zu verstehen?“ fragte der Kommissar weiter, „intim befreundet?“
Der Maler lachte. „So intim, wie Sie wollen!“
„Hm. — Sind Sie auch gestern Abend, beziehungsweise in der vergangenen Nacht mit ihr zusammengewesen?“ wollte der Kommissar jetzt wissen.
Der Maler schaute ihn ärgerlich an. „Mein Gott“, erwiderte er, „was geht Sie das eigentlich an, Kommissar? Sind Sie hierhergekommen, um in meinen Privatverhältnissen herumzuschnüffeln? Was führt Sie überhaupt zu mir? Daß es die Franelli betrifft, habe ich ja langsam begriffen. Hat sie was ausgefressen? Ich traue ihr allerdings alles mögliche zu.“
„Sie ist ermordet worden!“ sagte der Kommissar und ließ den Bildhauer dabei nicht aus den Augen.
Der zuckte merklich zusammen. Es gab ihm offensichtlich einen heftigen Stoß.
„Was sagen Sie?“ rief er, „ermordet? Und gestern in der Rialto-Bar war sie noch so vergnügt!“ Er fuhr sich bewegt mit der Hand über die Augen. „Wo ist sie ermordet worden? Von wem?“
„Wenn ich das wüßte, brauchte ich nicht erst lange zu forschen“, erwiderte Lester, „und wo? Es ist ein Autounfall vorgetäuscht worden. Sie sagten eben, daß Sie mit ihr gestern Abend zusammen waren!“
„Jawohl. Aber nicht allein. Ich hatte noch einen Freund bei mir, den ich um elf Uhr zur Bahn fahren mußte, so daß ich gezwungen war, frühzeitig aufzubrechen. Ich fuhr nicht noch einmal zur Bar zurück.“
„Hm. — In der Bar saß die Franelli an Ihrem Tisch?“
„Auch nicht immer. Nur eine Zeitlang. Sie wurde von dem Manager abberufen, da sie einen Solotanz einlegen sollte. Den konnten wir aber nicht mehr abwarten.“
„Hatten Sie mir ihr irgend eine Verabredung getroffen?“
„Nein. Aber sie kam manchmal noch nachts unerwartet zu mir herausgefahren.“
„Glauben Sie, daß sie gestern Abend auch diese Absicht hatte?“
Der Bildhauer zog die Schultern hoch. „Wie kann ich das wissen? Gesagt hat sie nichts, hat auch nichts angedeutet.“
Lesters Blick glitt an Lufter vorbei und blieb auf der ‚Venus im Bade‘ haften. Nach einer kleinen Pause erklärte er: „Inzwischen habe ich bereits feststellen können, daß Frau Franelli mit dem Vergeben ihrer Freundschäften recht freigebig war. Sie wurde, wie man mir sagte, von zahlreichen Männern umschwärmt. Das dürfte Ihnen wohl auch nicht entgangen sein.“
Lufter schob eine kleine Bronzefigur auf dem Tisch hin und her. Dann hob er wieder die Schultern hoch. „Mein Gott, ja“, erwiderte er, „allzu viel Treue kann man von einer solchen Frau nicht verlangen. Immerhin wußte sie auch Distanz zu halten, wo es darauf ankam.“
„So. Meinen Sie? Da Sie, wie Sie behaupten, mit ihr besonders befreundet waren, wissen Sie wohl auch über ihre privaten Verhältnisse etwas Bescheid?“
„Ich weiß nur, daß sie eine von ihrem Mann getrennte Italienerin war, die eine Tanzgruppe führte.“
„Und Dotto?“
„Wer ist das?“
„Ihr Manager.“
„Ach — Sie meinen Mister Anthony? In der Bar ist er jedenfalls nur unter diesem Namen bekannt. Eigentlich ist er gar kein Manager mehr. Das war früher einmal. Er ist, soviel ich weiß, Mitbesitzer der Bar und holt sich immer, das muß man ihm lassen, ausgezeichnete Kräfte heran. Doch die Franelli läßt ihn an ihrer Strippe tanzen.“
„Sie meinen —?“
„Er ist vernarrt in sie. Doch sie läßt ihn zappeln, wie sie mir selber einmal lachend erzählt hat. Seine Eifersucht, sagte sie, mache ihr das größte Vergnügen. Durch diese Taktik glaubte sie, das Engagement noch recht lange behalten zu können.“
„Lag ihr denn sehr daran?“
„Offenbar ja.“
„Und warum?“ fragte Lester interessiert, „etwa Ihretwegen, — um in Ihrer Nähe zu bleiben?“
„Vielleicht. Aber sie deutete mir auch einmal etwas von einer Aufgabe an, die sie hier zu erfüllen habe.“
Der Kommissar war erstaunt. „Eine Aufgabe?“ fragte er, „welcher Art?“
„Keine Ahnung, Herr Kommissar, darüber hat sie sieh unter keinen Umständen auslassen wollen.“
Lester machte sich eine Notiz und stellte noch viele Fragen. Besonders suchte er zu erfahren, wer jener jüngere Herr war, mit dem die Franelli in letzter Zeit öfter zusammensaß und über den Dotto ihm keine Auskunft hatte geben können. Doch weder Dunleight, noch der Bildhauer konnten ihm etwas Näheres sagen.
Der Kommissar kehrte nach Newark zurück, wo er in der Rialto-Bar noch mehrere Vernehmungen abhielt. Unter anderen fragte er auch die Litti sowie die Kellner aus. Irgend ein positiver Anhaltspunkt war jedoch nicht zu erhalten.
Kommissar Lester saß in seinem Büro und dachte über den Fall Franelli nach, als ein Kollege der daktyloskopischen Abteilung bei ihm eintrat. Er hielt ein Blatt in der Hand, das er vor den Kommissar auf den Tisch legte. Lester blickte ihn fragend an.
„Der Feuerteufel!“ sagte der Kollege bloß.
Es dauerte einen Augenblick, bis sich Lester besann. „Wie, bitte?“ rief er, „die Abdrücke von dem Kanister?“
„Ganz recht, Herr Kommissar. Selten klar und deutlich, — wie extra für uns abgedrückt. Es gibt gar keinen Zweifel mehr. Hier habe ich auch die Vorlage aus dem Archiv, damit Sie sich selbst überzeugen können.“ Mit diesen Worten legte er ein zweites Blatt neben das erste hin.
„Hm“, sagte Lester und strich nachdenklich seinem bronzenen Briefbeschwererlöwen über den Rücken, „dann wüßten wir also schon, wer der Täter war, oder höchstwahrscheinlich war — will ich lieber vorsichtig sagen. Der Feuerteufel! Merkwürdig! Sonst hat er sich doch immer nur mit Einbrüchen und Brandstiftungen befaßt. Das Motiv ist mir ganz unerklärlich. Welchen Grund hatte er, diese italienische Tänzerin umzubringen? Und daß er dann auch noch sozusagen seine Visitenkarte auf dem Kanister zurückläßt! Wenn ich mich recht besinne, hatte er in den letzten beiden Fällen doch mit Handschuhen gearbeitet, und nur aus der Art der Ausführung hatten wir schließen können, daß er es gewesen sein mußte.“
Der Kollege zuckte mit den Achseln. „Auch ich finde das merkwürdig“, sagte er, „ist die Dame beraubt worden?“
Lester horchte auf. „Beraubt?“ wiederholte er, „nein“. Jedenfalls trug sie noch zwei wertvolle Ringe an ihren Fingern. Auch die goldene Armbanduhr war noch vorhanden.“
„Wie?“ fragte der Kollege erstaunt, „und die sollte der Feuerteufel nicht an sich genommen haben?“
Lester stützte den Kopf in die Hände und starrte vor sich hin. „Sie haben recht“, sagte er, „wenn man darüber nachdenkt, wird der Fall immer rätselhafter.“
„Immerhin wieder mal etwas, woran Sie sich die Zähne ausbeißen können, Herr Kommissar!“
Lester legte die Hände wieder auf den Tisch und lächelte: „Pah — so leicht beiße ich mir keine Zähne aus. Zweifeln Sie etwa daran, daß ich auch diesen Fall restlos aufklären werde?“
„Keinen Augenblick, Herr Kommissar!“ erwiderte der andere, ebenfalls lächelnd. „Im übrigen lieben Sie ja gerade solche schwer durchschaubaren Fälle. Also ran an den Feind!“
Lester erhob sich. „Ja — ran an den Feind!“ wiederholte er und schaltete das Telefon ein, um sämtliche Bilder des Feuerteufels aus dem Archiv anzufordern.
Der Kollege empfahl sich mit der Bemerkung, daß er weiterhin gern zu Diensten stehe.
Mittlerweile trat Dix in das Zimmer, dem Lester die neuen Feststellungen sofort mit allen Einzelheiten erläuterte. Schließlich kam seine unvermeidliche Frage: „Nun, Dix — was halten Sie von der Sache?“
Der Kriminalsekretär puhlte nachdenklich an seiner Kinnwarze. Es fiel ihm offenbar schwer, sich über die Angelegenheit klar zu werden. „Wirklich seltsame Widersprüche“, sagte er schließlich, „ich meine die Fingerabdrücke auf dem Kanister, die doch gerade der Feuerteufel hätte vermeiden müssen — — und dann auch noch, daß er die Frau nicht beraubte ich — — finde einfach keine Erklärung dafür.“
„Sonderbar, ja, höchst merkwürdig“, sagte der Kommissar, „aber wir werden schon noch dahinterkommen, nicht wahr, Dix? Für uns ist bisher noch kein Rätsel unlösbar geblieben.“
„Sie wollten wohl sagen: für Sie, Herr Kommissar!“ erwiderte Dix bescheiden. „War es nicht übrigens auch der Feuerteufel, der neulich die kleine Privatbank in London aushob?“
„Sie irren, Dix. Er beraubte nur den Bankier höchst persönlich in seiner Wohnung, die er dann noch in Flammen aufgehen ließ. Nur wie durch ein Wunder hat dabei niemand sein Leben eingebüßt.“
„Richtig“, erwiderte Dix, „jetzt entsinne ich mich. Sie hatten doch noch den Feuerteufel in seinem Versteck aufspüren können — —“
„— woraufhin er verhaftet wurde. Ganz recht. Doch bevor er hierher gebracht werden konnte, war er schon ausgebrochen — — und seitdem ist er spurlos verschwunden, bis wir nun wiederum diesen Beweis erhielten, daß er sein unheilvolles Leben immer noch weiterführt.“
„Wirklich ein höchst gefährlicher Bursche, Herr Kommissar; das kann man wohl sagen.“
„Ich möchte Ihnen empfehlen, Dix“, sagte Lester, „in der Londoner Unterwelt wieder mal nach ihm Umschau zu halten. — Ah! Da kommen die Bilder ja.“ Er nahm einem Beamten die Mappe ab, der sie gerade hereinbrachte. Auch die genaue Personal- und Lebensbeschreibung des Verbrechers war beigegeben. „Hier“, fuhr der Kommissar fort, „können Sie alles gleich noch mal durchlesen. Und sehen Sie sich einmal diese Physiognomie an — diese brutalen Züge mit dem verschlagenen, lauernden Blick! Wenn man sich das betrachtet, weiß man sofort, mit was für einem Menschen man es zu tun hat. Wenn ich nicht irre, war der Kerl mal Artist, und zwar Feuerfresser, — woher er wohl auch seinen Spitznamen in der Unterwelt hat. Sein richtiger Name ist Robert Strong. Wenn Sie jetzt nach ihm forschen, werden Sie wohl am besten tun, sich zunächst einmal an die Harmonika-Anny heranzumachen, mit der er, soweit ich mich recht besinne, befreundet war. Solche Weiber behalten ihre ehemaligen Liebhaber meistens im Blickfeld. Von ihr werden Sie vielleicht einen ersten Hinweis erhalten können. — Doch ich brauche Ihnen nicht viel zu sagen. In solchen Dingen wissen Sie ja Bescheid.“
Dix las sich die Akten durch und prägte sich auch die Züge des Menschen noch einmal ganz genau ein, bevor er sich auf den Weg machte, um für eine ganze Nacht in der Verbrecherwelt Londons unterzutauchen.
Inzwischen sorgte Lester dafür, daß auch in allen Städten nach dem Feuerteufel gefahndet wurde. Anschließend steckte er sich zwei Aufnahmen in die Tasche und fuhr damit wieder nach Newark hinaus.
Der ‚Zigeunerkeller‘ machte nach außen hin einen achtbaren Eindruck. Auch wenn man die zehn Stufen hinuntergestiegen war und das Lokal betrat, kam man durchaus nicht sogleich auf den Gedanken, in eine Verbrecherkneipe geraten zu sein. Vielleicht lag es daran, daß sich hier vorwiegend diejenigen Unterweltler ein Stelldichein gaben, die nach außen hin den soliden Bürger zu spielen pflegten.