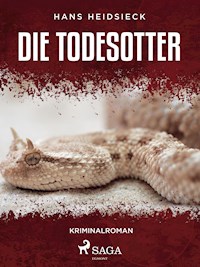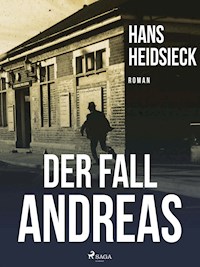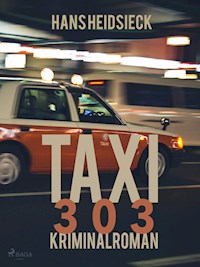Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman, geschrieben von dem durch zahlreiche Romane bekannten Autor Harry Hoff, ist kein Gangster- und Kriminal-Roman von Revolverschüssen und Toten, sondern so stilistisch aufgebaut, dass der Leser nicht durch Schüsse, sondern durch Spannung bis zum Ende des Romans gefesselt wird. Auf dem Passagierdampfer "Patria" verschwinden durch eine gut geleitete Bande namhafte Menschen. Scotland Yard wird eingeschaltet und in verblüffender sachlicher Kleinarbeit wird dem Komplott das Ende bereitet. Die lebendigen Mittel der Darstellung zeigen, dass der Autor Harry Hoff einer der talentiertesten Kriminalschriftsteller seiner Zeit ist.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Mann über Bord
Kriminalroman
Saga
Mann über Bord
© 1955 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508480
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Das Fest auf der „Patria“ ging seinem Höhepunkt zu. Gleichzeitig war es der „Abschiedsabend“. Morgen in aller Frühe würde man schon in Southampton sein.
„Und wer ist die blonde Schönheit, die dort drüben mit dem eleganten Dandy tanzt?“ fragte Mr. Kinsley den Bord-Detektiv Williams.
„Ach — die Blonde?“ erwiderte Williams, „das ist die Tochter des schwedischen Zündholzkönigs, den ich hier besonders beobachten muß. Die Eltern von Fräulein Christiansen sitzen dort drüben rechts an dem Tisch neben dem Pfeiler.“
„Sehen auch beide sehr gut aus, die Eltern“, bemerkte Kinsley, „unschön finde ich nur, daß sich die Frau gleich einen ganzen Juwelierladen um den Hals gehängt hat.“
„Finde ich auch. Der Tänzer ist der Sohn eines amerikanischen Advokaten. Er hat schon während der ganzen Fahrt versucht sich an das Mädchen heranzumachen. Aber sie tanzt nur aus Anstand mit ihm, um ihn nicht all zu sehr vor den Kopf zu stoßen, — vielleicht auch aus Ärger darüber, daß Mr. Palmer zu diesem Fest nicht erschienen ist.“
Kinsley wünschte zu wissen, wer Palmer sei.
Kinsley hatte sich auch heute erst seinem Kollegen Williams zu erkennen gegeben. Laut Passagierliste stellte er einen Kaufmann Theodor Kelly aus Chikago dar. Es war ihm um Ruhe zu tun gewesen — nach den wilden Verbrecherjagden, die in New York nicht mehr abreißen wollten. Er durfte sich rühmen, einer der bekanntesten Kommissare in den Staaten zu sein. Jetzt aber reist er einmal privat — es ist seine Urlaubsreise, die ihn nach England führt, wo er in London seinen Bruder besuchen will.
„Palmer?“ erwiderte der Borddetektiv, „ist ein junger Auto-Ingenieur aus Detroit, der Verwandte in Deutschland besuchen will.“
„Warum kommt der Mann nicht zum Bordfest?“
William hob die Schultern. „Mein Gott“, erwiderte er, fast ärgerlich, „wie soll ich das wissen? Vielleicht ist er krank — oder er liebt solche Veranstaltungen nicht —“
„Aber erlauben Sie — wenn er doch hinter dem Fräulein her ist —! Finden Sie das nicht merkwürdig?“
„Nein — wieso? Vielleicht sagt er sich auch, daß es doch keinen Zweck hat, sich am letzten Abend das Herz noch schwer zu machen, wenn man sich, und wahrscheinlich für immer, ade sagen muß.“
„Hm. Hm.“ Kinsley schob sein Sektglas nachdenklich hin und her und starrte in den Rauch seiner Zigarette. „Ich glaube, hier stimmt etwas nicht.“
„Wieso stimmt etwas nicht?“ fragte Williams verwundert, „Sie machen mir Spaß, Mr. Kinsley! Was soll hier nicht stimmen? Wenn es Sie wirklich so interessiert, warum Mr. Palmer nicht kommt, können Sie ja nach ihm Umschau halten und ihn befragen. Kabine 34. Vielleicht treffen Sie ihn dort an.“
Kinsley erhob sich. In seinem Blick lag ein eigentümlicher Glanz. „Wahrhaftig“, erwiderte er, „das werde ich tun!“
*
John Kinsley nennt sich selber einen Idioten. Da schleicht er nun, statt sich weiter an dem fröhlichen Fest zu freuen, durch die verschiedensten Gänge und Stockwerke dieses Reisedampfers, um — ja, nur, um einem verrückten Gedanken nachzugehen. Palmer hätte Gelegenheit, ausgiebig mit der von ihm verehrten schönen Schwedin zu flirten. Warum tut er es nicht? Bei Kommissar Kinsley entsteht aus solchen Unerklärlichkeiten immer leicht ein Verdacht. Dieser Gedankenkomplex verwebt sich mit meinem anderen, und dieser andere heißt: In letzter Zeit sind auf Schiffen des öfteren Menschen spurlos verschwunden.
Er weiß noch nicht, was er sagen wird, wenn er in die Kabine tritt und Palmer tatsächlich anwesend ist. Endlich steht er davor, klopft an und horcht. Nichts rührte sich. Der Kommissar drückt auf die Klinke, öffnet die Tür und tritt ein. Knipst die Deckenbeleuchtung an. Eine mustergültige Ordnung herrscht in dem kleinen, behaglich ausgestatteten Raum.
Das Bullauge ist geöffnet. Draußen hört man das Rauschen der See. Draußen ist schwarze Nacht.
Nein — hier ist nichts Auffälliges zu entdecken. Kinsley verläßt die Kabine.
Weiter nach Palmer suchen? — denkt Kinsley — aber ich kenne ihn ja noch gar nicht. Vielleicht bin ich schon in den Gängen an ihm vorbeigelaufen. Wahrscheinlich steckt er in irgend einem der zahlreichen Gesellschaftsräumen. Zum Teufel auch — was geht das mich an!
*
Southampton! Die ersten Passagiere werden schon ausgebootet. Es ist ein grauer, grämlicher Morgen.
Kinsley macht keine Anstalten, das Schiff zu verlassen. Er ist erregt, — doch merkt man ihm diese Erregung nicht an. Warum bleibt er — was hält ihn noch — da er in diesem Falle doch nur ein harmloser Privatreisender ist —? Um zwei Uhr ist das Fest erst zu Ende gewesen. Er hatte nur zwei, drei Stunden in einem Sessel verdöst. Um fünf Uhr steht er schon wieder vor der Kabine 34. Er klopft. Nichts rührt sich. Ein stärkeres Klopfen. Noch immer nichts. Der Kommissar drückt die Klinke herunter — wieder ist der Raum unverschlossen. Das Licht flammt auf. Alles genau so, wie es noch vor ein paar Stunden war.
Kinsley begibt sich zum Borddetektiv. „Palmer wird irgendwo anders geschlafen haben“, meint der und reibt sich die Augen.
„Ich würde doch einmal Umschau halten“, schlägt Kinsley vor. „Leider kenne ich den Mann nicht; sonst hätte ich das schon getan!“
„Das können Sie getrost mir überlassen“, sagte Williams ärgerlich, „wenn Sie übrigens noch den ersten Zug nach London erreichen wollen —“
Der Kommissar legte Williams eine Hand auf die Schulter und lächelte. „Ist es Ihnen wirklich so eilig, mich loszuwerden?“
„Ich bitte Sie, mich zu entschuldigen!“ sagte der Borddetektiv und eilte davon.
Inzwischen ist Mr. Williams zur Kabine 34 gegangen, die er, wie Kinsley ja schon berichtete, leer fand. Der Steward erklärt auf Befragen, Mr. Palmer am gestrigen Abend gegen neun Uhr zum letztenmal gesehen zu haben.
Der Detektiv zuckte zusammen. „Suchen Sie nach dem Herrn!“ sagte er zu dem Steward, „sehen Sie mal im Lesezimmer und in den Salons nach. Ich werde auf den einzelnen Decks nach ihm Umschau halten.“ Der Steward erklärte mürrisch, daß er im Augenblick nicht abkommen könne.
Unruhig stöberte Williams die in Frage kommenden Räume durch. Sie lagen still und verödet da. Von Mr. Palmer keine Spur.
Trotzdem glaubt Mr. Williams, daß jener doch irgendwie irgendwo wieder auftauchen wird. Wenn sämtliche Passagiere den Dampfer verlassen haben, wird es sich ja herausstellen.
Drei Stunden später ist es so weit. Kommissar Kinsley befindet sich immer noch auf dem Schiff. Er legt Williams schwer seine Hand auf die Schulter. „Nun —?“
Williams macht einen ratlosen Eindruck. Das Schiff, meint er, müsse nun systematisch durchsucht werden. Der Kapitän läßt die nötigen Anordnungen dazu ergehen. Er überzeugt sich in der Kabine 34, von Kinsley geleitet, persönlich davon, daß hier alle Sachen noch auf ihren Besitzer warten. „Was halten Sie davon, Mr. Kinsley?“
„Wahrscheinlich“, erwiderte der Kommissar ruhig mit einem Achselzucken, „ist der Mann über Bord gegangen.“
„Eine höchst peinliche Sache! Was meinen Sie, Kommissar — Unfall oder Verbrechen?“
„Von Berufs wegen“, antwortet Kinsley, „bin ich geneigt, an ein Verbrechen zu denken. Aber natürlich ist auch ein Unfall nicht ausgeschlossen. Wenn man freilich bedenkt, daß sich gerade in letzter Zeit zwei ganz ähnliche Fälle ereignet haben — Sie haben doch gewiß auch davon gehört, Kapitän?“
„Selbstverständlich. Zwei vollkommen mysteriöse Fälle. Nichts deutete auf ein Verbrechen hin.“
„Richtig“, erwiderte Kinsley, „ich habe auf Anordnung meiner Behörde die Akten studiert. In dem einen Fall ist ein Selbstmord naheliegend, da der Betreffende an der Börse gerade sehr starke Verluste erlitten hatte. Die offizielle Erklärung des zweiten Falles sucht einen Unfall glaubhaft zu machen. Mir aber sind sie beide verdächtig geblieben. Und nun hier auf Ihrem Schiff —“
„Ja, ausgerechnet mir muß das nun auch noch passieren!“ stöhnte der Kapitän, „es sollte mich gar nicht wundern, wenn Seereisen dem Publikum allmählich anrüchig würden! Aber schließlich kann man nicht hinter jeden Passagier einen Beobachter stellen!“
„Nein, das kann man nicht“, gab der Kommissar zu, „doch beruhigen Sie sich, Kapitän. Wenn es sich um Verbrechen handelt, werden sich diese auch aufklären lassen.“
*
Die von dem Borddetektiv geleitete Suchaktion blieb ohne Erfolg. Nirgends war eine Spur des Vermißten zu finden. Man nahm daraufhin seine Kabine noch einmal genauestens in Augenschein. Auch hier kein Hinweis, was mit dem Verschwundenen geschehen sein könnte. Die Sachen wurden in Gegenwart des Detektivs gewissenhaft vom Zahlmeister aufgenommen und notiert. Ein Steward verpackte sie dann in die beiden vorhandenen Koffer, die man in der Wohnung des Kapitäns sicherstellte.
Nun blieb weiter nichts mehr übrig, als zwei Funksprüche aufzugeben, einen an die Reederei in New York und einen weiteren an die dortige Polizei. Die Sprüche besagten lediglich, daß der Passagier Robert Palmer bei Ankunft in Southampton vermißt worden und wahrscheinlich verunglückt sei.
Als der Inspektor Dixon, der die Vermißtenzentrale unter sich hatte, die Nachricht las, wurde er stutzig und schüttelte bedenklich den Kopf. Das war nun in kurzer Zeit hintereinander schon der dritte Fall dieser Art. Bei dem zweiten hatte er bereits einige Bedenken gehabt, die sich nunmehr zu einem Verdacht verdichteten. Irgend etwas stimmte da nicht — wenn auch alle Untersuchungsergebnisse negativ waren.
Nun aber mußte man die Sache doch in die Hand nehmen. Der gegebene Mann dazu war Kommissar Kinsley. Doch Kinsley war fort.
Dixon hatte seinem Kollegen die beiden ersten Fälle gezeigt. Er hatte mit dem Kommissar auch schon eingehend darüber gesprochen. Beiden kamen bei dieser Besprechung bereits Bedenken, sie hatten jedoch auf Grund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse nicht den geringsten Anlaß zur Annahme eines Verbrechens entdecken können.
Dixon rief sich die beiden Fälle noch einmal ins Gedächtnis zurück ...
*
Am 4. August war der Passagierdampfer „Washington“ von New York aus nach Neapel in See gestochen. Unter den Reisenden befand sich auch der Filmagent Benito Ceventi, ein Junggeselle in den dreißiger Jahren, der vor acht Jahren nach USA auswanderte, weil er sich dort bessere Geschäfte versprach. Er konnte mit seinen Erfolgen auch recht zufrieden sein — aber die Sehnsucht nach seiner Heimat Italien hatte ihn nie ganz verlassen. Nun hatte er die traurige Nachricht erhalten, daß plötzlich sein Vater gestorben war, der eine Kunstseidenfabrik in Turin besaß. Jetzt sollte Benito sie übernehmen, da sein einziger, völlig gelähmter Bruder dazu nicht imstande war.
Zwei Tage vor seiner Abreise ließ er sich auf Anraten eines guten Bekannten noch in New York auf eine größere Börsenspekulation ein, bei der er den größten Teil seiner Ersparnisse einsetzte. Während der Reise erreichte ihn auf dem Schiff ein Radiotelegramm seiner Bank, daß fast alles verloren sei. Auf diese Tatsache stützte sich später die These von seinem Selbstmord, als er verschwunden war. Zufällig war er gerade in dem Augenblick zum letztenmal gesehen worden, als er das Radiotelegramm empfing. Davon berichtete ein junger amerikanischer Schauspieler, der als Zeuge vernommen wurde. „Er hatte schon vorher einen recht niedergeschlagenen Eindruck auf mich gemacht“, erklärte der Zeuge, „ich führte das darauf zurück, daß, wie er mir gleich zu Anfang der Reise berichtete, sein Vater gestorben war. Als er das Radiotelegramm erhielt und gelesen hatte, wurde er kreideblaß und sagte: ‚Nun habe ich all die Jahre umsonst gespart!‘ —“
Nach diesen Worten war, wie der Zeuge weiter erklärte, Ceventi stillschweigend und verbissen davongegangen, — und seitdem wurde er nicht mehr gesehen.
*
Der zweite Fall geschah auf dem Dampfer „Viktoria“, der am 27. September nach Australien abfuhr. Auf ihm befand sich unter anderen auch Mrs. Ellinor Turner, die Witwe eines in Chikago verstorbenen Buchmachers, die für immer zu ihrer in Melbourne verheirateten Schwester zu ziehen gedachte.
Mrs. Turner war ein freundliches, aufgeschlossenes Wesen, teilte ihre Kabine mit einer jungen Engländerin, die als Journalistin einen Trip kreuz und quer durch die Welt machte, und mit der sie sich immer gern unterhielt. Während der Mahlzeit saßen die beiden Damen stets nebeneinander, — die Engländerin zu Mrs. Turners Rechten. Links von ihr hatte sich ein amerikanischer Missionar seinen Platz gesichert, der von einem längeren Urlaub in den Australischen Busch zurückkehrte.
Am gleichen Tisch saßen noch eine Miß Rhodes, sowie zwei Herren, von denen sich einer als Mr. Brown und der andere als Mr. Rarik vorgestellt hatte. Während sich Rarik stets gern und lebhaft mit der Journalistin und auch mit Mrs. Rhodes unterhielt, wandte Brown seine ganze Aufmerksamkeit Miß Rhodes zu, die ein auffallend hübsches Mädchen war. Er stand ihr bei allen Wettkämpfen und Bordspielen treu zur Seite und wurde bald fast nur noch mit ihr zusammen gesehen. Mrs. Turner beobachtete diesen Flirt mit großem Vergnügen, — suchte jedoch immer wieder vergeblich dahinter zu kommen, was eigentlich die junge Dame an Mrs. Brown so anziehend fand, daß sie sich in geradezu auffallender Weise von ihm den Hof machen ließ. Um so mehr wunderte sie sich, als er sie eines Tages ansprach, um sie, wie er erklärte, um ihren Rat zu bitten.
Es war an einem sehr heißen Tage, kurz nach dem Abendessen. Mrs. Turner hatte am Tisch bereits angedeutet, daß sie sich später an Deck in der Nachtkühle etwas zu erfrischen gedenke, und forderte die Engländerin auf, ihr dabei Gesellschaft zu leisten. Die Journalistin war jedoch schon mit einem Kollegen verabredet, und Mrs. Turner begab sich allein an das Oberdeck.
Hier stand Brown plötzlich neben ihr und trug ihr sein Anliegen vor. „Sie machen einen so vertrauenswürdigen Eindruck, Mrs. Turner“, schmeichelte er, — „kurzum, es handelt sich um Miß Rhodes — doch kommen Sie, bitte, mit mir ans Heck; dort stört uns niemand, — ich möchte nicht, daß wir bei dieser diskreten Sache belauscht werden.“
„Oh — ist es tatsächlich so etwas Geheimnisvolles?“ sagte Mrs. Turner, „aber natürlich können wir bis zum Heck gehen. Vielleicht ist es da auch noch etwas kühler. Die Hitze unten war ja kaum auszuhalten — trotz aller Ventilation!“
„Ja, ja“, sagte Brown, „man merkt es sehr, daß wir uns in den Tropen befinden.“
Frau Turner blieb stehen und deutete in die Ferne. „Sehen Sie dort den Streifen? Das sieht ja wie Land aus!“
Bevor sie ihn weiter fragen konnte, was er ihr nun eigentlich anzuvertrauen habe, verspürte sie plötzlich einen gewaltigen Stoß — und im nächsten Augenblick wirbelte ihr Körper über die Reling zu den Haien hinunter, die sich gleich um die Beute rauften.
*
Inspektor Dixon ließ sich über den Transatlantischen Polizeifunk mit Kommissar Kinsley bei dessen Bruder in London verbinden.
„Es ist mir höchst unangenehm, Kinsley“, begann Dixon, „daß ich Sie während des Urlaubs mit einer dienstlichen Frage behelligen muß.“
„Mir auch!“ gab der Kommissar trocken zurück. Einen Augenblick schwieg der Inspektor verdutzt. Dann lachte er etwas gezwungen und fuhr fort: „Es handelt sich um die Unfälle auf den Schiffen, Kinsley. Wir haben darüber ja schon gesprochen — und nun auf der ‚Patria‘ wieder — Sie sind doch auch mit diesem Dampfer gefahren. Ich nehme wohl richtig an, daß Sie die Untersuchung geleitet haben.“
„Nein.“
„Wieso nein? Ich dachte —“
„Ich dachte auch, Herr Inspektor, — ich dachte nämlich an Ihre letzten Worte, als ich mich von Ihnen verabschiedete. Sie gaben mir sozusagen den dienstlichen Befehl, einmal 14 Tage lang vollkommen auszuschalten und auf alle dienstlichen Belange zu pfeifen.“
„Sie haben sich also um den Fall nicht gekümmert?“
„Nein, — jedenfalls dienstlich nicht, um Ihrem Befehl nicht entgegenzuhandeln. Ich blieb allerdings auf dem Schiff, bis die Untersuchung beendet war, die, wie ich nicht anders erwartete, ohne Ergebnis verlaufen ist.“
„Aber Kinsley — wir sind uns doch einig, daß hier etwas Besonderes vorliegen muß!?“
„Nehme ich auch immer noch an, Herr Inspektor. Aber wenn wir da etwas herauskriegen wollen, müssen wir an die Wurzeln gehen. Es wird nötig sein, die Herkunft und die Verhältnisse der Verunglückten — oder soll ich schon ‚der Ermordeten‘ sagen? — genau zu durchforschen. Das ist bisher wahrscheinlich viel zu oberflächlich geschehen.“
„Kinsley, ich wollte Sie bitten, da Sie nun schon da drüben in Europa sind, vielleicht einmal einen Ausflug nach Turin zu machen, beziehungsweise Ihre Rückreise über Italien zu verlegen.“
„Verstehe schon“, erwiderte Kinsley, ein wenig brummig, „Fall Ceventi. Wird gemacht, Herr Inspektor.
*
„Baby — ich komme mir vor wie ein Bratfisch!“
„Wieso?“
„Weil mir die Sonne so auf den Buckel scheint! Ach du — es ist doch zu schön, daß wir uns hier sozusagen mitten im Winter in Miami-Beach am Strand aalen können. Diese Hitze noch im Oktober! Baby — du bist wirklich das patenteste Mädel der Welt! Durch dich ist das doch alles nur möglich geworden. Ich weiß garnicht, wir ich dir danken soll!“
„Rede doch keinen Unsinn, Ralf!“ erwiderte das gut gewachsene hübsche Mädchen im Bikini, das vor dem jungen Mann im Sande herumtänzelte, „Danken! Es ist doch alles nur ein glattes Geschäft. Ein kleiner Vorschuß auf das große Geschäft, das du machst, wenn die alte Dame in Philadelphia die Augen schließt.“
Ja — die alte Dame in Philadelphia. Ralf haßte sie, weil sie nicht sterben wollte. Wie lange sollte er noch auf die anderthalb Millionen warten, die sie ihm hinterlassen würde?
Ach — und nun mußte er ihr gegenüber auch noch obendrei immer schön tun. Tante Mary vorn, Tante Mary hinten — „natürlich liege ich meinem Studium energisch ob, Tante Mary. Täglich besuche ich gewissenhaft meine Kollegs! Soll mich der Teufel holen, wenn ich als Arzt nicht später eine Kapazität werde. Nur meinen Monatswechsel, Tante Mary — den könntest du mir doch wohl noch ein wenig erhöhen!“
Nein — sie blieb hart, die Alte. Die war durch nichts zu erschüttern. Dabei hätte sie ihn in Gold einrahmen können! Aber so sind nun einmal die reichen Leute — sie sparen immer am falschen Fleck!
Ralf biß vor Wut die Zähne zusammen. Daß er auf seine Erbschaft hin bei dem Geldverleiher Levinson schon 18 000 Dollar gegen Wucherzinsen aufgenommen hatte, wagte er nicht zu sagen.
Inzwischen ist er ja allerdings diese Schuld wieder losgeworden. Auch das hatte er nur Baby zu danken. Sie war ihm eines Tages wie ein rettender Engel erschienen. Es war in New York — am Brodway, in einem Lokal. Dort saß sie an einem der Nebentische, — ihr zur Seite ein Herr in den mittleren Jahren, der recht gut aussah. Zufällig begegneten sich ihre Blicke, und sowohl Ralf, wie Kitty zuckten unwillkürlich zusammen. Als sie dann mit dem Herrn das Lokal verließ, flüsterte sie Ralf im Vorbeigehen zu, daß er warten solle, — sie komme gleich wieder.
Und wirklich — sie kam, setzte sich zu ihm und tat so, als ob sie seit Urzeiten schon alte Bekannte wären.
„Wer war der Herr, mit dem du zusammensaßest?“ wagte er später zu fragen.
„Mein Chef!“ erwiderte sie und blickte ihn freimütig an.
„Hm — und was für Geschäfte betreibt er —?“
„Danach sollst du nicht fragen, Ralf! Du darfst mich überhaupt nichts mehr fragen. Ich liebe dich so, wie du bist — und ebenso wünsche ich von dir auch geliebt zu werden.“
Er lächelte sie betreten an. „Und wie — wie denkst du dir das in Zukunft? In deinen Augen bin ich bestimmt nur ein armer Student, — wenn ich auch später einmal sehr reich sein werde.“
Freimütig sprach er von seiner Tante, und was er von dieser einst zu erwarten hatte.
„Dann machen wir es doch so“, schlug sie vor, „daß ich dir vorstrecke, was du mir später wiedergibst. Zunächst einmal mußt du von dem Wucherer freikommen. Morgen bezahle ich dort deine Schuld.“
Ralf war verblüfft. „Wie — du willst — —?“
Ja, sie tat es, — wahrhaftig, sie tat es! „Und nun“, sagte sie dann, ohne mit einer Wimper zu zucken, „ja, nun werden wir uns in Florida von dem Schrekken erholen!“
*
Kommissar Kinsley wurde in ein vornehm ausgestattetes Zimmer geführt.
Bald öffnete sich eine Flügeltür, und Cesare Ceventi, der Bruder des auf der ‚Washington‘ verschwundenen Passagiers, wurde in einem Rollstuhl hereingefahren.
„Wie ich höre, kommen Sie aus New York, Herr Kommissar?“ sagte Ceventi mit brüchiger Stimme, „werde ich etwas über meinen Bruder erfahren?“
„Ich war jetzt 14 Tage in London“, erwiderte Kinsley, „und eigentlich ist es umgekehrt, — daß ich von Ihnen etwas über Ihren Herrn Bruder erfahren möchte.“
„Deshalb kommen Sie extra hierher nach Turin? Mein Gott — was könnte ich Ihnen schon sagen? Wir hatten uns so gefreut, daß Benito nun nach dem Tode des Vaters die Fabrik übernehmen würde! Ich kann es doch nicht. Wie Sie sehen, bin ich vollkommen gelähmt, — kaum ‚daß ich die Hände noch etwas bewegen kann. — Glauben Sie wirklich an einen Selbstmord?“
„Inzwischen“, erwidert Kinsley, „erfuhr ich, daß er als Miterbe und als Leiter Ihrer Fabrik ein glänzendes Einkommen haben würde. Deshalb erscheint mir die Selbstmordthese jetzt wieder recht unwahrscheinlich.“
„Kurzum: Sie glauben auch an ein Verbrechen!?“
„Auch?“ wiederholte der Kommissar, „tun Sie das denn?“