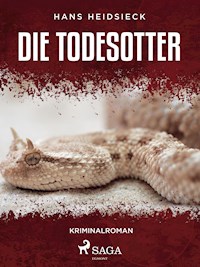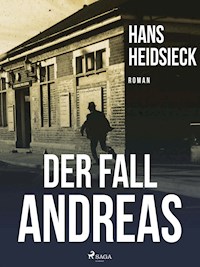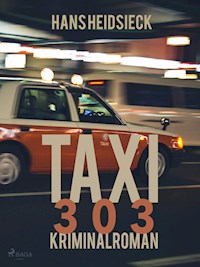Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch, dessen Handlung in Österreich, Deutschland und den USA spielt, schildert Heidsieck in der ihm ganz eigenen, anschaulichen Weise den Lebens- und Liebesweg eines jungen Mädchens. Doris Höffner, als Waise bei ihrem Onkel in Graz lebend, muss ihr bisheriges Heim verlassen. Sie folgt dabei einer verlorenen Melodie, die sie einmal im Radio gehört hat. Auf abenteuerliche Weise kommt sie endlich auch mit dem Mann zusammen, in dessen Stimme sie sich einst verliebt hatte –während der sie aufrichtig verehrende Ingenieur Siewers mit ansehen muss, wie sie ihrem Phantom, dem Sänger und Musiker Wendtland nachjagt.Und dann gestaltet sich für Doris alles ganz anders, als sie erwartet hatte, und sie erkennt, dass das Glück sich manchmal nicht dort versteckt, wo man es erwartet ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Die verlorene Melodie
Frauenroman
Saga
Die verlorene Melodie
German
© 1938 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508091
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Der große Schäferhund, der bisher in die Sonne blinzelnd die Gartenpforte der Höffnerschen Villa behütet hatte, spitzte die Ohren. Was war das nur für ein fröhliches Liedchen, das ihm Doris da immerfort vorsang?
Wenn er auch die Geräusche, die von den Menschen Musik genannt wurden, an sich garnicht leiden mochte, so wußte er doch die vergnügte Stimmung des jungen Mädchens zu schätzen und freute sich, als sie zu ihm herantrat, um ihm den Kopf zu kraulen. Er hatte wohl auch einer Auffrischung jener düsteren Stimmung bedurft, die sich, wie immer, vom ‚Herrchen’ auf ihn übertragen wollte. Mit ‚Herrchen‘ — das war der Rechtsanwalt Dr. Höffner — stimmte schon tagelang etwas nicht. Die Menschen seiner Umgebung hatten dies wohl überhaupt bis jetzt garnicht bemerkt; denn der Doktor wußte sich sehr zu beherrschen. Er aber, das ‚treue Hundevieh’, witterte so was sofort und hätte den guten Mann gerne getröstet, wenn das nur möglich gewesen wäre. Die stummen Blicke treuer Ergebenheit taten es allein nicht.
Was mochte das nur für ein Fremder sein, der jetzt öfter kam, um mit Höffner geheime Besprechungen abzuhalten? Eigentlich sah der Fremde recht gut aus, ein schlechter Mensch war er gewiss nicht; aber er hatte so etwas Besorgtes, Vergrämtes in seinen Zügen, und scharfe Falten zeichneten sich auf seiner Stirn ab.
Auch der Rechtsanwalt machte, wenn er mit jenem allein war, ein sorgenvolles Gesicht, über das oft ein Zucken ging, wie aus Angst oder Verlegenheit. Was bedeutete das?
Doris hatte genug gekrault. Sie erhob sich aus ihrer Hockstellung wieder und summte ihr Liedchen weiter, während sie durch den Laubengang schritt, der sich am Hause entlang zog. Lux folgte ihr.
Aus dem hinteren Küchengang trat eine Frau auf sie zu. „Nun, so vergnügt, Fräulein Doris?“
„Ja, so vergnügt! Haben sie etwas dagegen, Mathilde?“
„Nein, aber — — verzeihen Sie, Fräulein Doris — — wissen Sie schon, daß ihr Herr Onkel der Reserl gekündigt hat?“
„Was? Der Reserl, dem Zweitmädchen?“ fragte Doris verblüfft, „ja warum denn?“
„Er meinte, daß ich und die Fanny den Haushalt alleine versorgen könnten, solange die gnädige Frau noch im Sanatorium sei, na und für die Kinder wären Sie schließlich auch noch da.“
„Merkwürdig!“ Doris zupfte an ihrem Gürtel und blickte zu Boden. Dann fragte sie: „Ist der Fremde noch bei ihm?“
„Ja, immer noch“, gab Mathilde zur Antwort, „sie haben sich eingeschlossen. Als ich vorhin etwas fragen wollte, wurde ich garnicht hereingelassen.“
Doris trat in die Küche und warf einen Blick auf die Uhr. In einer halben Stunde kamen die Kinder aus der Schule zurück. Sie wollte ihnen entgegen gehen. Irgendwie mußte sie sich jetzt zerstreuen.
Langsam, nachdenklich wanderte sie durch den Laubengang wieder zum Tor zurück. „Hallo, Lux!“ rief sie, „darfst mitkommen!“
Aber sie sang nicht mehr.
Der Rechtsanwalt stand vorm Fenster und hielt die Arme über der Brust verschränkt. Man sah ihm an, daß er sich künstlich zur Ruhe zwang. Sein Besucher hatte sich in einem großen Klubsessel niedergelassen. Er saugte an einer Zigarre und blickte den Rauchringen nach, die er dabei in die Luft blies. „Ja ja, mein Lieber!“ bemerkte er, seiner Stimme absichtlich einen beruhigend-freundlichen Klang verleihend, „es steht schlimm um Sie! Hätten Sie sich doch in diese unseligen Spekulationen nicht eingelassen! Nun ist es zu spät. Sie hätten mich eher um Rat fragen sollen. Natürlich verstehe ich Ihre Gründe, die Sie zu solchem Handeln getrieben haben. Es hätte ja schließlich auch gut gehen können — —“
„Mein Vetter sagte“, unterbrach Höffner, „es wäre eine totsichere Sache. Nun hat er nur noch ein Achselzucken. Ich hasse ihn!“
„Damit ist Ihnen auch nicht geholfen. Sie tun ihm Unrecht. Er meinte es gewiß gut mit Ihnen, — nur, daß er sich eben selber verrechnet hat. Sein Bankgeschäft ist nur klein. Vielleicht war er falsch unterrichtet.“
Um Höffners Mund lag ein scharfer Zug. „Nein — er ist ein Betrüger!“ behauptete er, „er hat sich nur selber an dieser Geschichte bereichern wollen.“
„Mit solchen Behauptungen soll man vorsichtig sein!“ warnte Höffners Besucher, „und schließlich würde das an der Sachlage doch nichts mehr ändern. — Sie nahmen eigens zum Zweck dieser Spekulationen die Hypothek auf?“
„Ja, vierzigtausend. Nun sind sie hin. Dazu noch das Guthaben, das ich bei Ihnen erhob, Herr Bankier!“
„Also weitere zwanzig. Hm. Und die Gläubiger drängen, sagten Sie schon?“
„Ja.“ Höffner eilte zum Schreibtisch, nahm einen Bogen, reichte ihn dem Bankier: „hier, das Schlimmste: die Rechnung vom Sanatorium: zweitausend Schilling. Bisher habe ich das immer ohne ein Wimperzucken erledigen können. Jetzt weiß ich nicht, wo ich es hernehmen soll. Bitte helfen Sie mir, Herr Bankier! Geben Sie mir eine zweite Hypothek, oder — — —“
„Was oder?“
„Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Die Krankheit meiner Frau bringt mich noch an den Bettelstab. Um ihretwillen habe ich doch nur alles getan! Und die Mündelgelder — —“
Er brach plötzlich ab. Der Bankier horchte auf.
„Wie? Die Mündelgelder? Ach so — die Sie für Ihre Nichte Doris bei mir angelegt haben? Aber um Gotteswillen — — wollen Sie etwa —?“
Der Rechtsanwalt machte eine müde, verzweifelte Armbewegung. „Nein, nein, — — natürlich nicht. Ich muß eben zusehen, wie ich die Summen durch Arbeit wieder hereinbekomme. Im Augenblick allerdings — —“
Bankier Lammers erhob sich. „Also gut, Doktor!“ sagte er, „die zweitausend Schilling leihe ich Ihnen, das heißt: rein persönlich, als guter Freund sozusagen, aber — ich knüpfe eine Bedingung daran.“
„Sprechen Sie, sprechen Sie!“ Doktor Höffner atmete sichtlich auf, hastig strich er sich mit den spitzen Fingern über die Schläfe, der starre Ausdruck um seinen Mund löste sich.
Bankier Lammers hielt bereits die Brieftasche in der Hand. „Sie verpflichten sich“, sagte er, „in der nächsten Zeit, was Ihre finanziellen Dinge betrifft, nichts zu tun, ohne mich zu befragen. Ich meine es gut mit Ihnen, Herr Doktor, das wissen Sie. Sonst hätten Sie mich wohl auch jetzt nicht um Rat gebeten. Also geben Sie Ihr Versprechen.“
Höffner schlug in die dargebotene Hand ein.
Geheimrat Holts Sanatorium lag auf dem Semmering, abseits der großen Kunststraße, die über die Paßhöhe nach Mürzzuschlag hinunterführt. Es war rings von Wald umgeben, nur an der Stirnseite war eine Lichtung geschlagen, die einen herrlichen Durchblick auf das Gebirge bot. Über die Lichtung zog sich eine gepflegte Gartenanlage hin, die sich an einem Ende zu einer Liegewiese, — am anderen zu einem kleinen Sportplatz erweiterte.
Für das Wohlbehagen der Gäste des Sanatoriums war trefflich gesorgt, soweit ihre Leiden ein Wohlbehagen überhaupt aufkommen ließen. Wer die Verhältnisse dieser Heilanstalt kannte, wußte genau, daß es hier nicht allzuviele Schwerleidende, — dafür aber umso mehr gut zahlende Gäste gab. Für viele von ihnen war offensichtlich das Kranksein bloß eine Modesache, der man sich hingeben mußte, um in gewissen Kreisen überhaupt erst ‚ernst genommen‘ zu werden. Hätten Sie sich diesen Luxus nicht ‚leisten’ können, dann wären sie niemals krank geworden.
Geheimrat Holt wußte das alles; er hatte durchaus nichts dagegen. Wozu sollte man diesen Leuten die Freude verderben? Im Grunde genommen war es für solche Menschen ja doch nur ein harmloses Spielchen, sie spielten sich selber Theater vor. Geheimrat Holt war kein Spielverderber.
Trotzdem würde man ihm nicht gerecht werden, wenn man behaupten wollte, er nähme es mit seiner ärztlichen Kunst nicht ernst. Diejenigen seiner Patienten, die wirklich mit einem Leiden behaftet waren, behandelte er stets gewissenhaft, ja, er brachte es sogar fertig, in kritischen Fällen die Nachtwache selber zu übernehmen.
Frau Doktor Höffner gehörte zu seinen ‚Teils-teils’-Patienten. So pflegte er die zu nennen, die tatsächlich irgend ein kleines Leiden besaßen, um eine große Sache daraus zu machen. Sie sahen es gerne, wenn er bedenklich die Stirne in Falten zog und die Achseln zuckte, und wenn er dabei mit vielen gelehrten, lateinischen Ausdrücken um sich warf. Einmal hatte er, als er von einer Dame gefragt wurde: „woran leide ich?“ ‚Ignorantia pyramidalis’ gesagt, und da meinte sie kummervoll: „Sehen Sie, Herr Geheimrat — ich wußte doch, daß es etwas ganz Schlimmes ist!“ —
Berta Höffner saß auf dem Sonnendeck — wie man die Südterrasse hier nannte—und las einen Liebesroman, als ihr ein Telegramm gebracht wurde. Sie öffnete es. Ihre Züge verzerrten sich. Was? Von Herbert? Was wollte ihr Mann denn? Sie solle zurückkommen, und zwar sofort? Ihre Anwesenheit wäre dringend erforderlich? Aber das war doch — —! Was fiel denn dem guten Herbert auf einmal ein? Vergaß er ganz, daß sie schwer leidend war? Wollte er, daß sie zugrunde ging, wenn sie sich in dem Zustande den Strapazen der Reise aussetzte? Und überhaupt — warum schickte er dann den Wagen nicht? Warum kam er nicht selber und holte sie? Warum rief er nicht wenigstens an?
Lächerlich! Einfach lächerlich!
Als sie sich umblickte, sah sie den kleinen Assessor neben sich stehen, der immer so aussah, als ob er jeden Augenblick niesen müßte. Daß er die Gelbsucht hatte, sah man ihm schon von weitem an. Daß er Frau Berta ‚hündisch verehrte’, hatte er ihr schon in einer Weinlaune einmal gesagt. Aber er merkte nicht, oder wollte es nicht merken, daß sie ihn stets nur als Boy benutzte. „Ah! Herr Assessor!“ rief sie, „da kommen Sie gerade recht. Wollen Sie bitte für mich ein Gespräch anmelden? Nach Graz. Meinen Mann will ich sprechen. Nummero dreiunddreißig vierhundert elleff! Wenn er am Apparat ist, rufen Sie mich!“
Und schon griff sie wieder nach ihrem Buch.
Doris war mit den Kindern nach Hause gekommen, man saß beim Essen. Der Onkel machte ein ernstes Gesicht. Die Reserl bediente; sie hatte verweinte Augen.
Das muntere Plaudern der Kleinen beachtete Höffner kaum, die tausend kleinen und großen Fragen mußte Doris beantworten. Sonst ging auch der Doktor stets darauf ein. Heute hatte er keinen Sinn dafür.
Doris machte sich an ihn heran, als sie mit ihm alleine war. „Onkel Herbert“, fragte sie, „hast du Sorgen gehabt?“
„Sorgen? Sorgen?“ Höffner spitzte den Mund wie zum Pfeifen, „das ist gar kein Ausdruck, aber — ach laß mich, das geht ja nur mich etwas an.“
„Willst du mich nicht daran teilnehmen lassen?“ beharrte Doris, „man trägt alles leichter, wenn man sich einmal aussprechen kann.“
Der Doktor blickte sie forschend an, während er sich eine Zigarette anzündete. Deutlich erkannte sie, daß seine Hand dabei zitterte.
„Wer hat mich bisher schon nach meinen Sorgen gefragt!“ brummte er und steckte das Feuerzeug wieder ein.
Doris empfand diesen Ausspruch als einen Vorwurf, — weniger gegen sich selbst, als gegen den Menschen, der eigentlich dazu berufen war, ihres Onkels Sorgen mit ihm zu teilen. Vor ihrem geistigen Auge tauchte die Tante auf, die ihrem Gatten, wenn man es einmal genau nahm, nur Sorgen bereitete. Nichts konnte Berta vornehm, nichts konnte ihr elegant genug sein, ein großes Haus mußte geführt werden, von einem Sanatorium in das andere wollte sie schwirren, — wo aber das Geld dazu alles herkam, danach fragte sie nicht. Ein ganz oberflächlicher, ja, fast leichtsinniger Mensch, sah sie sich selbst als die Achse an, um die sich die anderen alle zu drehen hatten.
Der gute Onkel konnte ja zusehen, wie er das schaffte. Mit seiner Praxis allein schaffte er es jedenfalls nicht. Oh — Doris sah schon recht klar in den Dingen, sie hatte es sich bisher nur noch nicht anmerken lassen.
Übrigens mußte es jetzt schon recht toll mit den Sorgen des Onkels sein; sonst hätte er ihr wohl nichts zugegeben. Er tat ihr leid.
„Geht es der Tante mal wieder nicht gut?“ fragte sie, um ihn weiter aus sich herauszulocken.
Der Rechtsanwalt zuckte zusammen, seine sonst immer so lieben, freundlichen Züge nahmen einen müden, verzweifelten Ausdruck an. So hatte Doris den Onkel noch niemals gesehen.
„Komm, setzen wir uns“, sagte er, „ich muß mit dir reden. Nein, Tante geht es nicht schlechter als sonst, jedenfalls wüßte ich nicht, und im übrigen soll sie zurückkommen. Ich habe ihr bereits telegrafiert.“
„Oh — so plötzlich? Was ist denn nur vorgefallen?“ fragte das Mädchen erstaunt.
Aus Höffner, in dessen Innerem sich schon seit Tagen alles mögliche aufgestaut hatte, sprudelte es hervor, als ob ein Meer, lange zurückgehalten, im Sturm und mit aller Wucht einen Deich durchbrach. Ja, er schüttete Doris gegenüber sein Herz aus, er scheute sich plötzlich nicht mehr, er fühlte, er ahnte so lange schon, daß sie ihn ganz verstand. Wenn sie bisher auch in seinen Augen noch immer ein halbes Kind war, so glaubte er doch ihr bereits sein Vertrauen schenken zu dürfen. Sie hörte ihm traurig zu. Unwillkürlich hatte sie seine Hand ergriffen; sie blickte ihm in die Augen. Ein bitteres Weh lag darin, aber auch noch etwas — —
Rasch wandte sie sich wieder ab. Er erhob sich. „Das Telefon hat geklingelt!“ sagte er, „bitte schau du einmal nach. Und wenn es — — wenn es die Tante sein sollte, ich bin nicht zu Hause, hörst du!“
Doris eilte errötend zum Telefon.
Der kleine Assessor kehrte erregt zu Frau Höffner zurück. „Die Verbindung ist da, meine Gnädigste, darf ich bitten!?“
Berta erhob sich, sie klappte das Buch zu, strich noch die Decke zurecht, bevor sie sich, ohne besondere Eile, zum Telefon begab. Der Assessor öffnete dienstbeflissen die Korridortür.
Endlich hielt sie den Hörer in der Hand. Zwei Minuten waren bereits verstrichen. „Ja, bitte!“ rief sie, „wer ist denn dort? Bist du es, Herbert?“
„Nein, hier ist Doris, Tante. Du wolltest natürlich den Onkel sprechen, doch leider ist er nicht da.“
„So, wo ist er denn hingegangen?“
„Das weiß ich nicht. Er hat irgendwelche Verhandlungen.“
„Dann sage ihm bitte, daß er mich hier einmal anrufen soll. Ich muß mit ihm sprechen. Sage ihm, daß ich sonst nichts unternehmen werde.“
„Du willst nicht zurückkommen, Tante?“
„Wie? Woher weißt du denn?“ Bertas Stimme nahm einen schnarrenden Klang an, „Ihr schmiedet wohl dort ein Komplott zusammen? Was ist denn überhaupt los? Fehlt den Kindern was?“
„Nein, die sind wohl und munter.“
„Na also — was soll ich dann dort? Soll ich mich etwa nicht auskurieren?“
„O doch — — natürlich. Ich weiß ja auch nicht — —“
„Wer hustet denn da?“
„Wie — — husten? Ich habe mich eben geräuspert; ich bin ganz allein.“
„Ruf mal den Franzerl ans Telefon!“
„Tante — die Kinder spielen im Garten. Ich müßte sie erst einmal rufen gehen. Das Gespräch würde zu lange dauern.“
„Darüber brauchst du dir doch keine Sorgen zu machen, du Naseweis! Also geh schon. Ich warte am Apparat.“
Doris tat, wie ihr geheißen wurde. Endlich erscholl Franzerls Stimme im Telefon. „Mutti!“
„Tag Franzerl, Grüß Gott! Ja — — hier ist Mutti. Was machst du denn? Ist der Vati nicht da?“
„Wie? der Vati? Der sitzt doch — — —“ Das Stimmchen brach plötzlich ab. Doris hatte dem Jungen den Mund zugehalten. Sie wußte kaum, was sie tat. Gleich darauf hängte sie ein. Höffner kam aus dem Nebenzimmer, hochrot im Gesicht. „Aber das ist doch — ah! Du hast eingehängt!“
„Ja“, nickte Doris, „was sollte ich machen?“
„Es wird gleich wieder läuten“, erwiderte er, „so wie ich sie kenne — — — dann sage ihr, daß die Verbindung wahrscheinlich gestört worden sei. — Komm, Franzerl, komm, — Elsbeth! Wir gehen wieder zum Garten hinaus.“ Mit diesen Worten zog er die Kinder davon.
„Was soll ich denn aber noch sagen — — ich meine wegen des Jungen?“ rief ihm die Nichte nach.
„Sage ihr, daß auch er nichts mehr gehört habe, und dann sei er davongelaufen. Inzwischen hätte das Mädchen die beiden zum Einkaufen mitgenommen.“
„Ach — so ein Schwindel! Sprich du doch selbst mit ihr, Onkel, ich bitte dich!“
„Also gut! Meinetwegen, — das heißt, wenn sie wirklich noch einmal anrufen sollte. Jetzt bringe ich erst mal die Kinder hinaus.“
Da! Schon wieder schrillte das Läuten des Telefons. Doris zitterte. „Hier bei Höffner!“ meldete sie sich mit schwacher Stimme.
„Hier Otto Siewers!“ kam eine männliche Antwort zurück, „sind sie es selbst, Fräulein Doris?“
Doris atmete auf. „Ja, ich bin es, Herr Siewers. Es ist nett, daß Sie anrufen.“
„Wirklich — — freuen Sie sich? Tja — — ich wollte mal fragen, ob man Sie heute Abend beim Gartenfest auf dem Schloßberg erwarten darf?“
Richtig! Das Gartenfest hatte sie ganz vergessen. Sie wollte ja eigentlich hingehen. Warum sollte sie nicht? Onkel Herbert würde gewiß nichts dagegen haben, vielleicht kam er selbst sogar mit.
„Ja“, sagte sie, „selbstverständlich, ich werde kommen. Sie wissen ja, wo getanzt wird, bin ich stets gerne dabei“
Das ist nett, Fräulein Doris! Also um acht geht es los. Seien Sie bitte pünktlich. Und grüßen Sie Ihren Herrn Onkel!“
„Nun?“ fragte Höffner, der eben zurückkam, „wer war es denn?“
Doris sagte es ihm. „Nicht — du erlaubst es doch, Onkelchen?“
Höffner blickte sie von der Seite an. Nach einer Pause erwiderte er: „Ja, gewiß — — und ich hoffe, daß ich mich dir anschließen darf!“
Doris drückte ihm freudig die Hand.
‚Nicht zu genießen!’ — dachte der kleine Assessor — ‚was mag ihr nur über die Leber gekrochen sein!?’
Berta war auf die Terasse zurückgekehrt. Sie sah blaß aus. Auf seine teilnehmende Frage hin fuhr sie ihn an: „Gehen Sie! Lassen Sie mich in Ruhe!“
So schroff hatte sie ihn noch niemals behandelt. Er zog sich verschnupft zurück. Tatsächlich: Jetzt mußte er richtig niesen! Gleich zwei-, drei Mal hintereinander.
Berta griff nach dem Buch; doch sie schleuderte es gleich wieder beiseite. Ob der Graf wirklich die Försterstochter bekam, interessierte sie augenblicklich durchaus nicht mehr.
Sie lehnte sich an die Brüstung und schaute über die Lichtung hinaus. Ihr Herz schlug zum Zerspringen. Da war es also schon wieder, dieses beängstigend starke Herzklopfen, das durch jede Erregung unweigerlich bei ihr ausgelöst wurde. Sollte sie rasch zum Geheimrat gehen? — Aber dann mußte sie ihm doch wohl sagen —?
Sie ging lieber nicht.
Ein Boy trat zu ihr heran. „Gnädige Frau — — dieser Herr möchte Sie gerne sprechen!“ Dabei reichte der Boy ihr die Besuchskarte hin. Berta warf einen Blick darauf. Dann erwiderte sie: „Bitte — — führen Sie ihn ins Besuchszimmer; ich komme sofort.“
Aber es dauerte noch eine Weile, bis sie vor ihrem Besucher erschien. Sie mußte sich erst zurechtmachen. Zu diesem Zweck suchte sie erst noch ihr Zimmer auf. Tausend wirre Gedanken schwirrten ihr durch den Kopf. Also so weit war es bereits gekommen, daß sich Herbert vor ihr verleugnen ließ! Oder hatte Franzerl nicht sagen wollen: Der Vati, der sitzt nebenan!? Irgend jemand hatte dann plötzlich eingehängt, sicherlich diese Doris, die sie schon immer nicht leiden mochte! Der würde sie schon noch die Meinung sagen. Erst hatte sie gleich wieder anrufen wollen. Aber wozu denn? Es würde doch nur eine neue Aufregung dabei herauskommen; und Erregungen ging sie gern aus dem Wege. — —
So — — jetzt noch die Haare ein wenig nachgebrannt! Die Wellen waren ja gar nicht mehr richtig zu sehen. Bert würde warten gelernt haben. Was er wohl von ihr wollte? Kam er eigens um sie zu besuchen aus Graz hier herauf?
Bert Hausmann verneigte sich etwas ungeschickt, als sie ihm endlich entgegentrat. „Habe die Ehre“ sagte er, sich übertrieben höflich verneigend, „die schöne Frau Base sieht wieder mal blendend aus.“
„Und ich staune, Sie hier zu sehen, mein Lieber! Sind Sie auf Reisen? Machen Sie eine Tour?“
„Nein, ich bin extra hierhergekommen, um Sie zu sprechen, Frau Doktor! Es ist eine, hm — sagen wir: etwas delikate Geschichte. Sie wissen: Ihr Mann ist mein Vetter, ich bin Bankier; wir haben zusammen ein kleines Geschäft gemacht.“
Berta horchte verwundert auf. „Ja — na und? Worum handelt es sich? War es ein gutes Geschäft?“
„Nein, im Gegenteil, — leider nicht. Es ist schief gegangen.“
„So so! Er hat also Geld eingebüßt?“
Hausmann wich ihren Blicken aus. Zwischen den Fingern drehte er einen silbernen Bleistift. Eine Kleinigkeit, ja“, gab er zu, „jedenfalls wird es ihn nicht gleich umwerfen.“
„Wieviel ist es denn?“
„Sechzigtausend.“
Berta zuckte zusammen. Sie kniff die Augen ein, faßte sich an die Brust. Oh — dieses Herzklopfen wieder! Das war doch ein jäher Schreck! „Was? Sechzigtausend?“ rief sie, „das ist ein Vermögen! Woher hatte er das Geld überhaupt? Wenn ich nicht irre, lagen bei Lammers nur zwanzigtausend.“
„Ja, ja, — dazu hat er noch eine Hypothek aufgenommen. Ich riet ihm dazu. Ich hielt es für eine ganz sichere Sache.“
„Was? Diese Spekulation?“
„Ja. Daß man dabei hereinfallen könnte, hätte ich niemals für möglich gehalten. — Nun hören Sie bitte, Frau Berta, — — ich möchte nicht in ein falsches Licht bei ihm kommen, und deshalb — — — Ich habe es wahr und wahrhaftig nur Ihretwegen getan.“
Berta lief, feuerrot im Gesicht, erregt hin und her. Sie lachte unvermittelt und schrill auf. „Ah! Meinetwegen! Was soll das heißen?“
„Ich wußte doch, wie Sie den Luxus lieben, Frau Base, und wußte von Herbert auch, daß es ihm schwer fiel, das alles heranzuschaffen. Er fing schon an Schulden zu machen, damit er Sie überhaupt noch hierherschicken konnte — —“
„Das wußten Sie? Davon hat er mir nichts gesagt!“
„Nein, das glaube ich. Ihnen wollte er jede Erregung sparen. — Doch lassen Sie mich bitte wieder zur Sache kommen. Er hatte mich einmal gefragt, ob ich ihm nicht zu einer glücklicheren Anlage seines Geldes verhelfen könnte. Da gab sich nun diese Gelegenheit, — die sich dann allerdings als grober Fehlschlag herausstellen sollte. Ich hatte im besten Glauben gehandelt. Um Ihnen das zu sagen, bin ich hierhergekommen.“
„Nur um mir das zu sagen?“
„Ja — und um Ihnen zugleich einen Wink zu geben, ich habe da nämlich schon wieder eine ganz neue Sache, die dieses Mal wirklich totsicher ist.“
„Aber du lieber Gott — denken Sie etwa an eine neue Beteiligung? Woher sollte Herbert das Geld dazu auftreiben, wenn er doch bereits solche Schulden hat.“
Hausmann verzog den Mund, kniff das linke Auge ein wenig zusammen. „Aber er hat doch noch Geld“, meinte er, „allerdings — hm — — na, so kleinlich wird er ja schließlich auch nicht sein. Sie müssen ihn bloß darauf stoßen. So eine hübsche Frau wie Sie vermag alles. In zwei bis drei Monaten kann die Summe verdoppelt sein — — bitte bedenken Sie: ein Gewinn von glatt hundert Prozent! Na also.“
„Von welchen Geldern reden Sie denn?“
„Aber ich bitte Sie, liebste Base — — verwaltet er nicht auch die Mündelgelder, die Ihrer Nichte in einem halben Jahr erst ausgezahlt werden sollen?“
Berta wiegte bedenklich den Kopf. „Ja, ja — — das stimmt schon. Aber ich glaube kaum, daß ich ihn dazu bringen werde. Na —und überhaupt, — wenn das Geld dann auch wieder verloren ist — —?“
„Aber ich bitte Sie — — ausgeschlossen! Die Sache ist bombensicher. Eine Terrainspekulation — ich werde es Ihnen erklären!“
Höffner wußte wohl selbst nicht, wie er eigentlich dazu kam, Doris zum Gartenfest zu begleiten. War es die Sorge um sie, daß ihr vielleicht etwas zustoßen könnte? War es die Absicht, sich selbst zu betäuben, nachdem er während der letzten Tage so viel Unangenehmes hatte erleben müssen? Oder war es noch etwas anderes? Eigentlich machte er sich doch aus öffentlichen Veranstaltungen nicht so viel.
Wehmütig half er ihr in den Wagen; wehmütig deshalb, weil er das schöne Auto nun auch verkaufen mußte. Alles, was irgendwie Luxus war, sollte abgeschafft werden. Es ging nicht anders. Das hatte er Hausmann zu danken.
Wie? Hausmann? Hatte er sich denn auf dessen Ratschläge einlassen müssen? War er nicht selber schuld, wenn er dadurch hereinfiel? Man sollte nicht immer nur andere für die eigenen Fehler verantwortlich machen. Jedenfalls: ausbaden mußte er alles allein.
Es waren recht trübe Gedanken, die ihn beschäftigten.
Doris saß neben ihm, ebenfalls offenbar in Gedanken versunken. Lange Zeit sprachen sie beide kein Wort. Oh — diese Doris — — dies Halbkind, was war sie doch für ein prächtiger Mensch! Wie verständnisvoll sie ihm zugehört hatte, als er, einer inneren Stimme gehorchend, seine Verfehlung gestand. Kein einziges hartes Wort war gefallen, nicht einen einzigen Vorwurf hatte sie ihm gemacht.
Was würde dagegen wohl Berta sagen, wenn sie erst alles erfuhr? So etwas konnte man ihr nicht verheimlichen, nein, das ging einfach nicht. Dadurch, daß er sie plötzlich zurückrief, würden ihr schon die Augen geöffnet werden.
„Worüber denkst du nach, Onkel?“ riß ihn Doris aus seinen Gedanken empor. Nur rein mechanisch hatte er das Steuer geführt.
„Ach nichts“, gab er zur Antwort, „geschäftliche Dinge — — eine Prozeßsache, die ich morgen vertreten muß — — übrigens sind wir gleich da. Siehst du — dort drüben winkt Siewers schon! Hast du dir das, was ich dir neulich sagte, noch mal durch den Kopf gehen lassen?“
„Ja, aber — ich weiß nicht — — ich kann mich doch nicht so recht entscheiden. Das hat ja wohl auch noch Zeit.“
Höffner blickte sie prüfend an. Ihre Blicke begegneten sich. Hastig half er ihr aus dem Wagen. Jetzt war Siewers auch da. „Oh — das ist lieb, daß Sie Wort halten“, sagte er, „na, und Sie sind gleich mitgekommen, Herr Doktor? Das nenne ich eine Überraschung! Los also, folgen Sie mir, ich habe schon einen hübschen Platz reserviert.“
„Ausgezeichnet!“ Der Rechtsanwalt zeigte wieder sein übliches, stets beherrschtes Gesicht, ja, ein Schimmer flüchtiger Freude huschte darüber hin. Ich bin mitgekommen, damit mir die Kleine nicht zu viel Dummheiten macht, sagte er.
Siewers lachte. „Ah! Dummheiten! Na — dazu kommt sie doch her — oder nicht, Fräulein Doris? Ich habe doch recht, nicht wahr?“
Doris sah in sein hübsches Gesicht und bewunderte seine prachtvollen Zähne. Sie sah diesen jungen Menschen sehr gern, der schon lange im Hause des Onkels verkehrte, nicht ohne bestimmte Absichten auf das Mädchen. Ja, Siewers wollte sie einmal heiraten. Das hatte er zu dem Onkel schon einmal ganz offen gesagt.
Aber an so etwas dachte sie überhaupt noch nicht. Zwanzig Jahre alt — — und schon heiraten? War das nicht viel zu früh? Mußte sie dazu nicht mindestens erst verliebt sein? Verliebt! War sie das? Nein. Was sie Siewers gegenüber empfand, war nur Freundschaft. Sie mochte seine Berührungen nicht, aber sie unterhielt sich sehr gerne mit ihm. Wenn er mal irgend eine Andeutung machte, wich sie ihm immer aus. Liebe? Pah! Was war Liebe! Das stellte sie sich doch ganz anders vor. Er mochte in sie verliebt sein, — sie war es in ihn aber nicht.
Sein Vater besaß eine große Maschinenfabrik, die in Deutschland lag. Das hiesige Zweigwerk sollte sein Sohn übernehmen, der sich zur Einführung schon seit zwei Jahren hier befand, wo er soeben sein Studium auf der technischen Hochschule abschloß. Er würde zur Gründung einer Familie demgemäß voll und ganz in der Lage sein. Mit Höffner hatte er auch schon davon gesprochen, doch Doris selbst gegenüber hatte er sich bisher nur auf Andeutungen beschränkt, da er spüren mochte, daß sie sich über ihre Gefühle noch garnicht im Klaren war.
Nun machten die drei sich’s in einer künstlichen Rebenlaube bequem. Lange blieben sie nicht unter sich. Viele Bekannte streiften vorüber, manche setzten sich mit an den Tisch. Es wurde gelacht und getrunken und sehr viel getanzt. Siewers und Doris gaben ein recht schmuckes Paar ab.
Rechtsanwalt Höffner beobachtete sie. Auch er hatte einige Male mit Doris getanzt. Wie verjüngt fühlte er sich, wenn sie in seinen Armen lag. Alle Sorgen waren vergessen. Er trank recht viel.
Einmal machte sich Siewers heimlich an ihn heran, fragte ihn, ob er schon wieder einmal mit Doris gesprochen habe?
Höffner blickte ihn gläsern an. „Wie? Gesprochen? Mit Doris? Ja so, natürlich. Sie wollte aber noch nichts davon wissen.“
Der gute Siewers schien recht betrübt zu sein. Aber er gab seine Hoffnung nicht auf.
Am folgenden Morgen kam wieder ein Anruf vom Semmering. Berta hatte sich’s also doch überlegt— dachte Höffner und nahm den Hörer ans Ohr. „Ja, Berta? Was gibt es? Ich dachte, du wärst schon zurückgekommen.“
„Ich komme auch, Liebling, ich komme auch“ rief sie mit einem Klang in der Stimme, den er durchaus nicht erwartet hatte, „ich werde dich trösten über den schrecklich bösen Verlust — soweit dich die kleine Doris nicht schon getröstet hat.“
Höffner durchfuhr es kalt. Hatte er richtig vernommen? Verlust? Doris? Getröstet? „Was weißt du denn überhaupt?“ fragte er stockend, „ich meine — — woher weißt du was über einen Verlust?“
„Liebling — Bert Hausmann war bei mir. Er beichtete alles, er wollte nicht, daß wir falsch von ihm denken. Er ist doch ein guter Kerl.“
„So! Ein guter Kerl! Danke bestens. Ein Lump, ein Betrüger ist er!“
„Oh — — dann schätzt du ihn falsch ein. Wäre die Sache gelungen, dann würdest du anders reden.“
„Du kommst also her?“ schnitt der Rechtsanwalt kurz dieses Thema ab.
„Ja, ich komme“, erwiderte Berta, „doch nur, wenn du mich holst.“
„Kindchen — das kann ich jetzt wirklich schlecht machen. Ich habe sehr viel zu tun.“
„Pah — — einen Tag wirst du dich freimachen können. Oder gestattet es Doris nicht?“
„Was hast du nur immer mit Doris!“ rief Höffner wütend, „ich verstehe dich einfach nicht.“
„Schon gut, Liebling. Also wann triffst du hier ein? Mit dem Wagen kannst du in drei Stunden hier sein, nicht wahr?“
„Mit der Bahn fährst du aber bequemer. Ich möchte dir raten — —“
„Jetzt ist es halb zehn“, sagte Berta, „zum Essen kommst du demnach noch zurecht. Ich werde gleich ein Gedeck für dich mitbestellen. Es gibt nach der Schildkrötensuppe Forelle in brauner Butter, als zweiten Gang Sahnenschnitzel, und alles sehr reichlich, das weißt du ja. Welchen Wein soll ich dir kaltstellen lassen? Weißt du, ich nehme den, den wir das letzte Mal schon hier tranken. Er war doch gut, was? Und nur zwanzig Schilling die Flasche!“
„Nein, du wirst weder ein Essen noch Wein bestellen“, rief Höffner ärgerlich, „denn ich komme nicht!“
„Also gut, Liebling — dann komme ich auch nicht. Du kannst mir nicht zumuten, als schwer herzkranke Frau mit der Bahn zu fahren. Das bin ich wahrhaftig auch nicht mehr gewohnt.“
„Dann wirst du dich eben mal wieder daran gewöhnen müssen.“
„Oh, Liebling! Wie sprichst du mit mir!“
„Wie ein Mann spricht, der sich nicht mehr länger auf der Nase herumtanzen läßt.“
„Wie energisch! Das steht dir gar nicht so übel. Aber du könntest doch wenigstens dieses eine Mal noch eine Ausnahme machen.“
„Das könnte ich wohl, aber ich tue es nicht.“
„Hm. Dann hätten wir uns also weiter nichts mehr zu sagen!?“
„Nein, allerdings nicht. Nur das noch, daß ich dich bis spätestens morgen Abend zurückerwarte. Und nun lebe wohl!“
Wütend hängte er ein, ohne noch weiter in die Leitung zu horchen. Seit langer Zeit hatte er nicht mehr mit seiner Frau so energisch gesprochen. Doch was zu viel war, das war zu viel. Sein ganzer Stolz hatte sich aufgebäumt.
Kurz darauf rief er von sich aus das Sanatorium an. Er wollte noch mit dem Geheimrat reden.
Doris beaufsichtigte in der Gartenlaube die Kinder bei ihren Schulaufgaben. Das kleine Kropzeug — wie sie die beiden nannte — hatte ihr immer viel Freude gemacht. Sie verstand es nicht, daß die eigene Mutter den Kleinen immer so lange fernbleiben konnte. Das würde sie wohl auch niemals verstehen. Ja, sie empfand das ganz anders; sie dachte sich’s herrlich, in späteren Jahren einmal selber Kinder zu haben. Kein Minute würde sie die dann im Stiche lassen, sie würde ganz in ihnen aufgehen, ganz und immer nur für sie da sein, so wie es der Onkel tat, der sich oft genug extra die Zeit stahl, um mit den Kleinen herumzutollen.
Der Onkel! Was war er doch für ein lieber Mensch! Seinetwegen hielt sie es hier überhaupt nur noch aus. Mit Tante Berta konnte sie sich nun einmal nicht recht verstehen, die war ihr zu herzlos, zu ‚vornehm‘, zu eingebildet, — wer weiß, worauf. Hatte sie nicht im Grunde auch Schuld daran, daß der Doktor sich plötzlich in dieser verzweifelten Lage befand? Hatte sich der nicht nur ihretwegen in jenes verhängnisvolle Abenteuer gestürzt, aus dem er nun kaum einen Ausweg sah?
Schulden! Schulden! Es mußte schrecklich sein, so viele Schulden zu haben und nicht mehr zu wissen, wovon man sie bezahlen sollte.
Sie zuckte zusammen. Ihr war ein Gedanke gekommen. Sie konnte ihm helfen, ja, sie allein. Verwaltete er nicht ihr väterliches Vermögen? Zweiundfünfzigtausend Schillinge waren es, ohne die Zinsen gerechnet. Die konnte sie ihm zur Verfügung stellen. Dann war er die furchtbaren Sorgen los. Er würde ihr später das Geld schon mal wieder zurückgeben können.
Ach, daß doch vom Gelde immer so vieles abhängig war!
Ja, sie wollte ihm helfen, dann machte er sicherlich nicht mehr dieses vergrämte Gesicht und schlich wie sein eigener Schatten umher. Da kam er gerade die Treppe vom Hause herunter. Sie trat auf ihn zu.
Höffner wunderte sich, sie so vergnügt zu sehen. Strahlend erzählte sie ihren Plan. Langsam wanderten sie durch den Laubengang.
Mit gefurchter Stirn hörte er ihre Ausführungen an. Innerlich bebte er, tief bewegt. Welche selbstlose Güte trat ihm mit diesem Mädchen entgegen!
Wenn sie geglaubt hatte, daß er mit beiden Händen zugreifen werde, dann irrte sie sich. Seine Antwort ernüchterte sie. „Liebes Kind“, sagte er, „deine Güte erschüttert mich, und ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich dir für dein Angebot bin. Aber du darfst mir nicht böse sein, wenn ich es trotzdem ablehnen muß. Als dein Onkel könnte ich allerdings ja sagen und die Summe mit Freuden entgegennehmen, — aber ich bin auch dein Vormund, und dieser Vormund sagt nein dazu. Er verbietet dem Onkel mit aller Entschiedenheit, dieses Geld von dir anzunehmen, weil er es dadurch gefährdet sieht, und es darf nicht gefährdet werden. Verstehst du mich?“
„Ja, ich verstehe. Aber — —“
„Kein aber, mein Kind! Diese Sache liegt klipp und klar. Dein Vormund hat sogar noch eine andere Absicht. Er ist lange darüber mit sich zu Rate gegangen.“
Doris blickte dem Onkel gespannt ins Gesicht. „Was hast du vor?“ fragte sie.
„Vormund und Onkel“, erwiderte Höffner mit einem bitteren Ton in der Stimme, haben sich in mir herumgestritten. ‚Du bist nicht mehr wert’, hat der Vormund zum Onkel gesagt, ‚das Geld deiner Nichte weiterhin zu verwalten. So etwas können nur ehrliche Menschen tun. Du aber hast dich selber unehrlich gemacht, jedenfalls hast du dich in der leichtfertigsten Weise in Spekulationen hineinziehen lassen, die dich um deine Existenz bringen können. Du bist nicht mehr wert, daß man dir Vertrauen schenkt. Das Geld, das du so skrupellos verspekulieren konntest, hat deiner Frau mitgehört. Also war das bereits ein Vertrauensbruch.‘ — Nein, nein!‘ schrie die andere Stimme gequält in mir auf, ‚Hausmann sagte mir doch, daß es ganz sicher wäre. Ich glaubte ihm.‘
‚Unsinn, du, gerade du mußtest wissen, daß es sichere Spekulationen nicht gibt. Dann ist es doch gar keine Spekulation mehr, du alter Tropf‘ — oh, diese scharfe innere Stimme schrak vor den gröbsten Ausdrücken nicht zurück. Glaube mir, Doris, ich schämte mich vor mir selbst, und ich mußte ihr recht geben, dieser Gewissensstimme. Ich schwor ihr, daß ich den Fehler wieder gutmachen wollte, es hat mich innerlich vollständig umgekrempelt. Und so bin ich zu dem Entschluß gekommen, zum Vormundschaftsrichter zu gehen, um ihn zu bitten dich jetzt schon für volljährig erklären zu lassen, damit ich dir gleich deine Gelder auszahlen kann.“
Doris zeigte sich äußerst betroffen. „Aber warum nur, Onkel, warum willst du das tun?“