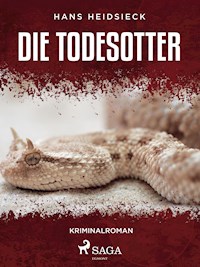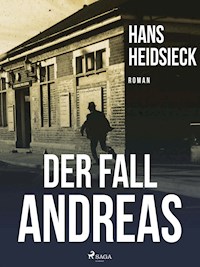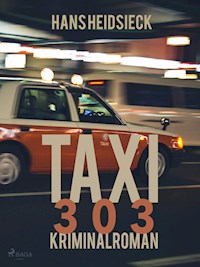Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Protagonist, Professor Köster, gilt als völlig verstiegener Mondforscher – doch er hat offensichtlich irgendwo in seiner riesigen Villa eine Rezeptur für einen flüssigen Raketentreibstoff gelagert, deshalb ist er in der Bewachung seines Hauses sehr sensibel. Eines Abends – es ist schon fast Mitternacht, schießt er auf einen Schatten auf seiner Terrasse. Später wird direkt vor der Villa ein angeschossener und schwer verletzter Mann gefunden. Es handelt sich um Dr. Krautz, einen renommierten Physiker – und ärgster Konkurrent des Professors. Als dann die Polizei noch erfährt, dass der Sohn Professor Kösters und die Tochter Dr. Krantzs eine Liebesbeziehung unterhalten – angeblich ohne Wissen der Väter –, ist das Verdacht-Maß für Professor Köster voll. Er wird in Untersuchungshaft gesteckt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Der Schuss aus dem Schatten
Saga
Der Schuss aus dem Schatten
© 1934 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508442
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1. Kapitel
Ein Aufschrei gellt durch die Nacht. „Hilfe! Hilfe!!!“ erschallt es, erst laut, dann leiser, verstummend, röchelnd.
Stumpfsinnig blicken die hohen Rüstern auf eine liegende Menschengestalt. Schritte nahen. Ein Wächter eilt auf die Richtung zu, wo der Ruf herkam. Fast stolpert er über den Liegenden.
„Hil — — fe!“ — Nur noch ein Hauch ist’s.
„Hallo — wer — — was — — — bitte —?“ Der Wächter stammelt unzusammenhängende Worte, wobei er sich niederbeugt.
Ziemlich finster liegt die einsame Strasse da. Nur drüben vor der Villa Professor Kösters brennt eine Gaslaterne.
Der Wächter hat eine Taschenlampe. Damit leuchtet er dem Mann ins Gesicht. „Sind Sie — — Sie sind — — was ist denn mit Ihnen?“
Räu — ber — — Mör — — der — — man — hat ge — schossen — — hier — meine Brust — —!“
Scheu, unbeholfen betastet der Wächter den Stöhnenden. Es ist ein Herr im Gesellschaftsanzug. Blut quillt ihm über das Frackhemd.
Plötzlich erscheint ein Auto. Es kommt wie gerufen. Der Wächter tritt auf die Strasse; gibt Zeichen und hält es an.
„Was wollen Sie?“ fragt der Schofför ziemlich unwirsch.
Im Scheinwerferlicht zuckt der angeschossene Körper auf.
Der Limousine entsteigt ein Herr in den mittleren Jahren. Gleich eilt er auf den Liegenden zu, schaut ihn an — prallt zurück.
„Der Mann ist erschossen worden! Sofort in den Wagen! Zum Krankenhaus!“ Zu dem Wächter gewendet: „Sie kommen mit bis zur Polizei, erstatten dort Anzeige, bitte!“
Nach einer Viertelstunde ist der Detektiv Doktor Thoma zur Stelle, in Begleitung des Polizeiwachtmeisters Krell. Auch ein Spürhund wird mitgebracht.
Der Angeschossene hat, im Krankenhaus angelangt, das Bewusstsein verloren. Er wird sofort untersucht.
„Brustschuss. Glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Wissen Sie, wer er ist?“ fragt der Arzt die neben ihm Stehenden.
„Keine Ahnung, Herr Doktor!“
Die Nachtwache meldet:
„Der Wächter möchte noch einmal sofort zum Polizeirevier 143 kommen — es ist telefoniert worden.“
„Ich komme ja schon!“ — —
Auf dem Revier:
„Sie heissen?“
„Josef Ringelmann, Wächter bei der Nachtbewachungsgesellschaft m. b. H., abgekürzt Nabewa.“
„Erzählen Sie bitte den Vorgang.“
„Ich hörte Hilfe rufen — das heisst — es war mir so —“
„Es war Ihnen so?“
„Ja — so — als wenn jemand Hilfe rufe.“
„Na — und?“
„Ich ging natürlich der Sache nach. Es ist ziemlich finster da draussen, Herr Wachtmeister!“
„Weiss ich. Na — und vor der Villa des Professors Köster — —“
„Ja — genau vor der Villa — — das heisst, auf der anderen Seite — — da lag er.“
„Und weiter — was sagte er?“
„Na — er konnte gar nicht viel sagen — — es hat ihm den Atem verschlagen — Herr Wachtmeister, mit so ’nem Schuss in der Brust werden Sie schliesslich auch nicht viel sagen.“
„Das gehört nicht hierher. Hat er kein Wort mehr von sich gegeben?“
„Doch — ja — — Räuber! Mörder! — hat er gesagt, und man habe auf ihn geschossen. Ich befühle ihn. Das Blut troff ihm nur so über das Frackhemd. Schade um das Hemd, Herr Wachtmeister!“
„Das gehört auch nicht hierher. Bitte berichten Sie weiter!“
„Na — als ich noch so bei mir überlegte, was ich mit dem Häufchen Unglück da anfangen sollte, da kam das Auto. Alles übrige wissen Sie.“
„Sie haben nichts Verdächtiges gehört oder gesehen, als Sie bei dem Verwundeten waren?“
„Nichts!“
„Gut. Danke. Sie können gehen.“
2. Kapitel
Der Wächter begibt sich zurück zur Unglücksstelle. Doktor Mac Thoma und Krell, den Hund an der Leine haltend, stehen noch immer da. Sie haben auf den Wächter gewartet. Noch einmal muss der die gleichen Angaben machen.
Drüben liegt dumpf und schweigend die Villa Köster. Auf der anderen Seite sind städtische Anlagen. Man hatte den Hund bereits angesetzt. Der witterte keine Spur.
Nachtwind streicht durch die Bäume. Wolkenfetzen jagen an der dürftigen Sichel des Mondes vorüber. Es ist ein wenig heller geworden. Die nächste Laterne steht auf der anderen Seite, dicht vor der Villa, die man als einen Palast ansprechen könnte.
„Wie hat der Mann gelegen?“ fragt Thoma.
Der Wächter beschreibt es.
Krell zuckt die Achseln. „Dem Fall nach zu urteilen, müsste der Schuss aus der Richtung des Hauses gekommen sein!“
Thoma nickte ihm bestätigend zu: „Wenn die Voraussetzungen stimmen! Nehmen wir also auch diese Richtung einmal ins Auge!
Man schreitet über die Strasse, dem Gitter zu, das den kleinen Vorgarten abtrennt.
„Kann ich jetzt gehen?“ fragt Ringelmann.
„Sie bleiben doch in der Nähe?“
„Bis fünf. Jawohl.“
Von einem nahen Kirchturm her schlägt es drei.
„Gut. Falls wir Sie noch mal brauchen — —“
„Stehe ich zur Verfügung, Herr Kommissar!“
„Gehen Sie doch mal hier den zur Strasse parallel führenden Parkweg entlang, wenn ich bitten darf!“
„Will ich machen.“
„Kommen Sie, Krell — zur Villa!“
Man nimmt das Gitter in Augenschein. Es ist in einen Steinsockel eingemauert. Der Stein ist etwa drei Fuss hoch.
Thoma stutzt plötzlich. „Hier — sehen Sie, bitte!“
Auch Krell tritt näher. Der Steinsockel ist an der Stelle beschmutzt. Offensichtlich wurde hier ein Fuss aufgesetzt. Ein Zigarettenstummel liegt auf der Erde.
„Hier ist jemand übergeklettert!“ behauptet Thoma, „vorher hat er wahrscheinlich die noch nicht fertig gerauchte Zigarette noch fortgeworfen.“ Er nimmt den Stummel an sich. Dann setzt er den Hund auf die Spur an. Das Tier wird über das Gitter gehoben. Es läuft sofort quer durch den Garten auf eine kleine Terrasse zu.
Auch die beiden Beamten steigen jetzt über das Gitter, was nicht sehr schwierig ist. Der Hund kommt von der Terrasse wieder zurückgelaufen.
Thoma geht vorsichtig weiter. Momentweise blitzt seine Lampe auf. Krell folgt ihm bis zur Terrasse.
„Sehen Sie — sehen Sie!“ Thoma zeigt auf eine Spiegelscheibe, die einen Riss und ein Loch von etwa zehn Millimeter Durchmesser aufweist.
„Was ist das?“ fragt Krell verblüfft.
„Ein Ausschuss. Aus diesem Raum ist geschossen worden!“
„Wer wohnt in der Villa?“ fragt Krell, der mit den örtlichen Verhältnissen noch nicht so vertraut ist.
„Professor Köster — ein eigenartiger Kauz. Man nennt ihn hier in der Stadt nur den „Mondprofessor“. Die Villa soll ein einziges Laboratorium sein.“
„Ah — der Raketenforscher!“
„Richtig! Sie haben wohl auch schon von ihm gehört?“
„Allerdings. — Ruhig mal — — war da nicht ein Geräusch?“
Plötzlich flammt hinter den Scheiben blendendes Licht auf. Ein alter, weisshaariger Mann mit stechenden Augen, einen Revolver krampfhaft in der Rechten haltend, steht vor den Blicken der beiden Männer in einer Halle, die weiter nichts als ein grosses, marmornes Becken ziert.
„Herr Professor!“ ruft Thoma, die Ruhe bewahrend, „wir sind keine Räuber! Wir sind Detektive und gehen bloss einer Spur nach.“
„Hä — das kann jeder behaupten. Sie bleiben dort stehen, bis Sie abgeholt werden! Rühren Sie sich, so schiesse ich unerbittlich!“
Die Mienen des Mannes verraten, dass er es ernst meint. Den beiden Beamten bleibt schliesslich nichts anderes übrig, als regungslos zu verweilen.
Inzwischen geht der Professor langsam zur Seite, hält aber die Waffe weiterhin auf die beiden gerichtet.
Man sieht ihn nach einem auf einem Sockel stehenden Telefonapparat greifen.
Zehn Minuten später ist schon das Überfallkommando zur Stelle. Thoma und Krell werden identifiziert. Das Kommando zieht wieder ab.
„Wir müssen mit Ihnen sprechen, Herr Professor!“ sagt Thoma. Der Alte blickt ihn durch seine dicken Brillengläser scheu an.
„Entschuldigen Sie bitte, Herr Kommissar, dass ich vorhin — — man wird halt sehr misstrauisch mit der Zeit!“
„Aber gewiss, Herr Professor — ich kann’s verstehen.“
„Wenn man so viele relativ wichtige Dinge in seinen Räumen birgt — man hat Neider — Feinde — der neue flüssige Brennstoff — Sie haben wohl schon in der Zeitung davon gelesen!“
„Gewiss, Herr Professor — — Sie sollen da eine phänomenale Sache erfunden haben.“
„Sache — äh was: Sache! — Objektiv gesprochen, meine Herren: eine Umwälzung. Endlich wird es nun möglich sein, mit Raketen den Mond zu beschiessen, was bisher eine relativ unmögliche Angelegenheit war.“
„Verzeihen Sie, Herr Professor — wir dürfen den Zweck unseres Besuches dabei nicht vergessen — — draussen ist jemand erschossen worden.“
„Äh — hab’ ich ihn doch getroffen?!“
„Wie? Was —? Sie haben geschossen?“ fragt Thoma und streicht sich über die Hakennase.
Professor Köster schaut ihn mit seinen stechenden Augen an.
„Selbstverständlich — — ich habe geschossen.“
„Herr — — Herr Professor — — wie ist das gekommen?“
„Ich bin, wie gewöhnlich, wieder mal durch das Haus geschlichen —“
„Sie — sind durch das Haus geschlichen?“
„Ja — manchmal mache ich das — nachts — — wenn alles im Schlummer liegt. Es ist eine relativ gute Methode.“
„Ich verstehe das nicht, Herr Professor.“
„Schlafen Sie immer des Nachts?“
„Wenn ich nicht dienstlich verhindert bin, allerdings, Herr Professor!“
„So. Äh — na ja. Ich nicht. Ich bin alt. Wenn man alt wird, braucht man nicht so viel Schlaf. Ich experimentiere auch häufig nachts. Und dann gehe ich im Dunkeln durch alle Räume.“
„Im Dunkeln?“
„Jawohl — im Dunkeln. Ich habe Katzenaugen, Herr — — Herr Kommissar.“
„Und warum tun Sie das?“
„Man beschleicht mich, belauert mich, — will mir meine Erfindungen rauben. Ich habe Feinde. Sehr viele Neider und Feinde — ganz objektiv gesprochen.“
„Hm — und dann schleichen Sie nachts im Dunkeln durch sämtliche Räume?“
„Ja.“
„Na — und wie war das nun heute?“
„Heute? Da war ich gerade in diesem Raum, als ich tappende Schritte hörte.“
„Wo, auf der Strasse?“
„Nein, auf der Terrasse hier. Plötzlich huschte ein Schatten vorüber. Ich sah ihn relativ deutlich. Da packte mich doch die Wut — ich weiss nicht mehr, wie mir geschah, — aber ich war ganz benommen — packte meinen Revolver — — und schoss auf den Schatten.“
„Sie haben einen Herrn auf der Strasse getroffen.“
„Was? Einen Herrn? Ich habe auf den Schatten geschossen!“
„Wo befand sich der Schatten?“
„Hier auf der Terrasse — ganz dicht — — gleich hinter der Scheibe. Draussen brennt die Laterne. So ist der Schatten entstanden.“
„Wie sah er aus?“
„Aus —? Sah aus? Wie ein Schatten halt aussieht. Er huschte vorüber.“
„Hörten Sie einen Aufschrei?“
„Nein. Ich sah und hörte nichts mehr. Ein Schwächeansall muss mich bei der Erregung ergriffen haben. Vielleicht sind Minuten vergangen, bis ich erwachte. Ich lag auf dem Boden.“
„Was taten Sie später?“
„Ich liess alles dunkel und beobachtete weiter. Draussen ertönten Stimmen. Ein Auto kam, hielt, fuhr wieder an.“
„Blickten Sie aus dem Fenster?“
„Nein. Ich konnte mich zunächst nicht erheben. Als ich dann aufstand, nach langer Zeit, hörte ich jemand herankommen. Da machte ich mich wieder schussbereit.“
„Und dann kamen wir?“
„Ja.“
„Gestatten Sie, dass ich mal telefoniere?“
„Bitte! Dort ist ja der Apparat!“
„Hier Kriminalpolizei.“
„Hier Doktor Thoma. Der Schütze ist festgestellt. Professor Köster — —“
„Was — Köster —?“
„Gibt es selbst zu!“
„Ah! Wollte wohl die Konkurrenz aus dem Wege schaffen?!“
„Was — Konkurrenz?“
„Na — nicht direkt. Aber doch seinen heftigsten Gegner.“
„Wieso?“
„Mir ist aus dem Krankenhause gemeldet worden, dass es sich bei dem Verletzten um den bekannten Physiker Doktor Kranz handelt.“
„Kranz? Wirklich?“
„Ja. — Nehmen Sie Köster fest. Wir können das nicht umgehen.“
„Übrigens — er behauptet auf einen Schatten geschossen zu haben.“
„Dumme Ausrede.“
„Aber gewisse Spuren, die ich im Vorgarten fand, lassen mit Sicherheit darauf schliessen, dass jemand unbefugterweise die Terrasse betreten hatte — —“
„Das können wir später weiter verfolgen. Handeln Sie, wie ich befohlen habe.“
„Also verhaften?“
„Auf jeden Fall. Ich sende Ihnen den Wagen.“
„Gut. Danke.“
Thoma hat wieder eingehängt. Er tritt zu Köster. Der hat sich inzwischen leise mit Krell unterhalten, ohne auf das Gespräch, das Thoma führte, zu achten.
„Herr Professor!“ sagt Thoma, „es tut mir leid, Sie verhaften zu müssen.“
Köster blickt ihn ungläubig an und schüttelt den buschigen, weissen Kopf, dessen Haare sehr wenig gepflegt sind. „Ver — haften?! Mich wollen Sie —? Aber verehrter Herr — ich habe in Notwehr gehandelt.“
„Das wird sich ja alles feststellen lassen. Jedenfalls brauchten Sie nicht gleich scharf zu schiessen. Der Mann, den Sie trafen, ist, wie ich eben erfahre, der Physiker Doktor Kranz.“
Kösters Augen werden ganz gross. Seine Hände verkrampfen sich.
„Kranz! — Doktor Kranz — — ausgerechnet! Das ist doch unmöglich! Ist er getötet worden?“
„Nein. Glücklicherweise nicht. Aber er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Operation erscheint unumgänglich.“
Doktor Kranz — Kranz — — das ist peinlich: Man wird vielleicht denken — —“
„Ich bitte Sie, Herr Professor, sich zum Mitkommen vorzubereiten. Wir geben Ihnen noch eine Frist von zehn Minuten.“
Köster sieht, dass es ernst wird. Seine breiten, von Säuren zerfressenen Hände beginnen zu zittern. Er wirft den Männern einen feindseligen Blick zu.
„Ich will meinem Sohn davon Mitteilung machen. Er übernimmt dann die Sicherung meines Hauses.“
Langsam, benommen, schwankt er der Türe zu. Thoma weicht ihm nicht von der Seite. Krell bleibt zunächst noch im Vorraum.
Eine Alarmglocke schrillt durchs Haus. Kösters Faktotum, ein alter Diener, erscheint im Treppenhaus.
„Mein Sohn soll sofort kommen!“ ruft ihm der Professor entgegen.
Einige Minuten später kommt Alfred die Treppe herunter. Er hat sich einen eleganten Morgenanzug übergeworfen. Verwundert blickt der schlanke, sehnige Sportsmann den Vater und Doktor Thoma an.
„Was ist das für ein nächtlicher Spuk, Papa?“ fragt er mit verschlafener Stimme.
„Man will mich verhaften, Junge!“ entgegnet Köster, „weil ich auf einen Schatten geschossen habe.“
„Ihr Vater hat einen Herrn auf der Strasse niedergeknallt!“ ergänzt Thoma, „wir müssen ihn mit zum Präsidium nehmen.“
„So – hm – – tja – – das ist ja sehr heiter!“
Der Diener hat sich mit den beiden Hausmädchen oben an der Treppe postiert. Alle hören mit offenem Munde zu.
Krell ist zu der Gruppe herangetreten.
„Pass auf die Villa auf, Junge!“ sagt Köster, „du weisst – der Tresor – – die Papiere –!“
„Ich werde wachen, Papa, bis du zurückkommst.“
„Natürlich – man wird mich gleich wieder entlassen müssen. Ich habe Kranz nicht erschiessen wollen. Gott ist mein Zeuge!“
„Was – – Kranz hast du erschossen?“
„Nicht doch erschossen – – immerhin schwer verletzt, wie behauptet wird.“
„Hm – das ist peinlich. Aber du kennst ihn doch gar nicht persönlich!“
„Bitte sehr, meine Herren!“ fällt Thoma dazwischen, „keine Unterhaltungen mehr — — wir müssen jetzt gehen.“
Man hört ein Auto vor’m Hause halten. Köster, der sich noch rasch einen Mantel umgelegt hat, wird hinausgeschoben.
Dann geht es zur Polizei.
3. Kapitel
Noch in der gleichen Nacht fängt man mit Kösters Vernehmung an. In einem kahlen, unfreundlichen Dienstzimmer sitzt er dem Kommissar Weidemann gegenüber. Weidemann ist auf den Professor nicht gut zu sprechen. Köster hatte ihn einmal in einer Diebstahlssache zu Hilfe gerufen. Dabei hatte der Kommissar sich nicht schlecht blamiert, und diese Blamage vergass er dem Alten nicht.
„Also wer sind Sie?“ beginnt die Vernehmung.
„Aber Herr Kommissar — wir kennen uns doch schon so lange!“
„Das gehört nicht hierher. Wenn ich Sie frage, müssen Sie antworten. Wer sind Sie?“
„Professor Köster!“
„Der Mondprofessor — aha!“
„Bitte, Herr Kommissar – das gehört schliesslich auch nicht hierher.“
„Unterbrechen Sie mich nicht! Verstanden? – Geboren?“
Köster nennt sein Geburtsdatum. Auch die anderen Fragen nach seinen Personalien beantwortet er mit einer weinerlich klagenden Stimme.
Weidemann blickt dem niedergeschmetterten, menschenscheuen Gelehrten schadenfroh ins Gesicht.
„Sie geben zu, auf Ihren erbittertsten Gegner vorsätzlich geschossen zu haben?!“
Kösters Gestalt beginnt zu vibrieren. Er zittert an allen Gliedern.
„Nein — nein!“ ruft er aufspringend, „ich wusste ja gar nicht, auf wen ich schoss.“
Der Kommissar lacht verhalten auf. „Das behaupten Sie! Warum schossen Sie denn überhaupt?“
„Es war ein Schatten — — ein relativ deutlich sichtbarer Schatten.“
„Schatten! Schatten! — Wo war der Schatten?“
„Auf meiner Veranda. Ich musste ein Verbrechen vermuten.“
„Wenn Sie schon vermuten!“
„Herr Kommissar — — — ich habe in Notwehr gehandelt. Niemand kann mir daraus einen Strick drehen.“
„Papperlapapp — — wir müssen uns an den Tatbestand halten. Der Doktor Kranz ist Ihr grimmigster Gegner. Vor einigen Tagen haben Sie noch in einem Fachblatt einen geharnischten Artikel gegen ihn losgelassen — — Sie warfen ihm Unsachlichkeit, Unfähigkeit vor. Das weiss man doch in der ganzen Stadt.“
„Ich habe aber noch nicht einmal das Vergnügen gehabt, ihn persönlich kennenzulernen.“
„Das dürfte für Sie wohl auch schwerlich ein Vergnügen geworden sein.“
„Da urteilen Sie verkehrt, werter Herr — —“
„Werter Herr? Wer ist werter Herr? Ich bin für Sie der Herr Kommissar!“
„Also — Herr Kommissar: wir Gelehrten bekämpfen uns häufig in unseren Schriften. Aber das schliesst nicht aus, dass wir dennoch persönlich relativ gut miteinander verkehren können. Wie beispielsweise die Rechtsanwälte — —“
„Rechtsanwälte gehören jetzt nicht hierher. Wir wollen doch bei der Sache bleiben. Sie geben zu, geschossen zu haben, — Sie verwundeten Ihren heftigsten Gegner lebensgefährlich, — — das genügt mir vollkommen, um in Ihnen einen gemeingefährlichen Verbrecher zu sehen.“
„Ja ja — Sie sind wirklich ein logisches Phänomen, Herr Kommissar!“ bemerkt Köster in einem Anflug von Galgenhumor.
Weidemann springt mit funkelnden Augen auf. „Was bin ich?“ schreit er, „Sie wagen obendrein frech zu werden, Sie mondsüchtiger Phantast, Sie!“
„Ich weigere mich, noch weiterhin mit Ihnen zu reden. Dem Untersuchungsrichter werde ich Rede und Antwort stehen, — sonst niemandem.“
„Das ist denn doch eine Unverschämtheit! Wenn ich Sie dienstlich frage — —“
„Fragen Sie immerzu. Kein Wort mehr werde ich antworten.“
„Sie — Herr — —“
„Was — Herr? Ich bin für Sie Professor Köster, nicht wahr?“
„Sie reissen sich mit Ihren Frechheiten nur noch mehr hinein. Verstehen Sie mich?!“ Weidemann klingelt. Ein Beamter erscheint.
„Führen Sie den Mann hinaus. Untersuchungshaft!“
4. Kapitel
„Hier Edith Kranz.“
„Hier Alfred Köster — —“
„Was — Alfred? Nachts um vier Uhr rufst du hier an? Ein Glück, dass Mutter nicht aufgewacht ist.“
„Kind — höre — — es ist ein Unglück geschehen. Dein Vater — —“
„Was — — was denn? So rede doch!“
„Es — — ein Unfall — — man musste ihn nach dem Krankenhaus schaffen, da man zunächst gar nicht wusste, um wen es sich handelte.“
„Du — ich beschwöre dich — — rede die Wahrheit: er ist doch nicht etwa tot?“
„Nein — kein Gedanke, — aber — —“
„Was aber?“
„Eine unglückselige Verkettung der Umstände — kurz gesagt: mein Vater ist schuld daran.“
„Wie? — Dein Vater?“
„Edith — ich werde dir alles persönlich erzählen. In zehn Minuten werde ich mit meinem Wagen vor eurem Hause sein. Dann will ich dich nach dem Krankenhaus fahren. Der Mutter sagst du am besten noch nichts davon.“
„Gut. Aber eile — eile! Ich warte auf dich!“
Es dauert tatsächlich kaum zehn Minuten, bis Alfred mit seinem eleganten Sportkabriolett vor dem Hause erscheint, in dem Doktor Kranz mit seiner Familie wohnt.
Edith erwartet ihn bereits vor der Tür. Sofort steigt sie ein. Der Wagen braust nach dem Krankenhause. Häuser, Laternen fliegen vorüber. Fast stösst man an einer Kreuzung mit einem Feuerwehrwagen zusammen.
„Erzähle!“ fleht Edith, „was ist denn passiert?“
Mein Vater hat auf einen Schatten geschossen, der auf unserer Veranda vorbeistrich. Dabei wurde dein Vater getroffen, der zufällig auf der Strasse vorüberging.“
„Na — und — — und — — — und ist es ein schlimmer Schuss?“
„In die rechte Brustseite. Wie ich hörte aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich. — Übrigens sind wir da.“
„Wo wollen Sie hin?“ fragt ein grimmiger Pförtner.
Es dauert lange, bis man zu dem Zimmer des Verwundeten vordringt. Dort hält eine Krankenschwester die beiden an. „Pst! Bitte leise — er ist noch bewusstlos. Bor zehn Minuten ist er erst aus dem Operationssaal gekommen.“
„Um Gottes Willen — — man musste ihn operieren?“ fragt Edith, ratlos mit ihren traurigen Augen zur Seite blickend.
„Man hat die Kugel entfernt. Es ging alles gut.“
Ein Seufzer der Erleichterung entringt sich der Brust des Mädchens.
„Dürfen wir nicht hinein?“ fragt Alfred höflich.
„Bedaure — ich habe die strikteste Weisung — —“
„Die junge Dame ist seine Tochter —!“
„Auch das kann nicht helfen. Auf jeden Fall muss ich den Arzt erst befragen.“
„Dann fragen Sie, bitte! Wenn’s geht, sofort!“
„Wollen die Herrschaften solange in diesen Warteraum treten?“
Alfred und Edith betreten das kleine Zimmer. Das Mobiliar besteht aus einem ovalen Tischchen, einigen Stühlen und einem Bild, das einen Arzt im Kreise von seinen Schülern bei einer Operation zeigt. Auf dem Tisch eine Karaffe mit Wasser, zwei Gläser.
„Edith!“ sagt Alfred und fasst nach der Hand des Mädchens, „mir trägst du es doch nicht nach, dass gerade mein Vater — —?“
Ein mildes Lächeln umspielt ihre Lippen. „Alfred, — du weisst, wie ich zu dir halte. Die geistige Feindschaft zwischen unseren Vätern hat unserer Liebe bisher keinen Abbruch getan, — — wie sollte es dieser unglückliche Zufall vermögen!“
Alfred zupft nervös an seiner Krawatte, die genau passend zu dem eleganten Anzug gewählt ist. Er denkt an das ewige Versteckenspiel, das sie beide mit ihrer Neigung zu treiben gezwungen sind.
„Ich danke dir!“ sagt er, „auch mein Vertrauen zu dir steht unerschütterlich fest. Schwierigkeiten sind dazu da, um überwunden zu werden.“
Die Schwester kommt, um zu melden: „Das Fräulein darf zu ihrem Herrn Vater, — sonst aber niemand.“
Alfred nimmt Abschied von Edith: „Dann bin ich hier also überflüssig. Ich werde heute am Nachmittag, wie gewöhnlich, vor der Anatomie sein.“
„Schön. Ich erwarte dich. Lebe wohl!“
Der junge Mann eilt nach Hause. Die Dienerschaft ist noch auf. Keiner wagte sich wieder hinzulegen. Alfred muss erst ein Machtwort sprechen.
Er geht in das Arbeitszimmer des Vaters, in dieses Museum von alten und neueren Fachzeitschriften, die rings zu grossen Haufen gestapelt liegen.
Hier verfasst er zunächst einen langen Bericht über die Vorgänge in der Nacht. Es ist nun mittlerweile fünf Uhr geworden. Die erste Tageshelle stieg zaghaft auf.
Alfred nimmt eine eiskalte Dusche. Nur munter bleiben! Die Nerven stählen. Er weiss, dass ihm manches Schwere bevorsteht.
Um sechs Uhr eilt er mit seinem Wagen zum Tattersall, klingelt die Leute raus, lässt sich seine Rappstute satteln. Dann tobt er sich galoppierend auf den Reitwegen der grossen städtischen Anlagen aus.
Punkt acht Uhr lässt er sich in der Privatwohnung von Justizrat Brangheimer melden.
„Herr Justizrat ist vor neun nicht zu sprechen!“ bedeutet das Mädchen, das ihm geöffnet hat.
„Für mich doch! Bringen Sie meine Karte hinein, liebes Kind — sagen Sie, dass es ganz dringend wäre — — und hier ist ein Taler für Sie — — für den nächsten Rummel am Sonntag!“
Das Mädchen verschwindet, sichtlich verlegen, um bald zurückzukehren und ihm zu melden: „Herr Justizrat lässt bitten, einen Augenblick Platz zu nehmen.“
5. Kapitel
Justizrat Brangheimer tritt in den elegant eingerichteten Salon. Er ist ein alter Freund des Professors und hat sein Wohlwollen auch auf den Sohn übertragen. Trotzdem ein wenig den Unwirschen spielend, kommt er fragend auf Alfred zu:
„Na — zu so früher Stunde hetzen Sie mich aus den Federn, mein lieber Herr Köster? Was geht denn vor?“
Alfred verneigt sich höflich, mit vollendeter weltmännischer Grazie.
„Ich muss schon um Entschuldigung bitten, — — aber wenn es nicht wirklich sehr dringend wäre —“
„Na — also schiessen Sie los!“
In kurzen Zügen berichtete Alfred, was in der Nacht geschah. Der Justizrat wird aufmerksam, runzelt die Stirn — trommelt nervös mit den Fingern auf die Platte des Tisches.
„Hm — — ja — — — das ist wirklich eine sehr peinliche Sache. Natürlich werde ich mich sofort für den Vater bemühen. Und sollte es wirklich zu einer Verhandlung kommen — — aber das wollen wir doch nicht hoffen.“
„Was raten Sie mir zu tun, Herr Justizrat?“
„Sehr einfach: erstens bringen Sie Ihrem Herrn Vater alles, was ihm den Aufenthalt in der Haftzelle erleichtern könnte. Zweitens forschen Sie nach dem vermeintlichen Schatten, auf den er geschossen hat. Am besten nehmen Sie dazu einen tüchtigen Privatdetektiv. Ich könnte Ihnen da einen empfehlen.“
„Ja — bitte?“
„Ein Italiener — fabelhaft tüchtig — — wenigstens nach den Erfolgen zu urteilen, die mir von ihm bekannt geworden sind.“
„So! Und wer ist das?“
„Hajo Sogalla — — er ist auch nicht teuer —.“
„Das spielt ja kaum eine Rolle, Herr Justizrat. Vor allen Dingen: der Mann ist gut?!“
„Dafür bürge ich. Rufen wir ihn doch gleich einmal an.“
„Das wäre sehr liebenswürdig.“
Schon hat der Justizrat das Tischtelefon zur Hand genommen, gibt seinem Vorsteher den Auftrag, ihn mit dem betreffenden Büro zu verbinden.
Nach einer Minute ist Herr Sogalla am Apparat.
„Herr Justizrat — Sie wünschen?“
„Habe fabelhafte Sache für Sie, Herr Sogalla. Professor Köster —“
„Ah — Kösters Schuss auf den Schatten! Ich weiss schon — ich weiss schon!“
„Sie wissen?“
„Nun ja — aus der Morgenzeitung.“
„Ah — die habe ich noch gar nicht gelesen. Aber Herr Köster junior ist eben bei mir — ich habe Sie ihm empfohlen.“
„Gut — in einer halben Stunde werde ich mich in der Villa von Köster melden.“
„Ich danke Ihnen.“
„Gar keine Ursache. Empfehle mich, Herr Justizrat!“
„Haben Sie gehört? Haben Sie gehört?“ fragt Brangheimer seinen Besucher, „ach nein — richtig — — Sie konnten ja gar nicht hören. Also: die Sache steht bereits in der Morgenzeitung. In einer halben Stunde will Herr Sogalla in Ihrer Villa sein.“
„Haben Sie die Zeitung da, Herr Justizrat?“
„Sie wird inzwischen gekommen sein. Warten Sie!“ Der alte Herr eilt zur Türe, öffnet ein wenig und ruft hinaus: „Johanna! Die Zeitung, bitte!“
Sie wird gebracht. Gleich auf der Stirnseite liest man in grossen Lettern:
„Der Schuss auf den Schatten“,
darunter, ein wenig kleiner:
„Professor Köster erschiesst seinen Widersacher!“
„Zeigen Sie — — zeigen Sie!“ bettelt Alfred. Mit fiebernden Augen liest er:
„Ein mysteriöses Verbrechen ist in der vergangenen Nacht geschehen. Um zwei Uhr hörte man Hilferufe in der Nähe der Villa des bekannten Raketenforschers Professor Köster. Ein Wächter der Nachtbewachungsgesellschaft fand einen Herrn mit einem Brustschuss auf dem Bürgersteig liegen, den man, noch lebend, mit einem zufällig vorbeikommenden Auto zum Krankenhaus brachte.
Hier wurde festgestellt, dass es sich um den Physiker Doktor Kranz handelte.
Inzwischen gelang es der Polizei festzustellen, dass aus der Villa von Köster geschossen wurde. Man nahm den Professor fest, obwohl er behauptete, nur auf einen Schatten gezielt zu haben, der plötzlich draussen auf seiner Veranda aufgetaucht sei. Diese Behauptung klingt wenig glaubhaft, zumal in Fachkreisen bekannt ist, dass gerade der Physiker Doktor Kranz in der Wissenschaft zu den heftigsten Gegnern des alten, ein wenig sonderlichen Professors zählte. Erst kürzlich erschien ein schroffer Artikel Kösters, der Doktor Kranz auf das heftigste angriff.
Immerhin wollen wir uns weiterer Vermutungen hier enthalten, bevor die Gerichte gesprochen haben. Jedenfalls darf man auf eine sensationelle Verhandlung gefasst sein.“
Alfred schleudert das Blatt auf den Tisch.
„Empörend! Einfach infam!“ murmelt er vor sich hin. „volle Entstellung der Tatsachen! Wartet nur — Bande!“
„Beruhigen Sie sich, lieber Freund — die Presse ist häufig nur einseitig unterrichtet. Tun Sie nur Ihre Pflicht und forschen Sie weiter, — das andere ergibt sich von selbst.“
Alfred zerknüllt seine Handschuhe zwischen den Fingern. „Glauben Sie etwa an eine Schuld meines Vaters?“ fragt er mit bebender Stimme.
„Nein — ganz im Gegenteil. Doch der Schein spricht dagegen. Ich werde mein Möglichstes tun, um auch meinerseits eine baldige Klärung herbeizuführen.“
„Ich danke Ihnen — — das gibt mir Mut. Nun will ich eilen, um Herrn Sogalla zu Hause nicht zu verfehlen.“
„Ja — — eilen Sie! Alles Gute, mein junger Freund!“
6. Kapitel
Wenn Herr Sogalla nicht schielte und keine Halbglatze hätte und nicht gar so klein und dick und rundlich wäre, — dann wäre er ein hübscher Mensch.
Mit einem undefinierbaren Augenzwinkern steht er vor Alfred Köster. Man befindet sich in einem altmodischen Salon der Villa. Alfred hat ihm in kurzen Worten bereits die Vorgänge auseinandergesetzt.
„Noch einige Fragen, bitte!“ sagt Herr Sogalla.
„Fragen Sie immerzu!“
„Was halten Sie selbst von dem Schatten?“
Alfred betrachtet interessiert seine Fingernägel.
„Ich? Hm, — wahrscheinlich war es ein Einbrecher,“
„Sie glauben also, dass jemand da war?“
„Gewiss.“
„— — dass es keine Halluzination Ihres Vaters war?“
„Aber ich bitte — — Herr Doktor Thoma hat ja auch Spuren gefunden.“
„— — die ich aufnehmen werde. Es steht also fest: ein Schatten ist dagewesen. — Wie alt ist Ihr Vater?“
„Zwei- oder dreiundsechzig.“
„Er ist sehr vermögend?“
„Ja — allerdings.“
„Lebt nicht mehr mit Ihrer Frau Mutter zusammen?!“
„Woher wissen Sie das?“
„Genug, dass ich das weiss. Ihre Frau Mutter bewohnt eine Villa in Innsbruck. Sie befinden sich zeitweise dort, zeitweise hier bei dem Vater.“
„Ich staune — Herr Sogalla — —!“
„Eine Schwester von Ihnen befindet sich in einem Pensionat in Lausanne.“
„Richtig!“
„Ihr Vater ist ein etwas eigenartiger Forscher, der sich mit den Problemen der Raumschiffahrt schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Sie lächeln bisweilen über seine Phantastereien — bewundern aber im Grunde doch seine optimistische Energie, die er sich bis ins hohe Alter bewahrt hat.“
„Ganz recht — ganz recht — aber — woher wissen Sie denn das alles — —?“
„Als Detektiv muss ich vieles wissen. Eine internationale Verbrecherbande, die im Auftrage eines anderen Forschers handelt, wird sich bemühen, die wichtigsten Papiere Ihres Vaters in die Hand zu bekommen.“
„Was? — Wieso? — — — Ich verstehe nicht —!“
Sogalla lächelt, ein wenig zynisch. „Sie verstehen mich nicht. Richtig — kann ich auch nicht verlangen. Es handelt sich lediglich um Hypothesen, — — aber es wäre doch eine Möglichkeit.“
„O ja — sehr romantisch — — romanhaft — — — Sie müssen doch aber Gründe haben — — — —“
„Lassen wir diese Dinge jetzt, Herr Köster. Ich will an die Arbeit gehen. Zunächst muss ich einmal mit Doktor Thoma zusammen kommen. Dann knüpfe ich meine Fäden.“
„Hören Sie, Herr Sogalla — — ich möchte mich an den Forschungen gerne beteiligen.“
„Hm — ob Sie nicht mehr verschlimmern als gutmachen werden?“
„Ich bitte Sie, Herr Sogalla!“ Alfred quält sich ein höfliches Lächeln ab.
„Lassen wir das bis später, Herr Köster!“ eifert der Detektiv und streicht sich über die Glatze, „zunächst mache ich alleine die Vorarbeiten. Mir ist schon manche Klärung gelungen. Durch mein eigenartiges Präventivsystem — —“
„Was ist denn das für ein sonderbares System?“
„Gehört jetzt durchaus nicht hierher, Herr Köster. Aber sehen Sie, wie ich schiele? Schon deshalb bin ich geeignet, — ich kann nach zwei verschiedenen Richtungen gleichzeitig schauen. Ich schiele nicht etwa nur, ich sehe mit beiden schielenden Augen in zwei verschiedenen Richtungen. Das zu können, hat mich jahrelange Übung gekostet. — Sie wollen vielleicht nun behaupten, dadurch sei ich auch leicht zu erkennen, aber — — sehen Sie, da hilft mir die Brille wieder. Die korrigiert das ganz, wenn es darauf ankommt.“
Er setzt eine grosse, kreisrunde Brille auf. Gleich sieht er völlig verändert aus, zumal er es in der Gewalt hat, seine Gesichtsmuskeln so zu verziehen, dass er kaum zu erkennen ist.
„Ja — Mimik, verehrter Herr Köster — das ist es! Ich will mich verpflichten, morgen mit Ihnen zusammenzutreffen, ohne dass Sie mich wiedererkennen. Wenn ich gar noch mit Bart und Perücke komme — und dann meine Brille —! Sehen Sie daran etwas Besonderes?“
„Nein.“