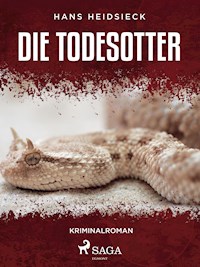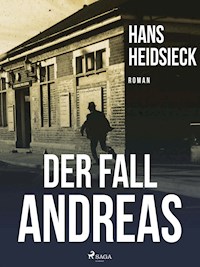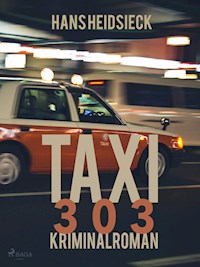Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Bankier Pierre Dupont ist auf seinem Balkon stehend erschossen worden. Kurz nach dem Mord meldet sich Gaston Orland bei der Polizei und erklärt, der Mörder zu sein. Wenig später bringt die Mordkommission den zweiten Täter, Eugene Plisier, einen Schaubudenbesitzer, zur Wache, der im gegenüberliegenden Garten mit der Waffe in der Hand steht. Eindeutig, aus dieser Waffe wurde geschossen – doch er behauptet felsenfest, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Einer der beiden lügt ... oder gibt es wo möglich einen dritten, Unbekannten?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Tat im Ungewissen
Kriminalroman
Saga
Tat im Ungewissen
German
© 1950 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508541
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Kommissar Martin legte den Hörer in die Gabel zurück. Er tat dies mit seiner gewohnten Gelassenheit, — obwohl ihm soeben ein Kapitalverbrechen gemeldet wurde. Ein Mord sogar, wenn sich die Untersuchungskommission nicht geirrt haben sollte. Aber das war wohl kaum anzunehmen. Der Fall schien nach dem, was er eben gehört hatte, ganz klar zu liegen.
Der Bankier Pierre Dupont hatte, spät abends noch, ein Buch lesend, auf der Veranda gesessen und war vom Garten her plötzlich durch einen einzigen Schuß niedergestreckt worden.
Der genaue Bericht der Kommission blieb noch abzuwarten.
Es klopfte.
Martin erhob sich und rief: „Herein!“
Sein Sekretär trat aufgeregt in die Stube. Ein Mann sei da, wolle den Herrn Kommissar unbedingt sprechen, und zwar sofort, koste es was es wolle.
Bevor der Kommissar eine Antwort gab, zündete er sich gelassen eine Zigarre an, als wollte er auch den anderen damit zur Ruhe zwingen.
„Name?“ sagte er dann kurz.
„Wie bitte?“
„Den Namen des Mannes möchte ich wissen.“
„Er nannte mir keinen Namen, Herr Kommissar, kommt mir überhaupt völlig — völlig verwirrt vor, wie geistesgestört.“
„Bringen Sie mir doch bitte den Aschenbecher vom Rauchtisch herüber. So, danke. — Also geistesgestört, sagten Sie? Gut — soll hereinkommen.“
*
Dem Eintretenden hing eine Haarsträhne wirr ins Gesicht. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Er tappte mit unsicherem Schritt auf den Kommissar zu. In seinem Gesicht spielten sämtliche Muskeln. Die Augen hatten einen fiebernden, flackernden Glanz.
„Herr Kommissar!“ stotterte er, „ich komme — Sie wissen vielleicht noch gar nicht — — — ich — — ich habe Dupont erschossen.“
Martin schob dem Mann einen Stuhl zu. Auch jetzt verriet nichts an ihm, daß er irgendwie aus der Fassung zu bringen wäre. Seine Gelassenheit wirkte auf den anderen geradezu eine aufreizende Wirkung aus. Nein, er setzte sich nicht. Wie kann er sich setzen — — mit einer solchen Schuld auf dem Gewissen! Ein Verbrecher, den man verurteilen, vor dem man ausspucken wird.
„Sie — — Sie haben wohl nicht verstanden, Herr Kommissar, ich — — ich bin der Mörder des Bankiers Pierre Dupont.“
„Ich glaube eher, daß Sie mich nicht verstanden haben“, entgegnete Martin, an seiner Zigarre drehend, „ich bat Sie, zunächst einmal Platz zu nehmen.“
Der nächtliche Besucher schien hin und her zu torkeln. Sollte er etwa betrunken sein?
„Nein, danke!“ rief er mit sich überschlagender Stimme, „ich nehme nicht Platz. Sie können mich doch gleich abführen lassen. Warum verhaften Sie mich denn nicht?“
„Weil ich auf Ihre Behauptung allein noch nichts geben kann, mein Herr! Sie scheinen mir überhaupt einen über den Durst getrunken zu haben.“
Der Befragte strich sich rasch und nervös über den kurzen Spitzbart und wich einen Schritt zurück.
„Ich — getrunken? Allerdings — etwas, ein wenig. Zwei Glas Whisky. Um mir Mut zu machen. Mut. Jawohl. Ein professionierter Mörder bin ich ja schließlich nicht. Das will alles gelernt sein. — —“
Martin zweifelte einen Augenblick: redet der Mann wirklich irr? Sollte er etwa tatsächlich betrunken sein? Ein Mörder?
Die Angelegenheit kam ihm äußerst merkwürdig vor. Er ging auf den Fremden zu, legte ihm eine Hand auf die Schulter und drückte ihn so auf den Stuhl herunter. Dann nahm er selber an seinem Schreibtisch Platz.
„Also bitte — erzählen Sie — was ist vorgefallen?“
Der Mann sprang wieder empor. Er war nicht zu halten. „Aber ich habe es Ihnen doch schon deutlich gesagt. Ich habe Dupont erschossen?“
„Erschossen?“
„Jawohl! Hier bitte — sehen Sie, das ist der Revolver! Nehmen Sie, nehmen Sie.“
Er warf seinen Trommelrevolver vor den Kommissar auf den Tisch. Martin nahm das Ding zur Hand, löste das Magazin aus und betrachtete es lange und ausgiebig, ohne sich irgendwie dabei zu beeilen. Das Magazin war für sechs Kugeln eingerichtet. Ein Schuß fehlte. Der Lauf war geschwärzt.
„Hm — hm — wer sind Sie denn?“ fragte er langsam.
„Wer ich bin? Ah — Sie kennen mich nicht? Nein — Sie können mich auch nicht kennen. Ich bin ein ganz unbedeutender kleiner Bürovorsteher. Gaston Orland ist mein Name. Gaston Orland, Mörder.“
Martin legte die Waffe vor sich hin. Stille. Vor den Fenstern rasselten die Jalousien. Sie wurden vom Sturm hin und her geschlagen.
*
Die Kommission befand sich noch am Tatort. Alles wurde genau aufgenommen. Der Fotograf hatte zu tun. Blitzlicht flammte auf, und der Arzt untersuchte den Toten.
Die Dienerschaft wurde verhört. Doch niemand konnte etwas Rechtes sagen. Es war keiner dabei gewesen. Dupont hatte allein auf der Veranda gesessen. Erst als Philippe, der Diener, kam, um den Herrn zu fragen, ob man ihn noch benötige, da es schon spät sei — erst da hatte man das Unglück bemerkt.
Wurden denn keine Schüsse gehört?
Nein.
Der alte Diener stand wie eine Bildsäule da. Neben ihm Mademoiselle Ardenne, die Hausdame, steif, korrekt, völlig benommen. Das Hausmädchen Eglantine hockte in einer Ecke und weinte still vor sich hin.
Wo sich die Angestellten während der Zeit befanden? Eglantine hatte noch Geschirr abgewaschen. Philippe befand sich bei ihr in der Küche und putzte an einem Messingleuchter herum. Die Hausdame hatte sich zur Ruhe begeben. An diesen Feststellungen war nicht zu zweifeln.
„Hat Ihr Herr oft Besuch empfangen?“ fragte der Kriminalsekretär, der die Angelegenheit leitete.
Philippe schien erst nachdenken zu müssen.
Mademoiselle Ardenne nahm ihm die Antwort ab. „Nein“, sagte sie, „äußerst selten. Heute allerdings war ein Herr da —“
„Ein Herr? Ah! Wer denn?“
„Ich kenne ihn nicht, Herr Kommissar, — aber er hat Herrn Dupont öfter aufgesucht. Wenigstens von Zeit zu Zeit. Manchmal ließ er sich auch monatelang nicht blicken.“
„Sie kennen ihn wirklich nicht?“
„Nein, wirklich nicht.“
„Aber er mußte sich doch irgendwie melden lassen“, wollte jetzt der Kommissar von Philippe wissen.
„Nein — das heißt —“, sagte der Diener hüstelnd, „wenn der Herr kam, sagte er immer nur, Herr Dupont wisse bereits Bescheid. Ich erhielt auch den Auftrag, ihn stets gleich vorzulassen.“
„Hm. Können Sie eine Beschreibung geben?“
„Gewiß. Er war klein, ziemlich dick. Auffallend war eine Warze auf seiner Stirn, an der linken Seite.“
„Wie ging er gekleidet? Gut — einfach?“
„Etwas altmodisch — wenn ich so sagen darf. Meistens hatte er einen karierten Anzug an. Heute auch wieder.“
„Für was hielten Sie ihn?“
Fräulein Ardenne mischte sich wieder ein. „Wahrscheinlich war er ein Schmetterlingssammler.“
„Ein Schmetterlingssammler? Verstehe ich recht?“ fragte Sekretär Léon verwundert, während er an seiner Krawatte zupfte.
„Ja, ganz recht, Schmetterlingssammler. Monsieur hatte nämlich eine Vorliebe für solche Tiere; er besitzt riesige Sammlungen, ein Zimmer hängt voll davon, alles schön aufgespießt unter Glas. Es sind sehr seltene Exemplare darunter.“
„So so — und Sie meinen also, daß dieser andere Herr, dieser geheimnisvolle Besucher, ihm neue Schmetterlinge brachte?“
„Das nahm ich an, ja. — Heute schienen die beiden sich allerdings etwas gezankt zu haben. Jedenfalls hörte ich sie einmal sehr aufgeregt debattieren. Verstehen konnte ich aber nichts.“
Léon machte Notizen. Er fragte noch nach verschiedenen Einzelheiten. Dann wurde die Richtung ermittelt, aus der der tödliche Schuß abgefeuert sein mußte. Man ging durch den Park zur Straße, leuchtete alles ab. Jenseits der Straße glaubte der Kriminalsekretär ein Geräusch zu vernehmen. Es kam aus dem Nachbargrundstück. Er lauschte. Hatte er sich getäuscht?
Seine Taschenlampe spielte über die Sträucher und Bäume hin. Der Strahl blieb an einem Tuchfetzen hängen. Kurzerhand schwang sich Léon über den Zaun. Gleich darauf hörte man sein erstauntes „Ah!“
Einen völlig verschüchterten Mann hinter sich herschleifend, kam er wieder zum Vorschein. Der so unerwartet Entdeckte wurde über den Zaun gezogen. Man hielt ihn fest.
Im Scheinwerferlicht des Polizeiautos, das vor dem Eingang der Villa stand, nahm man ihn näher in Augenschein.
Der Mann trug einen karierten Anzug. Auf seiner linken Stirnhälfte saß eine Warze.
Léon durchsuchte ihm rasch die Taschen. Man fand eine Waffe, aus der zwei Schüsse abgefeuert waren.
Der Mann wurde festgenommen.
Kommissar Martin ließ sich von seinem seltsamen Selbstankläger den Vorgang beschreiben. Während der Mann, erst noch stotternd und unzusammenhängend, berichtete, schien er nach einer Weile doch seine Fassung wiederzufinden. Er hatte sich sogar wieder hingesetzt.
„Ja, sehen Sie“, sagte er, „das ist alles so — so über mich hergefallen. Ich habe ihm eigentlich nur einen Denkzettel geben wollen, wahrhaftig, Herr Kommissar.“
„Einen Denkzettel? Ah — also ein — Racheakt.“
„Ja, gewissermaßen — das heißt — mir selbst hat er eigentlich gar nichts getan. Aber den Vater meiner Frau, der sein Bruder war — den hat er doch um seinen ganzen Erbteil betrogen, indem er ihm damals minderwertige Aktien angedreht hatte — ich weiß die Geschichte nicht so genau.“
„Der Tote war also ein Onkel von Ihrer Frau?“
„Ja, ich nannte ihn auch so.“
„Wie?“
„Onkel. Er lud uns manchmal in die Villa ein. Aber nur so der Form halber — aus Pflichtgefühl, besser, aus Schuldbewußtsein.“
„Ist es denn zwischen ihm und Ihnen zu Auseinandersetzungen gekommen?“
„Nein. Das gerade nicht. Aber meine Frau — meine Frau haßte ihn.“
„So! Da hat Ihnen Ihre Frau wohl sozusagen den Tip gegeben — —?“
Orland schien plötzlich in sich zusammenzufallen.
„Ja!“ hauchte er, „schon seit Jahren hat sie mir zugesetzt. Sie wissen ja gar nicht, wie so eine Frau einem zusetzen kann. Oder sind Sie verheiratet, Herr Kommissar?“
„Das gehört jetzt wohl nicht hierher!“ erwiderte Martin mit einem ganz feinen Lächeln.
„Ja — also — es muß mir ja doch herunter von meiner Seele. Hat mich schon lange genug gequält — und schließlich zu dieser entsetzlichen Tat getrieben.“
Der Kommissar wurde aufmerksam. Nach dem Zucken in seinen scharfen Zügen zu urteilen, schien in ihm etwas vorzugehen.
„Ja“, fuhr der andere unaufgefordert fort, „getrieben. Sie hat mich zu dieser Tat getrieben. Und wie! Davon können Sie sich gar keine Vorstellung machen. Geradezu tropfenweise hat sie mir das Gift eingeflößt, dieses schleichende Gift der Verbitterung, in der sie sich selber schon vollkommen festfraß. Erst waren es nur kleine Sticheleien, Herr Kommissar. Jawohl. Bis sie dann immer deutlicher wurde. Es sei eine Schande, behauptete sie, daß dieser Mann, der sein ganzes Vermögen doch nur durch Betrug und Gemeinheit erlangt habe, — also, daß der so im Fett säße, während wir uns mit den zwei Kindern kümmerlich durchwürgen müßten. Jawohl. Und so ist es auch. Kümmerlich. Sie wissen nicht, was das heißt, Kinder großzuziehen. Da fehlt es bald hier, bald dort am Nötigsten. Und anständig angezogen will man doch auch gehen, nicht wahr? Ja. Und wir hätten es genauso gut haben können, wie dieser Onkel, wenn er eben nicht meinen Schwiegervater betrogen hätte. Jawohl!“
„Na — und — wie kam es dann endlich zu der Tat?“
„Wie es immer, oder doch meistens zu einer Tat kommt, Herr Kommissar: langsam, doch zwangsläufig, so von innen heraus, bis man völlig verblendet ist und dann sozusagen gar nicht mehr weiß, was man eigentlich tut.“
Martin sah den Sprecher mit einem Blick an, der mehr als eine Amtsmiene war. Diese Geschichte — sagte er sich — hatte ganz andere Hintergründe, als es gewöhnlich der Fall war. Hier wirkten Motive mit, die man zum mindesten etwas verstehen konnte. Irgendwie nahm er Anteil an diesem unglücklichen Menschen, der ihm da seine Herzensnot schilderte. Jedenfalls witterte er bereits, daß kein gemeiner Racheakt vorlag, daß sich die Dinge noch ganz anders entwickeln konnten.
„Sie stehen wohl stark unter dem Einfluß Ihrer Frau?“ sagte er.
Der andere senkte beschämt den Kopf. „Ja“, erwiderte er, „leider muß ich das eingestehen. Leider. Ich war zu vernarrt in sie, als sie noch jung war — und das wußte sie auszunutzen. Es wurde für mich ein Martyrium. Ich wurde zu einem Werkzeug in ihren Händen. Schließlich hatte ich gar keine Ruhe mehr. Tag und Nacht hat sie mir zugesetzt. Dann ist es schließlich soweit gekommen.“
„Und Sie schämen sich gar nicht, sich von einer Frau beherrschen zu lassen?“
„Herr Kommissar — verzeihen Sie — aber ich glaube, jeder Mann wird mehr oder weniger von seiner Frau beherrscht.“
„Ach, das ist Unsinn“, entgegnete Martin ärgerlich, „wer das tut, ist in meinen Augen kein Mann mehr.“
Orland schwieg zerknirscht. Endlich bemerkte er:
„Jedenfalls, Herr Kommissar, sollen Sie mich auch nicht mißverstehen. Ich will mich damit gar nicht entschuldigen. Ganz im Gegenteil. Es war meine Tat und ich muß auch dafür verurteilt werden. Vielleicht — ja — vielleicht habe ich eben durch diese Tat nur den furchtbaren Bann einmal brechen wollen.“
„Kommen wir wieder zur Sache“, lenkte Martin ruhig ein, „bitte erzählen Sie, wie sich dann alles zutrug.“
Orland strich sich über die Stirn, als ob er sich erst besinnen müßte.
In diesem Augenblick wurde die Tür geöffnet. Léon trat ein.
*
„Ah! Léon!“ rief Martin, „nun — ich glaube, Sie brauchen sich nicht mehr viel um den Fall zu bemühen.“
Der Sekretär sah ihn verblüfft an. „Wieso?“ fragte er, „allerdings, wir haben den Täter schon, wenn nicht alles trügt. Aber wie können Sie wissen — —?“
Martin drückte auf einen Knopf. Dann wandte er sich wieder Orland zu, der Léon verständnislos ansah.
„Ich lasse Sie jetzt in die Haftzelle führen, Monsieur Orland. Alles Weitere findet sich. Morgen früh werden wir weiterreden. Ich muß erst noch mit diesem Herrn hier sprechen.“
Orland wurde hinausgeführt.
„Also, was gibt es — Sie haben den Täter?“
Der Sekretär berichtete in knappen Worten. Sein Vorgesetzter hörte ihm ruhig zu. Dann bemerkte er:
„Wenn ich Ihnen nun aber sage, daß ich den Mann, der eben dies Zimmer verließ, für den Täter halte?“
Léon zuckte zusammen. „Was, diesen Mann? Aber wieso denn?“
„Wieso? Also hören Sie — —“
Eingehend berichtete Martin nun seinerseits, was er eben erfahren hatte. Léon zog seine gedrungene Stirn in Falten. Der Fall schien wirklich nicht so einfach zu sein, wie es vorerst den Anschein hatte.
„Haben Sie Ihren Täter denn schon vernommen?“ fragte Martin, als er geendet hatte.
Léon rückte nervös hin und her. „Es ist nichts aus ihm herauszubekommen“, erwiderte er, „aber ich fand Papiere auf den Namen Eugene Plissier, Schaubudenbesitzer.“
„Schaubudenbesitzer?“
„Ja, auch die Adresse ist angegeben. Rue verte 23.“
„Also gut — vernehmen wir jetzt den Mann. Lassen Sie ihn hereinführen, bitte.“
*
Plissier war klein, gedrungen, dick. Seine Glatze wußte er mit Würde zu tragen. Die Züge des Mannes waren robust, ja, gewöhnlich. Und trotzdem nicht unsympathisch. Etwas Verschmitztes lag um die Augen, hinter denen ein Lächeln zu lauern schien.
„Herr Plissier!“ sagte Martin, „bitte nehmen Sie Platz. Wie ich höre, hat man Sie unter etwas eigenartigen Umständen festgenommen. Es dürfte in Ihrem Interesse sein, sich eingehend darüber zu äußern.“
Der Schaubudenbesitzer blickte auf seine plumpe Hand, als ob er aus ihr etwas herauslesen wollte, erwiderte aber nichts.
„Also, Herr Plissier“, sprach ihm Martin noch einmal zu, „was haben Sie uns zu erzählen? Ich kann mir kaum vorstellen, daß Sie in jenen Garten eindrangen, um nach Maiglöckchen zu suchen.“
„Nein“, erwiderte Plissier stur.
„In Ihrer Tasche wurde ein Revolver gefunden, aus dem zwei Schüsse verfeuert sind.“
„Kann sein“, war die ebenso lakonische Antwort.
„Sie haben also geschossen.“
Plissier zuckte die Achseln. Eine Antwort gab er nicht mehr.
„Ich frage Sie, ob Sie geschossen haben?“
„Nein“, immer noch starrte der Mann seine Hand an.
„Also nein. Gut. — Wollen Sie mir nun sagen, was Sie in jenem Garten zu suchen hatten?“
„Nein.“
Martin schwenkte in eine andere Richtung um. „Aber vielleicht darf ich wissen, was Sie am Nachmittag mit Herrn Dupont zu besprechen hatten?“
Der Mann zuckte merklich zusammen, erwiderte aber nur:
„Ich — bei Dupont?“
„Ja — Sie bei Dupont. Daß Sie dort waren, streiten Sie doch nicht ab.“
„Nein.“
Martin und Léon wechselten einen Blick.
„Also bitte“, fuhr der Kommissar fort, „reden Sie doch, Monsieur Plissier. Vorläufig reißt Ihnen niemand den Kopf ab.“
Der Mann blickte verängstigt auf. Um seinen Mund ging ein Zittern. Er strich sich nervös über die Glatze.
„Ich verweigere jede weitere Auskunft!“ erwiderte er.
„Das können Sie nicht, lieber Mann. Uns müssen Sie Rede und Antwort stehen. Abgesehen davon — wollen Sie sich selber ins Unglück rennen?“
„Ich — ins Unglück? Wieso denn?“
„Aber erlauben Sie — einfach ist es doch nicht, des Mordes beschuldigt zu werden.“
Plissier fuhr empor. Seine Augen weiteten sich. So starrte er den Kommissar an. „Was? Des Mordes? Ich? Aber wer ist denn ermordet worden?“
„Dupont!“
„Dupont?“
„Ja, Dupont. Sie sind verdächtig, ihn erschossen zu haben.“
„Ein Witz, Herr Kommissar. Nur ein Witz.“
Martin wurde ärgerlich. Auf seiner Stirn stand eine steile Falte.
„Lassen Sie diese albernen Redensarten! Und übrigens — wenn Sie sich unschuldig fühlen, warum wollen Sie dann nichts zu Ihrer Entlastung tun?“
„Weil meine Privatangelegenheiten gar nicht hierher gehören.“
„Das ist Auffassungssache. Sie werden doch zugeben, daß alle Umstände, die mein Kollege Léon festgestellt hat, äußerst belastend sind.“
„Ich finde das alles ganz lächerlich, meine Herren. Ich — ein Mörder! Da werden Sie sich einen anderen aussuchen müssen.“
„Also gut, Plissier — denken Sie einmal darüber nach. Es ist spät heute. Morgen werden Sie frischer sein, wir werden uns dann wieder sprechen. Für heute mag es genug sein . . .“
Plissier wurde abgeführt.
*
Frühmorgens am nächsten Tage traf Martin am Tatort ein. Nun begann seine Kleinarbeit. Das, worin Léon ihm bereits vorgearbeitet hatte, mußte von ihm im einzelnen nachgeprüft werden. Bei Tageslicht sah auch alles wieder ganz anders aus. Man konnte genauer sein.
Die Vernehmung der Angestellten brachte, wenigstens was Plissier anging, nichts Neues zutage. Martin nahm sich die Leute noch einmal vor.
Mademoiselle Ardenne stand vor ihm, groß, hager und würdevoll mit ihren verknitterten und verbitterten Zügen, in die wohl noch niemals die Sonne geleuchtet hatte.
„Herr Orland ist also mit seiner Frau öfter hier gewesen?“ fragte der Kommissar.
Die Ardenne nickte. „Ja — bisweilen. So alle zwei Monate einmal.“
„Hm. Sie kennen die Herrschaften?“
„Ja, leidlich“, erwiderte die Hausdame mit säuerlichem Gesicht, „er war immer recht still. Von Frau Alice kann man das weniger sagen.“
„Und — was hatten Sie für einen Eindruck — wie standen sie sich mit Herrn Dupont?“
„Soviel ich beobachten konnte ganz gut. Die junge Frau ging ihm ordentlich um den Bart.“
„Hatten Sie das Empfinden, daß dies wirklich herzlich gemeint war?“
„Nein. In der ganzen Art dieser Frau lag stets etwas Berechnendes. Aber das mag nur mein persönlicher Eindruck sein.“
„Eine andere Frage: halten Sie Herrn Orland für fähig, einen Mord zu begehen?“
Mademoiselle Ardenne starrte Martin betreten an. „Einen Mord — was, glauben Sie etwa — — —?“
„Bitte, antworten Sie.“
„Nein, nein — ausgeschlossen! Der — und ein Mörder? Würde ich mir nie vorstellen können. Im Gegenteil. Der hat sich ja alles gefallen lassen. Sie glauben gar nicht, Herr Kommissar, wie den seine Frau immer behandelt hat. Wie ein Stück Vieh — um es mal kraß zu sagen.“
„Er machte wohl stets einen recht bedrückten Eindruck auf Sie?“
„Ja — das ist das richtige Wort: bedrückt! Als quäle er sich mit etwas herum. Das kam natürlich nur durch die Frau. Ich habe diese aufgeblasene Person niemals leiden können.“
Dasselbe, was die Ardenne sagte, hörte Martin auch aus den anderen beiden heraus.
Er ging jetzt zur Untersuchung des Tatortes über. Nicht die geringste Kleinigkeit entging seinen scharfen, alles betastenden Augen. Vor allem suchte er auch die Veranda nach Stellen ab, an denen er vielleicht einen Einschuß entdecken könnte.
Er mochte wohl eine Stunde lang herumgesucht haben, als er in einem Pfosten tatsächlich ein Schußloch fand. Mühsam bohrte er mit dem Messer das Geschoß hervor. Dabei glitt ein befriedigtes Lächeln über seine Züge. Das hatte Léon übersehen. In der Nacht übersehen müssen.
Weitere Nachforschungen blieben ergebnislos.
Er ging in den Garten hinunter, nahm dort die Spuren ab und brachte die Abdrücke dann nach seinem Büro.
Hier fand er Léon vor, der inzwischen mit Orlands Arbeitgeber, dem Advokaten Delain, Rücksprache genommen hatte.
*
Martin warf triumphierend das Geschoß auf den Tisch. „Nun, was sagen Sie dazu, Léon?“
Der Angeredete nahm das Geschoß in die Hand, betrachtete es genau.
„Wo gefunden?“
„Im Pfosten der Veranda. Es sind also mehrere Schüsse gewesen. Vielleicht habe ich gar eine weitere Kugel noch übersehen. Doch das genügt mir schon — übrigens, was ich noch fragen wollte: hat man die Obduktion der Leiche schon vorgenommen?“
„Der Doktor will heute nachmittag hier anrufen, sagte er.“
„Gut, wenn die tödliche Kugel entfernt ist, wird man ja ihr Kaliber feststellen können. — Warum sehen Sie mich so merkwürdig an?“
Léon betrachtete das von Martin mitgebrachte Geschoß jetzt von allen Seiten.
„Dies ist das Kaliber, mit dem Orland geschossen hat“, sagte er.
Der Kommissar horchte auf. „Ah, Orland? So so — — na, dann kann er doch eigentlich gar nicht der Mörder sein.“
„Bitte, wieso nicht?“
„Aber Léon — — wo sind Ihre Gedanken? Er hat doch nur einen Schuß abgegeben! Na, und was sagte der Advokat?“
Léon berichtete. Er hatte den Anwalt eingehend nach Orland ausgefragt. Was er zu hören bekam, war ein einziges Lob gewesen. Still. Bescheiden. Vorzügliche Arbeitskraft, an Gewissenhaftigkeit nicht mehr zu übertreffen. Ein Mörder? Ausgeschlossen.
Martin kritzelte etwas auf ein Papier. „Wen halten Sie denn eigentlich für den Täter?“ fragte er seinen Gehilfen.
Der Kriminalsekretär zog die Schultern hoch. „Schwer zu sagen“, erwiderte er, „einer von beiden muß es ja wohl gewesen sein. Oder was glauben Sie?“
„Vielleicht ist es keiner gewesen.“
„Keiner? Erlauben Sie bitte, Herr Kommissar — — eine Tat ohne Täter — — das gibt es doch einfach nicht. Und Selbstmord ist ausgeschlossen.“
„Na ja — — wir werden der Sache schon auf den Grund kommen, lieber Freund. Kommissar Martin hat noch nichts in die Hand genommen, was er nicht aufklären konnte. — Wann kommt Orland vor den Untersuchungsrichter?“
„Er dürfte schon dort sein.“
„Gut.“
*
Der Untersuchungsrichter zuckte zusammen, als ihm der Name Orland zu Ohren kam. Der Sekretär war ein entfernter Verwandter von ihm, und er kannte ihn schon seit langem. Der stille, ruhige, immer sehr freundliche Mensch war ihm stets sehr sympathisch gewesen. Man traf sich bisweilen in einem Stammlokal, wo man beim Schachspiel beisammen saß. Orland war ein guter Schachspieler, und Richter Artois ebenfalls. Gern maßen sie ihre Kräfte und feierten dann den Sieg des einen oder des anderen mit einem Freundschaftstrunk.
Der Mann wurde hereingeführt. Artois erhob sich. Er starrte den Vetter betroffen an. Der — ein Mörder? Hm — — —
Orland trat mit gesenktem Haupt an den Tisch. Er machte einen völlig gebrochenen Eindruck. Den Gruß seines Vetters erwiderte er so leise, daß er kaum zu vernehmen war.
Auch Artois schien befangen zu sein. Eigentlich hätte er diese Angelegenheit doch einem seiner Kollegen überantworten sollen, dachte er. Andererseits konnte jedoch gerade er den Verdächtigen von der menschlichen Seite pakken.
Er rückte nervös sein Tintenfaß hin und her.
„Nehmen Sie Platz, Orland!“ sagte er freundlich. „Sie wissen, ich muß Sie jetzt einmal in meiner dienstlichen Eigenschaft sprechen. Aber du lieber Himmel — was ist denn auf einmal mit Ihnen geschehen? Sie klagen sich selber des Mordes an? Also schön — erzählen Sie einmal der Reihe nach.“
Orland hielt seine Hände verkrampft auf den Schenkeln und blickte den Richter wie eine Erscheinung an.
Zögernd begann er wiederum das zu sagen, was er dem Kommissar bereits mitgeteilt hatte. Artois hörte ihm ruhig zu. Nur von Zeit zu Zeit warf er eine Frage dazwischen. Einmal wurde er unterbrochen. Es klopfte, und ein Beamter legte ihm irgendein Schriftstück vor. Dazu noch einen ganz kleinen Gegenstand.
Während Orland immer lebhafter seine Gedanken und Gefühle zu schildern begann, ruhte der Blick des Richters angelegentlich auf dem Papier. Den kleinen Gegenstand, eine Patrone, hielt er dabei wie abwägend in der Hand. In seinen Zügen spiegelte sich eine starke Erregung ab.
Orland sprach jetzt von der Ausführung seiner Tat. „Ja“, sagte er, „also, ich schlich mich dann in den Park und gegen das Haus vor, jawohl, wo Dupont auf der Veranda saß. Ich sah ihn ganz deutlich sitzen. Ein Buch in der Hand. Neben ihm eine Stehlampe. Er las. Ich wartete nur noch, bis das Auto kam.“
Der Richter hörte verwundert auf. „Welches Auto?“ fragte er rasch.
„Ja — natürlich. Das muß ich Ihnen erklären. Irgendwo in der Nachbarschaft meines Onkels muß ein Autobesitzer wohnen, der mit seinem Wagen nicht richtig umzugehen versteht. Jawohl. Jedenfalls —“
„Aber erlauben Sie — — was hat dieses Auto mit Ihrer Tat zu tun?“
„Hören Sie mich nur an, Artois. Ich wollte es eben sagen. Jawohl. Also das Auto. Der Wagen knatterte immer furchtbar. Da muß an der Zündung etwas nicht in Ordnung gewesen sein. Oft genug krachte es, als ob jemand geschossen hätte — —“
„Ah!“
„Ja. Jetzt werden Sie schon verstehen. Ich wollte mir dieses Auto zunutze machen. Wenn das gerade vorbei kam, konnte ich schießen, ohne befürchten zu müssen, daß der Knall irgendwie auffiel. Begreifen Sie nun?“
„Ich verstehe. Aber wie konnten Sie wissen, daß gerade das Auto kam?“
„Ich war schon tagelang um das Haus geschlichen. Und jede Nacht kam das Auto, fast genau um dieselbe Zeit. Und fast jedesmal knatterte es und krachte, daß man in einem fort Schüsse zu hören glaubte.“
Artois sah seinen Vetter aufmerksam fragend an.
„Sie haben also die Tat gewissermaßen von langer Hand vorbereitet?“
„Nein, das eigentlich doch nicht. Das heißt — — ich hatte sie immer schon vor. Aber mir fehlte der Mut noch, und dann, im letzten Augenblick, schreckte ich wieder davor zurück. Jawohl. Bei diesen Gelegenheiten hatte ich nun die Entdeckung mit dem Auto gemacht.“
„Sie standen dann also im Garten und gaben den Schuß ab?“
„Ja. Diesmal hatte ich — wie soll ich sagen? — keine Hemmungen mehr. Ich hatte mir Mut angetrunken. Zwei Whisky. Da ich sonst nie viel trinke, spürte ich auch schon die Wirkung. Ich war wie benebelt. Und die Erregung kam noch dazu. Ich glaube, es flog richtiggehend alles an mir.“
„Und dabei konnten Sie doch noch zielen?“
„Zielen? Ja so — — natürlich. Ich zielte. So gut es ging. Und ich traf auch. Entsetzlich war es, wie ich dann gleich nach dem Schuß den Kopf meines Onkels auf die Brust sinken sah. Ich war wie gebannt von dem schrecklichen Anblick. Ob er noch aufschrie, kann ich nicht sagen. Das Auto knatterte immer noch auf der Straße. Da habe ich wohl seinen Schrei nicht gehört. Aber geschrien hat er doch ganz gewiß. Lieber Himmel, hätte ich nur den Mut gefunden, mich selber auch gleich umzubringen. Aber ich konnte die rauchende Waffe bei meiner Erregung kaum noch zwischen den Fingern halten. Wie ich dann über den Zaun kam, weiß ich nicht mehr. Ich tappte wie ein Verirrter dahin. Einmal war es mir so, als husche an mir eine Gestalt vorüber, direkt auf der anderen Straßenseite. Doch mir war schließlich alles egal.“
„Und dann packte Sie schon die Reue, nicht wahr? So daß Sie sich selber stellten?“