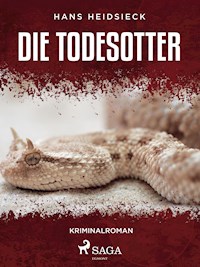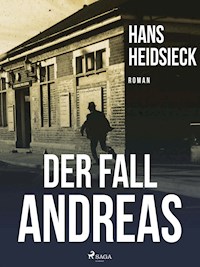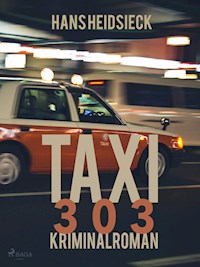Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Wirbelwind ausgewöhnlicher Geschehnisse braust innerhalb von drei Tagen über Rio de Janeiro hinweg. Erst wird eine Bank überfallen, dann wir das Spielkasino an der Copacabana geplündert und schließlich wird auch noch eine Millionenerbin entführt. Als Urheber all dieser Taten wird Borboleta – der blaue Falter – vermutet, ein geheimnisvoller Mann mit hundert Gesichtern. Überall ist er Stadtgespräch, in jedem Lokal, jedem Club, auf jeder Gasse wird nach ihm gesucht. Doch der phantomhafte Verbrecher weiß sich immer wieder aufs Neue allen Nachforschungen zu entziehen; stets findet er in letzter Sekunde doch wieder einen Ausweg. "Onkel Joaquim", der kleine Mann mit dem Seehundsgesicht und Bruder von Dona Mariana, der Gattin des Bankiers Affonso de Mello, will sich das nun endgültig nicht mehr bieten lassen, und beschließt, dem scheinbar Unbezwingbaren endlich das Handwerk zu legen ... Ein raffinierter exotischer Krimi, den man, einmal angefangen, nicht mehr aus der Hand legen will.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Der blaue Falter
Kriminalroman
Saga
Der blaue Falter
German
© 1940 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508572
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Vom gleichen Verfasser:
Der Fall Andreas
Spur des Grauen
Die verschleierte Frau
Das blaue Licht
Post aus Afrika
Das Lächeln der Sphinx
Mord im Chicago-Expreß
Der Schrei im Nebel
Lagerschuppen 13
Kommissar Holl räumt auf
Das tödliche Erbe
Verlorenes Spiel
Die schwarze Maske
Tankstelle 17
Drei Herren von Scotland Yard
Das Wachsfigurenkabinett
Falsche Fährte
Hafengasse 23
Das Gesicht am Fenster
Personen des Romans:
Die Handlung spielt sich innerhalb von drei Tagen in Rio de Janeiro ab.
Zeit: Gegenwart.
Es war eine Sinfonie des Lichts. Perlenschnüre glitzernder Bogenlampen, ein leuchtendes Festgeschmeide, zogen sich an den Kais und die prächtigen Avenidas von Rio de Janeiro entlang.
Funkelnde Lichtketten rankten sich an den Hängen und Bergen hinauf.
Illuminierte Schiffe hoben sich von der phosphoreszierenden Wasserfläche des riesigen Hafens ab.
Nur ein Haus lag im Dunkel. Es hatte an diesem Freudentaumel des Lichts keinen Anteil mehr. Hier hatten Mächte der Finsternis einen grausigen Sieg davongetragen.
Alarmsignale!
Ein Polizeiwagen bricht sich Bahn.
Autos und Elektrische stoppen. Die Menge spritzt auseinander. An den Tischen, vor den Kaffees auf den Bürgersteigen, reckt man die Hälse hoch: Was ist los?
Das Licht flutet, der Wagen rast weiter.
Ein Feuerrad dreht sich vor einem Vergnügungspalast. Menschen drängen sich an die Kassen. „Zwei Parkettsessel, bitte!“ — „Hallo, Bonifacio — du auch hier?“
Ein grelles Plakat schreit den Leuten entgegen: ‚Mimosa tanzt!‘.
Um das eine Haus kroch die Finsternis, — schlich der Tod ...
Der Polizeiwagen näherte sich, knirschend radierten die Räder an einer jähen Kurve den heißen Asphalt.
Die Alarmglocke schrie ...
Zwei Männer blickten dem Wagen erschrocken nach. Der eine sagte: „Das war die Mordkommission!“
*
Im Spielkasino von Copacabana, einem der südlichen, vornehmen Stadtteile Rios, warf am Roulettetisch ein elegant gekleideter Herr mit gelassener Miene ein Geldnotenbündel auf die Zahl siebenundzwanzig.
Der Croupier zählte die Summe nach. Dann fragte er sachlich:
„Höchstsatz, mein Herr?“
Der Spieler nickte. Er klemmte sich ein Einglas ins linke Auge und verfolgte mit dem Blick die bereits rollende Kugel, als ob er sie hypnotisieren wollte.
Die Umstehenden starrten den Herrn an.
Als die Kugel in eine Rille gefallen war, rief der Croupier:
„Siebenundzwanzig!“
Der Herr nickte wieder, als ob das eine Selbstverständlichkeit sei. Ohne mit einer Wimper zu zucken, strich er das viele Geld ein, das ihm auf den Tisch gezählt wurde, erhob sich und schritt zur Kasse, um die Jetons umzutauschen.
Zwei Damen, zu elegant aufgeputzt, um noch vornehm zu wirken — und dadurch schon ihren wahren Beruf verratend, folgten dem Mann.
Er lächelte, sagte mit einem höflich-bedauernden Klang in der Stimme: „Es tut mir sehr leid — ich bin schon verabredet!“, drückte jeder einen Hundertmilreisschein in die Hand — und ward nicht mehr gesehen.
Ein Saaldiener, uniformiert wie ein Operettenprinz, trat auf den Oberspielleiter zu und überreichte ihm einen blauen Falter, der an einer Nadel aufgespießt war.
„Was soll das, Mann?“
„Der Falter war an die Lehne des Sessels gesteckt, Cavalheiro, in welchem der Herr saß, der eben das viele Geld gewann.“
„Ich bitte, das Spiel zu machen!“ rief der Croupier.
*
Das Haus, das im Dunkel lag, barg die Privatbank der Familie de Mello. Es war keine große, aber es war eine gut fundierte und sehr angesehene Bank.
Die Geschäftsräume lagen im Erdgeschoß.
Scheinwerferstrahlen waren durch die verlassenen Räume gehuscht, hatten sich an den Wänden entlanggetastet.
Glitzerndes Licht spiegelte sich in den leeren, toten, erloschenen Augen eines erschossenen Mannes.
„Der Nachtportier!“ flüsterte ein Beamter.
Kommissar Branco trat in den Tresorraum.
Seltsam — der große Tresor war geöffnet, aber nicht aufgeschweißt. Die Schlüssel steckten. Sämtliche Fächer waren herausgezogen und ausgeraubt.
Der Kommissar leuchtete gegen die blanke Wandung der Tür.
„Fingerabdrücke, Herr Kommissar?“
Der Kommissar brummte: „Nichts!“
Eine alte Fregatte — in eine moderne Bar verwandelt, bis in die Mastspitzen illuminiert, schaukelte auf den Wellen der Bucht von Botafogo und spiegelte sich verschwimmend und glitzernd im Wasser.
Jenseits dieses seltsamen leuchtenden Schiffes, von der Avenida Beiramar aus gesehen, zeichnete sich als Silhouette der Pão d’Assucar, der Zuckerhut, gegen den sternenübersäten Nachthimmel ab.
Wie ein riesiger Leuchtkäfer schwebte die kleine Kabine der im Jahre neunzehnhundertunddreizehn von einer Kölner Firma erbauten Drahtseilbahn über üppige Waldungen auf den dreihundertsiebenundachtzig Meter hohen Gipfelpunkt zu.
Rasche Motorboote, eine auserlesene Menschenfracht bergend, jagten geschäftig zwischen Fregatte und Strand hin und her ...
Hoch schlugen die Wellen des Vergnügungsbetriebs in der Bar. Menschen aller Gattungen, aller Farben und aller Nationen — sofern sie nur gut gekleidet waren — konnten hier ihrem Temperament je nach Neigung die Zügel schießen lassen. Es gab ein Kino — es gab einen Spielsaal und zahlreiche in bunten Farben erleuchtete gläserne Tanzflächen. Dazu eine Reihe ausgezeichneter Samba-Kapellen, von denen unermüdlich die neuesten Schlager zu Gehör gebracht wurden.
Während der Tanzpausen traten Artisten auf. Eine Pariser Ballettgruppe zeigte viel Gewandtheit und zartes Fleisch ...
In einer Loge saß ein einzelner Herr und hatte den Kopf an einen mit vergoldeten Ornamenten reichlich gezierten Pfeiler gelehnt. So hockte er regungslos schon eine ganze Weile da. Niemand kümmerte sich um ihn.
Eine Tänzerin streifte an den Logen vorbei. Sie bemerkte den Mann und klopfte ihm auf die Schulter.
„Nun, altes Walroß!“ rief sie, „hier schläft man doch nicht!“
Der Herr schrak zusammen, zwinkerte mit den Augen, sah verstört um sich und rieb sich über die Stirn. „Was ist denn los?“ fragte er.
„Gar nichts ist los — und mit Ihnen erst recht nicht!“ lachte das Mädchen, „haben Sie etwas Schönes geträumt, Senhor?“
Der Herr tastete an sich herum. Er fuhr hastig in alle Taschen. „Wo sind meine Schlüssel?“ stotterte er.
„Ach, lassen Sie doch Ihre Schlüssel!“ sagte die Tänzerin. „Oder wollen Sie schon nach Hause gehen?“
Er blickte wirr um sich. „Nein — aber — lassen Sie mich zufrieden! Ich muß mit dem Kellner sprechen. He! Kellner!“
Das Mädchen verschwand, und der Kellner kam.
„Sie wünschen, Senhor?“
„Wo — wo ist der andere Herr, der hier bei mir saß?“
„Fortgegangen!“ erwiderte der Kellner lakonisch.
„Ganz fort?“
„Ja — ich denke. Er hat die Zeche bezahlt, meinte, Sie wären recht angegriffen. Sie schliefen ja wohl. Ich sollte Sie ruhig hier sitzen lassen.“
„Sie sollten mich ruhig hier sitzen lassen?“
„Jawohl.“
Der Erwachte griff abermals in die Taschen. Die Brieftasche war noch da. Er zog sie heraus und öffnete sie. Auch sein Geld war vorhanden.
Aber die Schlüssel ...
Sein Blick blieb auf dem gegenüberstehenden Sessel haften, wie gebannt. Er deutete auf die Stelle. Er sagte: „Was ist das?“
Der Kellner lächelte. „Ein blauer Falter, Senhor!“
*
Die Turbinen heulten. An einem Schaltbrett leuchteten rote, weiße und gelbe Lämpchen auf.
Der Werkmeister prüfte die Tafeln. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Dampf zischte. Scheiben zitterten.
Ein Arbeiter kam über den eisernen Laufsteg auf den Werkmeister zu. Er hielt eine Ölkanne in der Hand. Seine Hände trieften von Öl. In sein rußgeschwärztes Gesicht hatten sich Schweißbäche eingegraben.
„Nun“, fragte der Werkmeister, „sind die Leute zurück?“
„Jawohl, Meister. Sie sind eben vorgefahren.“
„Dann bleib du mal hier. Mit der Umdrehungszahl bei Turbine drei stimmt etwas nicht. Vielleicht liegt es auch an dem Generator. Ich werde es dem Ingenieur melden.“
Er schritt die aus schmalem Eisenblech bestehenden Stufen hinunter, durchquerte den Maschinenraum und ging auf die Tür zu.
In diesem Augenblick traten die beiden Monteure ein.
„Nun — was war los?“ fragte der Meister.
Der jüngere der beiden, ein frischer, kräftiger Bursche, dem der zu enge blaue Kittel wie eine Zwangsjacke saß, trat erregt auf ihn zu. „Kurzschluß!“ erwiderte er, „absichtlich herbeigeführt. Die beiden Hauptsicherungen waren vollkommen zerschmolzen. Jawohl — und die Polizei —“
Der andere schaltete sich ein: „Die Polizei fand zwei Tote. Die Bank war ausgeraubt.“
„Donnerwetter! Also so hängt das zusammen!“
Der ältere Monteur fuhr fort: „Ja — ich sage Ihnen: eine ganz tolle Sache, Meister!“
Der jüngere faßte den Meister am Arm. „Dreihunderttausend Milreis sollen gestohlen sein!“
Der andere fuhr ihm über den Mund. „Ach nein — was du nicht schon alles weißt!“
„Ich hörte doch“, verteidigte sich der Gerügte, „wie der Kommissar mit dem zweiten Buchhalter sprach — —“
„Wer sind die Toten?“ wollte der Meister wissen. Kriminalfälle interessierten ihn.
„Der Nachtportier und ein Wächter, der das Haus nachts zu kontrollieren hatte. — Denken Sie sich: kein Schloß war erbrochen, auch das am Tresor nicht. Die Schlüssel steckten.“
„Die Schlüssel steckten?“
„Jawohl.“
*
Die letzten Gäste des Doktors Affonso de Mello verabschiedeten sich. Damit fand eine kleine Abendgesellschaft im engeren Freundeskreise, wie sie der Doktor und seine Gattin besonders liebten, ihr Ende.
Nur Onkel Joaquim, der zu Besuch aus Recife gekommen war, blieb im Hause. Mit ihm zusammen setzte man sich noch einen Augenblick in den Salon, um Nachschau zu halten. Onkel Joaquim machte dabei seine Glossen. Er war, wie Cecilia, die Tochter des Hauses, behauptete, ein ulkiges Huhn. Aber mit seinem struppigen Schnauzbart und den aufgeblasenen Backen sah er mehr wie ein Seehund aus.
Sein kahl geschorener Schädel war stets rot angelaufen.
„Die Frau des Kaffeegroßhändlers“, meinte er, „wäre besser Amme geworden. Habt ihr den Busen gesehen? Und dann noch ein Dekolleté! So ist’s richtig! Wenn sie den Kopf vorstreckte, dachte ich immer, sie wollte auf den Balkon treten! — Ihr Mann sieht aus wie ein Hundedresseur.“
„Aber Onkel Joaquim!“ rügte Senhora de Mello, „wie kannst du nur so etwas sagen — in Gegenwart von Cecilia! Außerdem beleidigst du unsere Gäste.“
„Beleidigen? Nein — ich vergleiche nur gern. Außerdem hören sie mich ja jetzt nicht mehr. Oder wollt ihr ihnen das wiedererzählen?“
„Wenn du mit anderen über uns sprichst, wird es wohl ebenso über uns hergehen!“ behauptete der Bankier und streifte die Asche von seiner Zigarre.
Onkel Joaquim winkte lachend ab. „Nein“, rief er, „euch vergleiche ich höchstens mit Engeln. Ihr habt mich doch hier so nett aufgenommen!“
Cecilia bemühte sich, mit ihrem Feuerzeug eine Zigarette anzuzünden. Das Feuerzeug funktionierte nicht. Onkel Joaquim griff in die Tasche und reichte ihr eine Streichholzschachtel. „Siehst du — siehst du!“ sagte er triumphierend, „ich habe doch recht, meine Fabrik zu behalten!“ (Er besaß in Recife eine Streichholzfabrik.)
„Wie ich hörte“, fiel der Bankier rasch ein, „hast du kürzlich noch einen Betrieb aufgemacht?“
Der Onkel spitzte den Mund, als ob er den krächzenden Laut eines Seehundes ausstoßen wollte. „Du hast ganz richtig gehört!“ entgegnete er.
„Na — und was wird da fabriziert?“
„Feuersteine! — Man kann ja nicht wissen — und übrigens sind die Dinger noch steuerfrei. Ich sage immer:
Bei mir macht es die Steuer fein, —
Sie nimmt nichts für den Feuerstein!“
Alle lachten.
„Ja — und — übrigens — vielleicht gliedere ich den beiden Werken später noch eine dritte Fabrik an.“
„Was willst du denn noch herstellen?“ fragte de Mello erstaunt.
„Elektrische Feueranzünder!“ kam prompt die Antwort, „dann kann mir doch nichts mehr passieren, nicht wahr?“
Plötzlich schrillte das Telephon. Es klingelte nicht, es schrillte, es war nicht zu beruhigen, bevor der Bankier den Hörer genommen hatte.
„Hallo! Was ist los?“
Er verfärbte sich. Seine Hände begannen zu zittern.
Die anderen standen um ihn herum. „Ja — ich komme sofort!“ hörten sie ihn in die Muschel schreien.
Vom Apparat zurücktaumelnd, sagte er mit gebrochener Stimme: „Die Bank ist ausgeraubt worden!“
*
Es klopfte. Kommissar Branco warf einen mißmutigen Blick nach der Tür. Am liebsten würde er gar nicht ‚Herein‘ rufen. Er hatte eine fast schlaflose Nacht hinter sich. Die Ermittlungen bei der Mello-Bank hatten ihn bis zum frühen Morgen in Atem gehalten.
Irgendein positives Ergebnis hatten seine Anstrengungen bisher nicht gehabt. Es gab keine Spuren und wenig Anhaltspunkte. Niemand hatte die Leute gesehen. Kein Auto war vorgefahren. Kein Werkzeug war liegengeblieben.
Nur etwas — ja, merkwürdig! — hatte an einem Ledersessel im Vorzimmer zum Tresorraum gesteckt, fein säuberlich aufgespießt: ein blauer Falter! —
„Herein!“
Onkel Joaquim steckte den Kopf durch die Tür. Seine Platte glühte. Rasch schob er den molligen Körper mit seinen kurzen Beinchen nach.
Er hatte während der Nacht seinem Schwager das Geleite gegeben, hatte auch mit dem Kommissar schon gesprochen. Er war unterrichtet.
„Herr Kommissar“, sagte er, näher tretend, „entschuldigen Sie bitte die Störung — aber ich möchte Ihnen so gerne helfen.“
„Helfen? Wieso?“ fragte Branco erstaunt und deutete gleichgültig auf einen Sessel.
Onkel Joaquim machte es sich bequem, schlug die Beinchen übereinander und steckte sich eine Zigarette an, ohne den Kommissar erst um Erlaubnis gefragt zu haben. Er benutzte ein Streichholz dazu.
Branco blickte ihn mißtrauisch an. Dieser Herr hatte ihm schon während der Nacht mit seinen Fragen und wichtigtuerischen Andeutungen viel zu schaffen gemacht.
„Ja, sehen Sie“, legte Onkel Joaquim umständlich los, „ich hätte nämlich eigentlich auch Detektiv werden müssen. Aber meine Eltern wollten es nicht. Sie hielten von meinen Erleuchtungen leider nicht viel —“
„Vielleicht hatten sie recht!“ erwiderte Branco mit einem spöttischen Seitenblick.
„Sagen Sie das bitte nicht!“ wandte Onkel Joaquim ein, „jedenfalls tragen wenige Menschen heute so viel zur Erleuchtung bei wie gerade ich.“
„Sie sprechen für mich in Rätseln, Senhor!“ brummte Branco.
„Ah! Das verstehen Sie nicht! Natürlich, — Sie wissen ja auch noch nicht, wer ich bin. Meine Streichholzfabrik in Recife ist führend, Senhor! Und nun auch noch Feuersteine! Begreifen Sie jetzt?“
„Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen“, erwiderte Branco, „daß ich für Scherze augenblicklich nicht aufgelegt bin.“
Onkel Joaquim strich sich beleidigt über den kahlen Kopf. „Scherze? Scherze? Ich meine es bitter ernst. Wenn auch Sie, wie ich gern anerkenne, die Leuchte sind, die einmal Licht in das furchtbare Dunkel bringen wird, von dem die Tat augenblicklich noch völlig umhüllt wird, — so dürfte es mir doch vielleicht vergönnt sein, dieses Licht zu entzünden! Als kleines Streichholz — als Feuerstein — wie Sie wollen.“
Branco konnte ein Lächeln nicht mehr zurückhalten. „Also Sie meinen —?“
„Ich meine, daß ich Ihnen möglicherweise doch irgendwie behilflich sein kann. Ich bleibe noch einige Tage in Rio. Ich habe nichts weiter vor.“
„Also gut — schaffen Sie mir den Mörder herbei!“
Onkel Joaquim blickte verdutzt auf. „Wie — ich soll —? Aber dazu müssen Sie mir doch Hinweise geben!“
„Hinweise? Ich glaubte Sie so zu verstehen, daß Sie mir diese verschaffen wollten!“
„Aber das geht doch nicht. Ich habe ja keine.“
„Na also — dann können Sie auch nicht helfen. Schade. Ich hätte mich selbstverständlich sehr über Ihre Hilfe gefreut. Und ich danke Ihnen verbindlich für Ihr freundliches Angebot.“
„Keine Ursache, Herr Kommissar. Tscha — na — dann werde ich so mal sehen, was sich machen läßt. Ob ich was finde —“
„Ja — suchen Sie! Suchen Sie! Vielleicht sind Sie das blinde Huhn, das bisweilen auch mal ein Körnchen findet. Es sollte mich lebhaft freuen!“
„Mich auch, Herr Kommissar!“ fiel Onkel Joaquim ihm in die Rede, und ehe sich’s Branco versah, war er verschwunden.
*
Der Wecker rasselte. Er knatterte — tacktacktacktack — wie ein Maschinengewehr.
Zilda rieb sich die Augen und sprang aus dem Bett. Sie war ein sehr schönes, sehr schlankes und sehr verdorbenes Mädchen. Doch ihre Verderbtheit beschränkte sich auf den Hausgebrauch.
Sie streifte ihr Hemd ab, betrachtete sich, als Eva, einen Augenblick lang wohlgefällig im Spiegel und begann sich zu waschen. Dann kleidete sie sich mit großer Behendigkeit an. Ihre Bewegungen, voller Anmut, erinnerten an das Spiel junger Katzen.
Das volle, pechschwarze Haar umrahmte ein liebliches, nicht gerade ebenmäßiges — aber vielleicht gerade darum reizvolles, schmales Gesicht. Ihr linkes Auge war stets etwas eingekniffen, und wenn sie lächelte, erschien auf der rechten Backe ein Grübchen.
In dieses Grübchen waren alle Männer verliebt. Aber Zilda liebte nur zwei Exemplare von dieser Gattung, — ihren Bruder Rodrigues, und einen anderen, der sich Bernardo nannte. Ob er wirklich so hieß — darauf hätte sie keinen Eid ablegen können.
Jetzt riß sie die Tür auf und rief nach draußen: „Das Frühstück, bitte!“
Die alte Mulattin, bei der sie wohnte und deren Mann Lastträger war, gab einen heiseren, bellenden Laut von sich, Das hieß soviel wie: ‚Ich komme gleich!‘
Zilda nutzte die Zeit aus, um sich die Lippen noch einmal rasch nachzuschminken.
Die Alte kam und stellte das wacklige Tablett auf den morschen Tisch. Es war wahrlich kein Fürstenpalais, das die kleine Zilda bewohnte. An allen Stücken, die hier herumstanden, hatte der Zahn der Zeit schon genagt. Auf die Zerbrechlichkeit alles Irdischen wurde sie durch das Geschirr hingewiesen. An der Zuckerdose fehlte der rechte Henkel. Wenn man die Dose herumdrehte, konnte es aber auch der linke sein. Welcher es nun in Wirklichkeit war, — darüber ist sich Zilda bis heute noch nicht einig geworden.
An der Kaffeekanne fehlte die Tülle, und auch der Deckelknauf hatte dem robusten Zugreifen der Mulattin nicht standhalten können. Sprünge an Tellern und Tassen sowie ausgeschlagene Ecken schienen in diesem Haushalt als eine besondere Zierde betrachtet zu werden.
Aber die Füllung der Dinge: die Butter, die Marmelade, der Honig, der Aufschnitt, der Kaffee — das war alles gut. Zilda ließ sich nicht durch äußere Aufmachung den Geschmack, im wahren Sinne des Wortes verstanden, beeinträchtigen.
Doch ging ihr auch der Geschmack im übertragenen Sinne nicht ab. Sie wußte sich, selbst mit einfachen Mitteln, ansprechend zu kleiden, und verstand den billigsten Talmischmuck wie eine Fürstin zu tragen.
Aber nun hatte sie ja seit einiger Zeit auch schon einige richtige teure Abendkleider, in denen sie mit Bernardo bisweilen zu Vergnügungen ging, — zu Vergnügungen in den feinsten Lokalen, wo sie sich durchaus anzupassen und wie eine ganz große Dame zu bewegen wußte. Wer hätte dann wohl geahnt, daß sie nur eine kleine Austrägerin in einem Hutgeschäft war?
Alles das würde jetzt anders werden. ER hatte es ihr ja versprochen — und sie glaubte an ihn, obwohl sie, wie schon bemerkt, der Richtigkeit seines Namens nicht so ganz sicher war.
Als sie gefrühstückt hatte, begab sie sich ins Geschäft. Die Mulattin rief ihr noch einen Gruß nach.
Sicherlich würde die Alte das nicht getan haben, wenn sie gewußt hätte, daß Zilda es war, die vor ein paar Tagen ihren kreischenden und ruhestörenden Papagei meuchlings vergiftet hatte.
Und der Papagei hatte das Rülpsen ihres Mannes immer so herrlich naturgetreu nachgeahmt!
*
„Sie heißen Romano — Aluizio Romano?“
„Jawohl, Herr Kommissar.“
„Und sind erster Prokurist in dem Bankhaus de Mello?“
„Jawohl, Herr Kommissar!“
„Sie haben sich gestern abend auf der schwimmenden Bar befunden?“
„Jawohl, Herr Kommissar!“
„Wollen Sie mir nun mal erzählen —“
„Jawohl, Herr Kommissar!“
„Himmelkreuzdonnerwetter — sagen Sie doch einfach ja oder nein. Verstanden?“
„Jawohl, Herr Kommissar!“
Branco faßte sich verzweifelt an die Stirn und drohte: „Wenn Sie noch einmal ‚jawohl, Herr Kommissar!‘ zu mir sagen, dann werfe ich Sie hinaus!“
„Nein, Herr Kommissar!“
„Also berichten Sie. Wie war das? Sie saßen in dem Lokal —?“
„Ein Herr hatte mich telephonisch dorthin bestellt. Er berief sich auf meinen Bruder, der in Campos in einer Maschinenfabrik tätig ist.“
„Merkwürdig. Na — und dann kam der Herr auch?“
„Ja. Er bestellte mir Grüße. Dem Wesen nach war er sehr nett. Wir unterhielten uns ausgezeichnet.“
„Wußte er über Ihren Bruder genau Bescheid?“
„Ja — recht genau.“
„Wie nannte er sich?“
„Taunay — wenn ich ihn recht verstand.“
„Taunay?“
„Ja.“
„Worüber unterhielten Sie sich?“
„Über alles mögliche. Er schien weit gereist zu sein; denn er konnte sehr anschaulich von allen Teilen der Welt erzählen.“
„Na — und nun weiter. Auf einmal waren Sie eingeschlafen?“
„Jawohl, Herr Kommissar — oh, Verzeihung — ja! Ich weiß verdammt nicht mehr, wie es kam. Das muß ganz plötzlich geschehen sein.“
„Als Sie erwachten, war der Mann fort?“
„Er war fort — und auch meine Schlüssel. Ich weiß nicht mehr, wie ich gleich darauf kam — unwillkürlich tastete ich meine Taschen ab —“
„Und mit diesen Schlüsseln ist der Raub in der Bank ausgeführt worden! — Wann sind Sie denn wieder zu sich gekommen?“
„Das war schon recht spät. Eine Tänzerin hatte mir auf die Schulter geklopft, wohl, um sich mit mir anzubiedern. Aber ich schickte sie fort.“
„Glauben Sie, daß dieses Mädchen mit dem Mann in Verbindung gestanden hat?“
„Keine Ahnung, Herr Kommissar. Aber dann — ja, noch etwas recht Seltsames — an die Lehne des Sessels, der mir gegenüberstand —“
„Was war da?“ fragte Branco gespannt.
„An die Lehne war ein blauer Falter geheftet!“
Der Kommissar zuckte unwillkürlich zusammen. Das war doch ein tolles Stück! Wieder der blaue Falter. War der Kerl verrückt — sich dadurch selbst zu verraten?
*
Onkel Joaquim schnüffelte in der Bank herum. Überall waren Handwerker tätig, — Leute der Telephongesellschaft, von der die Anlage gepachtet war; Leute einer Elektrofirma, von der die Sicherungsanlagen stammten.
An zahlreichen Stellen waren Drähte durchschnitten.
Die Sicherungsanlage hatte ebensowenig wie das Telephon funktionieren können. Dabei war alles so trefflich durchdacht gewesen. Alarmglocken, unsichtbare Strahlen, ein Fernmeldetelephon — alles hatte man angewendet und eingebaut — und alles war, wie Onkel Joaquim sich drastisch ausdrückte — für die Katz gewesen.
Die Alarmglocken hatten geschwiegen, die Strahlen waren erloschen, und das Fernmeldetelephon war zerstört.
Alles ließ darauf schließen, daß die Verbrecher mit den Anlagen genau Bescheid gewußt haben mußten.
Onkel Joaquim war der Meinung, daß man die Täter in der Bank selbst zu suchen habe. Mit Mellos Erlaubnis unterzog er verschiedene Angestellte einem genauen Verhör.
Es kam nichts dabei heraus. Alle verfügten über ein einwandfreies Alibi. (Kommissar Branco hatte dies schon längst festgestellt.)
„Aber es muß doch einer von deinen Leuten irgendwie mit im Spiele gewesen sein!“ hackte der Onkel auf seiner Meinung herum, als er wieder zu seinem Schwager ins Zimmer trat.
Doktor Affonso de Mello zeigte sich ärgerlich und verbissen. „Na dann suche ihn doch heraus!“ sagte er.
Dem Onkel schien ein Einfall zu kommen. „Du“, meinte er, „vielleicht der Portier!“
„Welcher Portier?“
„Der Nachtportier — der erschossen wurde.“
„Dann frage ihn doch!“
Onkel Joaquim warf seinem Schwager einen nicht gerade freundlichen Blick zu. Verschnupft ging er davon.
Der Bankier blieb verbittert am Schreibtisch sitzen. Er hatte andere Sorgen, als auf das Gewäsch seines Schwagers zu hören; wenn er auch zugeben mußte, daß es wirklich recht merkwürdig war, wie genau die Verbrecher in der Bank Bescheid gewußt hatten.
Bisher hatte er gegen seinen ersten Prokuristen Romano nichts sagen können. Der Mann war ordentlich, fleißig und gewissenhaft.
Plötzlich empfand er Wut gegen ihn. Man konnte auch zu gewissenhaft sein. Hatte der Kerl doch die Schlüssel immer mit sich herumgetragen, damit sie niemals in unrechte Hände gelangen konnten — und gerade dadurch war das geschehen.
Die Räuber mußten gewußt haben ...
Immer wieder kam diese Vermutung auf: die Verbrecher mußten gewußt haben ...
Woher aber hatten sie das alles gewußt?
*
Der Direktor der Atlantis-Versicherung tobte. Er riß sich vor Wut fast den Bart aus; er schrie nach dem Rechtsanwalt.
Als der Rechtsanwalt endlich da war, fuhr er ihn an: „Heute noch klagen Sie gegen die Telephongesellschaft — ich meine, gegen die Firma, die bei der Mello-Bank die Sicherungsanlagen eingebaut hatte. Sollen wir etwa für deren Nachlässigkeit aufkommen? Nein, nein, mein Lieber — die Elektrofirma hat den ganzen Schaden zu tragen! Inzwischen habe ich mich unterrichten lassen: die Leitungen waren miserabel verlegt. Überall traten sie offen zutage. Sie hätten unter Verputz liegen müssen. So war es ja eine Kleinigkeit, alles durchzuschneiden.“
Der Anwalt schielte durch seine Brille und hüstelte. „Hm“, erwiderte er, „so einfach wird das nicht sein. Die Elektrofirma kann einwenden —“
„Einwenden! Einwenden! Nichts wird sie einwenden! Dazu sind Sie da, um das zu verhindern. Wozu brauchen wir einen eigenen Rechtsanwalt im Konzern, wenn dann die anderen doch zu ihrem Recht kommen —“
„Verzeihung, Herr Direktor — Sie sagten soeben selber: zu ihrem Recht. Wenn sie sich wirklich im Recht befinden —“
„Das mögen sie tun, wo sie wollen, aber nicht uns gegenüber. Das gibt es nicht. Hier sind wir im Recht, hier müssen wir im Recht bleiben, verstehen Sie? Und wenn wir auch zehnmal im Unrecht sind. Oder glauben Sie, daß ich so mir nichts dir nichts bereit bin, dreihundertachtundsiebenzigtausendvierhundertfünfundsechzig Milreis auszuspucken?“
„Ich wollte ja nur einmal sagen, was die Elektrofirma etwa einwenden könnte. Wahrscheinlich wird sie behaupten, daß auch dann, wenn alles schön unter Verputz gelegen und wenn man die Drähte nicht zerschnitten hätte — daß auch dann die Anlage nicht mehr in Tätigkeit getreten wäre.“
Der Direktor machte ein verblüfftes Gesicht. „Und warum nicht?“
„Weil das ganze Haus bereits ohne Lichtstrom war, von dem auch die Sicherungsanlagen bei Zwischenschaltung eines Transformators gespeist worden waren.“
Der Direktor fuchtelte mit einem großen Bleistift in der Luft herum. „Das ist mir zu hoch!“ rief er, „klagen Sie, gegen wen Sie wollen, — dann also meinetwegen gegen das Elektrizitätswerk.“
Der Anwalt wischte sich mit einem Taschentuch über die Nase. „Aber das geht doch nicht — das wäre ja Unsinn!“
„Was? Unsinn? Sie wagen mir vorzuwerfen, was ich sage, sei Unsinn?“
„Nein, nein, Herr Direktor, was Sie sagen, ist natürlich alles sehr richtig. Aber — man könnte vielleicht doch auch anderer Auffassung sein.“
„Reden Sie!“
„Wenn ich unbedingt klagen soll, dann könnte sich meine Klage nur gegen den Prokuristen Romano richten. Er hat leichtfertig die Schlüssel mit sich herumgetragen, als er in ein Vergnügungslokal ging — ja, das war Leichtsinn im höchsten Grade. Hier sehe ich eine Chance —“
Der Direktor fuhr wild empor. „Was? Hier sehen Sie eine Chance? Diesem Kerl wollen Sie dreihundertachtundsiebenzigtausendvierhundertfünfundsechzig Milreis aus der Tasche ziehen? Nicht einmal tausend wird der Mann zahlen können!“
„Herr Direktor —“
„Herr Direktor hin — Herr Direktor her — lassen Sie mich in Frieden und sehen Sie selbst zu, was zu machen ist. Leben Sie wohl!“
Der Anwalt schlich wie ein geschlagener Hund aus der Tür.
*
Prokurist Romano rief seinen Bruder in Campos an. Der Bruder unterbrach ihn bei den ersten Worten erregt. „Ich habe schon in der Zeitung gelesen: eure Bank ist ausgeraubt worden. Wie war das möglich? Hattet ihr nicht eine ganz moderne elektrische Sicherungsanlage?“
„Hatten wir. Ja. Alles durchschnitten. Alles zerstört. Und mich will man nun verantwortlich machen, weil ich die Schlüssel —“
„Die Schlüssel? Was ist mit den Schlüsseln?“
„Ich hatte sie bei mir. Sie sind mir geraubt worden — von deinem Freund Taunay.“
„Meinem Freund Taunay? Was soll das heißen?“
„Er hatte mir von dir Grüße gebracht.“
„Einen Taunay kenne ich überhaupt nicht.“
„Er wußte genau über deine Familienverhältnisse Bescheid — sogar über die Erkältung deiner Eliza wußte er zu berichten.“
„Das verstehe ich wirklich nicht. Wie sieht denn der Mann aus?“
Romano beschrieb ihn. Sein Bruder bemerkte:
„Wahrhaftig — ich wüßte nicht, wer das sein könnte.“
„Und ich glaubte bestimmt —“
„— daß ich dir einen Räuber und Mörder auf den Hals geschickt hätte? Du scheinst eine schöne Meinung von mir zu haben, Aluizio!“ Der Prokurist hörte den Bruder am anderen Ende der Leitung lachen. Es war ein erzwungenes Lachen.
*
Kommissar Branco erhielt einen Anruf. Eine energische männliche Stimme meldete sich.
„Hier Borboleta! Meinetwegen Borboleta azul!“
Der Kommissar horchte auf. Borboleta heißt im Portugiesischen: Schmetterling. Und azul: blau. Also: der blaue Schmetterling — der blaue Falter!
„Sie wünschen, Senhor?“ fragte Branco, vollkommen seine Ruhe bewahrend.
„Ich wollte mich nur erkundigen, Herr Kommissar, ob Sie mir schon auf der Spur sind? Ich habe es Ihnen doch eigentlich leicht gemacht.“
„Leicht? Wieso? Das kann ich nicht gerade behaupten. Eher das Gegenteil!“
„Aber ich bitte Sie, Branco — ich hinterließ doch überall meine Visitenkarte! In der Bank — im Kasino von Copacabana — in der schwimmenden Bar —“
„Im Kasino von Copacabana? Was war denn da los?“
„Da hatte ich nur ein kleines Experiment gemacht — eine Art Voruntersuchung. Es hat glänzend geklappt.“
„Davon habe ich noch gar nichts gewußt.“
„Oh — es war ja auch nichts Bedeutendes. Rufen Sie, wenn wir fertig sind, gleich im Kasino mal an. — Störe ich Sie übrigens?“
„Nein, durchaus nicht.“
„Dann können wir ja noch ein wenig zusammen plaudern. Ich möchte Ihnen nämlich noch einige Hinweise geben — das heißt, zunächst eine Erklärung. Sie bezieht sich auf die beiden Ermordeten.“
„Bitte, erklären Sie!“
„Sie sind nicht von mir erschossen worden. Ich habe einen Helfer gehabt, der es nicht so genau nimmt wie ich. Leider konnte ich ihn nicht daran hindern. Jedenfalls spreche ich hiermit mein aufrichtiges Bedauern aus. So etwas soll nicht wieder vorkommen.“
„Ich danke Ihnen für diese Versicherung. — Gleichzeitig glaube ich aber aus ihr auch entnehmen zu können, daß Sie noch weitere Einbrüche vorhaben.“
„Einbrüche? Aber Herr Kommissar — wir haben doch gar keinen Einbruch begangen. Ich hatte ja alle Schlüssel in meiner Tasche, die ich mir von dem Prokuristen lieh.“
„Etwas zwangsweise allerdings!“
„Nur mit Hilfe von etwas Brom. Brom ist ein glänzendes Schlafmittel. Falls Sie selbst einmal — hoffentlich nicht um meinetwillen! — unter Schlaflosigkeit leiden sollten, Herr Kommissar —“
„Danke bestens für die Empfehlung. Ich schlafe im allgemeinen recht gut.“
„Sehr erfreulich. Ich dachte nur. Jedenfalls wissen Sie jetzt, was sich in dem Weinrest befand, den der Kellner leider schon abgeräumt hatte. Schreiben Sie das in die Akten, Herr Kommissar. Damit dürfte doch immerhin eine schwebende Frage für Sie schon erledigt sein. Also: Brom. Ein sehr harmloses Mittel, das keinerlei gesundheitliche Störungen herbeiführen kann.“
„Ich habe es mir bereits notiert.“
„Sehr schön. Und nun möchten Sie natürlich noch weitere Hinweise haben. Sie grübeln gewiß darüber nach, wieso wir in allem, besonders bezüglich der Sicherungsanlagen, so gut Bescheid gewußt haben. Das möchte ich Ihnen auch noch verraten. Ich habe die Zeichnungen bei der Elektrofirma selbst eingesehen.“
„Wie — bitte?“
„Fragen Sie dort einmal an. Dann werden Sie sich davon überzeugen. Wenden Sie sich an den Geschäftsführer Lodam. Grüßen Sie ihn bitte von mir, das heißt: von dem Bankdirektor Spinelli.“
„Spinelli?“
„So nannte ich mich bei ihm.“
„Donnerwetter!“
„Was gibt’s da zu wettern? Man muß nur schlau sein. — Und nun noch zu meinen weiteren Plänen, nach denen Sie sich vorhin in so liebenswürdiger Weise erkundigten. Ich habe eigentlich nur noch zwei ganz große Sachen vor, bei denen ich auf einen Gewinn von anderthalb Millionen Milreis zu kommen hoffe — den eben erledigten Fall bereits eingerechnet. Eine Million für mich — eine halbe für meinen Helfer. Dann werde ich mich wieder ins Privatleben zurückziehen.“
„Da haben Sie sich ja ein schönes Ziel gesteckt“, sagte Branco.
„Gewiß. Mit Kleinigkeiten habe ich mich noch nie abgegeben.“
„Darf ich Sie fragen, welcher Art diese Unternehmungen sein werden?“
„Aber Herr Kommissar — diese Frage ist indiskret! Ich kann Ihnen doch nicht meine Geschäftsgeheimnisse verraten.“
„Darf ich wenigstens eins noch wissen — nämlich, was es mit dem blauen Falter auf sich hat?“
„Ja. Diese Frage will ich Ihnen gerne beantworten. Der blaue Schmetterling ist mein Glückstier. Ich bin da ein wenig abergläubisch. Wer ist das nicht? Jedenfalls darf ich nichts unternehmen, ohne ein solches Tier, fein säuberlich auf eine Nadel gespießt, bei mir zu tragen, was natürlich in einer kleinen Schachtel geschieht. Aber jeder Falter bringt mir nur einmal Glück. Deshalb lasse ich ihn auch stets an dem Ort meines letzten Unternehmens zurück. Wenn ich ihn länger behielte, würde er mir sogar Unglück bringen. Das hat mir eine weise Frau mal gesagt. — Aber nun möchte ich Sie nicht mehr länger aufhalten, Kommissar. — Übrigens spreche ich aus dem Palast-Hotel. Damit Sie’s mir glauben, wird man auch hier einen Falter finden. Leben Sie wohl!“
*