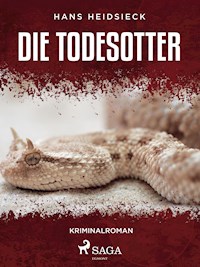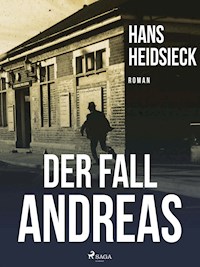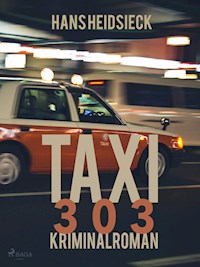Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Helen Reed, Tochter des Millionärs Florian Reed, wird am helllichten Tage von einem Einbrecher heimgesucht, dem mysteriösen Nemo. Er will von ihr ein Lösegeld erpressen, ihren Vater hat er offenbar bereits in seiner Gewalt. Reed befindet sich derweil auf einer Geschäftsreise, dessen Ziel und Zweck niemand kennt und entdeckt auch selbst erst in diesen Minuten, dass er in der Villa, in die man ihn gelockt hat, offenbar unfreiwillig festgehalten wird. Helen beauftragt den Privatdetektiv Wood, sich der Sache anzunehmen. Parallel dazu ermittelt Kommissar Henderson, dem bisher noch kein Verbrecher durch die Lappen gegangen ist. Doch die Beteiligten kommen sich mit ihren Ermittlungsmethoden immer wieder in die Quere, denn auch Helen, ihre Schwester Genia und deren Mann, Staatsanwalt Sellick mischen kräftig und teilweise auf eigene Faust mit. Das größte Rätsel aber scheint keiner von ihnen lüften zu können: Zu welcher geheimnisvollen Reise ist Florian Reed tatsächlich aufgebrochen? Und wer ist der unheimliche Nemo, den Henderson bereits aus der Vergangenheit zu kennen glaubt?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Kommissar - schachmatt?
Roman
Saga
Kommissar - schachmatt?
German
© 1937 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508534
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Personenverzeichnis
Florian Reed, ein amerikanischer Millionär
Helen, seine Töchter
Genia, seine Töchter
Constance Holt, seine Nichte
Staatsanwalt Sellick, Genias Verlobter
Charles Robinor, Flugzeugkonstrukteur
Adrian Bailly, Hausbesitzer in Trenton
Shall, Reeds Privatsekretär
Henderson, Kriminalkommissar
Flint, Kriminalkommissar
Wood, Privatdetektiv
Eric Lane, Farmer
Gerald, sein Bruder
Mistreß Lane, ihre Mutter
William, Reeds Chauffeur
John, Diener
„Hallo! Miß Reed! Hände hoch! — wenn ich bitten darf!“
„Ah! Oh! — Wer sind — —“ Miß Reed blieb das Wort in der Kehle stecken. Vor ihr stand ein maskierter Mann in der Tür, der seinen Revolver drohend erhoben hatte. Das junge Mädchen kam seiner Aufforderung nach.
Sie bemerkte ein Lächeln um seinen Mund. Die Larve hielt nur den oberen Teil des Gesichts bedeckt. Helen Reed mußte mit den erhobenen Händen einen recht kläglichen Eindruck machen. Sie kam sich selber lächerlich vor. Überhaupt — dieser ganze Vorgang, war das nun Scherz, oder was spielte sich plötzlich hier in der Villa ab? Wie war der Mann eingedrungen? Wer war er? Wo kam er her? Wie hatte er trotz des Dieners und des übrigen Personals in das Zimmer kommen können?
Helen fand keine Zeit, sich diese Fragen jetzt zu beantworten. Sie hatte aber auch keine Lust, länger die Arme wie anbetend in die Luft zu strecken, und nahm sie daher einfach wieder herunter.
„Schießen Sie nur auf eine wehrlose Frau“, sagte sie ruhig und blickte unerschrocken den Fremden an, „schießen Sie nur, wenn Sie das fertigbringen. Gewöhnlich führt man sich in etwas liebenswürdigerer Form hier ein.“
Der Maskierte ließ unwillkürlich die Waffe sinken. Das Lächeln um seinen Mund war wie verweht. Er trat näher, verneigte sich, sagte:
„Verzeihen Sie bitte — es war nur eine Vorsichtsmaßnahme von mir. Wir wollen zur Sache kommen. Nehmen Sie Platz!“ Er deutete auf einen Sessel.
Sie schaute ihn ratlos an. „Ich soll — —?“
„Wollen Sie sich nicht setzen? Ich habe etwas mit Ihnen zu besprechen, Miß Reed.“
Wie von einer ihr unverständlichen Macht getrieben, setzte sie sich. Der Mann nahm in einem gewissen Abstand ihr gegenüber Platz. Sie betrachtete ihn aufmerksam. Es war ein stattlicher Mensch, gut gekleidet, nach der neuesten Mode. Helen war überzeugt, daß sich unter der Larve auch ein höchst interessantes Gesicht verbarg. Ein Zug um den Mund kam ihr allerdings übertrieben herbe und streng vor, — man könnte ihn fast als brutal bezeichnen. Seine Stimme klang hart und zwingend wie die eines Menschen, der keinen Widerstand duldete.
„Also was wollen Sie?“ fragte das Mädchen und warf einen Blick zu dem Schreibtisch hinüber, auf dem der Telephonapparat stand, „wer hat Sie hier eingelassen?“
„Ihr Diener natürlich. Ich habe ihn gleich unschädlich gemacht.“
Helen sprang jäh empor, suchte sich dem Schreibtisch zu nähern, obwohl sie selber gleich einsah, daß dies unsinnig war. „Unschädlich?“ stotterte sie, „Sie haben — —?“
„Ich habe ihm eine kleine Gaspatrone unter die Nase geschossen, jawohl, und mit Ihrer Zofe habe ich es genau so gemacht. Sie wollen zum Fernsprecher? Ho — das nützt Ihnen nichts. Die Leitung ist längst durchschnitten. Vorläufig, glaube ich, sind wir ganz ungestört, denn außer dem Diener und der Zofe ist ja niemand im Hause gewesen.“
Helen bot ihre ganze Kraft auf, um sich wieder zusammenzuraffen. Der Ernst dieser Lage kam ihr mit einem Schlag zum Bewußtsein. Und doch schien ihr das alles wie ein Stück aus dem Tollhaus zu sein. Ihr Blick streifte die Standuhr. Zwölf Uhr mittags! Ja — wenn es Mitternacht wäre! Aber so — jetzt — — am hellichten Tage — — — das überstieg ihr Begriffsvermögen.
Der Herr deutete wieder auf ihren Sessel. „Warum erregen Sie sich denn gleich so? Warum wollen Sie wieder stehen?“ Er erhob sich gleichfalls. „Dann muß ich das aus Höflichkeit schließlich auch tun.“
Helen blickte gequält zu Boden. „Wollen Sie mir nun nicht endlich sagen, was Sie zu diesem Einbruch veranlaßt hat?“
„Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten?“ stellte er eine Gegenfrage und hielt ihr sein Etui hin, „ich denke, dabei plaudert sich’s besser. Und übrigens haben wir ja auch Zeit. Ihre Schwester arbeitet noch bis vier Uhr im Atelier, Ihre Base ist nach Newark gefahren, na, und Ihr Herr Vater — — über ihn wollte ich gerade mit Ihnen reden, Miß Reed!“
„Was? Über Papa?“ schrak sie auf.
„Ja. Aber nun nehmen Sie schon eine Zigarette. Sie können ganz unbesorgt sein, vergiftet ist sie bestimmt nicht.“
Sie lächelte, machte gute Miene zum bösen Spiel. „Also gut! Haben Sie Feuer? Danke! — — Was wollen Sie von Papa?“
„Er ist vor drei Tagen abgereist.“
„Ja. Und wir haben merkwürdigerweise noch keinerlei Nachricht von ihm.“
„Sie sagen merkwürdigerweise. Natürlich. Sie wissen noch nicht — — hm — —“ er nahm einen Binder aus seiner Tasche. „Kennen Sie diese Kravatte, Miß Reed?“
Helen riß sie ihm aus der Hand. „Ah! Das ist — — ja, Papas Binder! Aber — was bedeutet das — — — ist ihm etwas passiert?“
„Allerdings ist ihm etwas passiert. Aber Sie brauchen mich nicht gleich so entsetzt anzuschauen. Er ist weder tot, noch verwundet, den Umständen nach geht es ihm augenblicklich wahrscheinlich ganz gut.“
„Und der Binder?“
„Den habe ich als Beweis mitgebracht, daß ich nicht etwa nur so zum Spaß von Ihrem Herrn Vater rede.“
„Aber wo steckt er denn?“
„In meiner Villa.“
„In Ihrer Villa? Wo ist die?“
„Es tut mir außerordentlich leid, Ihnen das nicht verraten zu können. Gerade dieses Geheimnis ist ja der Umstand, aus dem ich mein Kapital schlagen will!“
Das war deutlich gesprochen. Helen wurde nun alles klar. Sie wich entsetzt einen Schritt zurück. „Sie haben meinen Papa überfallen“, schrie sie dem Mann ins Gesicht, „haben ihn dann verschleppt — — und nun wollen Sie — — —“
Der Zug um den Mund des Maskierten wurde jetzt wirklich brutal. Doch seine Stimme heuchelte Freundlichkeit, als er erwiderte: „Ja — und nun will ich mit Ihnen in aller Ruhe über das Lösegeld verhandeln, Miß Reed.“
Helen lief hin und her. Als sie sich dabei dem Fenster zu nähern drohte, trat er ihr in den Weg. Wie vor einem ekelhaften Tier prallte sie vor ihm zurück. Einen Augenblick kämpfte sie mit sich selbst. Dann schien sie einen Entschluß gefaßt zu haben. Ruhig schritt sie zu ihrem Sessel zurück und nahm wieder Platz.
„Also gut — was verlangen Sie?“
„Ihr Papa besitzt, wie man sich hier in New York zu erzählen weiß, sechs Millionen. Sagen wir zehn Prozent, Miß Reed!“
Helen verzog keine Miene. Sie drückte ruhig ihre Zigarette aus. „Hm. Darüber ließe sich reden. — Ist mein Papa unterrichtet?“
„Nein. Er weiß vorläufig nicht, was mit ihm geschieht.“
„Vielleicht sprechen Sie doch einmal selber mit ihm über den Fall. Auch wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir etwas Schriftliches von ihm mitbringen wollten.“
„Ganz wie Sie wünschen, Miß! Offenbar glauben Sie meinen Worten nicht. Allerdings ist von dem Verschwinden Ihres Herrn Vaters öffentlich noch nichts bekannt geworden. Ich bin auch der Meinung, es wäre wohl besser, wenn wir das ganz unter uns abmachten.“
„Ah! Ich werde die Polizei unterrichten.“
„Tun Sie das lieber nicht. Ihr Papa würde ernstlich gefährdet werden.“
„Wie meinen Sie das?“
„Weil das Haus, in dem sich Ihr Vater befindet, sofort in die Luft fliegt, wenn sich die Polizei ihm nur nähern sollte.“
„Mit solchen Schreckmärchen arbeiten Sie? Lächerlich! Selbstverständlich hetze ich Ihnen die Polizei auf den Hals!“
„Sie wollen mich also zwingen, Sie gleichfalls unschädlich zu machen?“
„Wenn Sie das fertig bringen — bitte sehr, tun Sie, was Sie nicht lassen können!“
Der Mann hob seine Waffe. Bevor Helen sich besinnen konnte, drückte er ab. Es war nur ein kratzender, zischender Laut, der aus dem Lauf drang.
Mit einem Aufschrei sank Helen zusammen ...
Mister Wood spitzte den Mund, als ob er einen Pfiff ausstoßen wollte. Vor ihm saß Helen Reed. Sie saß mit übergeschlagenen Beinen da, so daß man die wohlgeformten Waden bewundern konnte. In der New Yorker Gesellschaft wurde sie immer nur die schöne Helen genannt. Niemand konnte ihr abstreiten, daß sie wirklich sehr hübsch war. Auch Mister Wood, der Inhaber eines der bekanntesten Detektiv-Büros, schien von ihren Reizen begeistert zu sein, — bemühte sich aber krampfhaft, sich dies nicht anmerken zu lassen.
„Also, wie sagten Sie“, fragte er, „als die Polizei kam, hatten Sie schon drei Stunden bewußtlos in Ihrem Zimmer gelegen?“
„Ja. Drei Stunden fünfundzwanzig Minuten genau. Mordsübel ist mir gewesen. Ich wußte erst gar nicht, was los war. Dann besann ich mich wieder. Vor mir stand Kommissar Henderson.“
„Ah! Henderson! Na — dann liegt ja die Sache bereits in den besten Händen.“
„Trotzdem wünsche ich Ihre Mitarbeit, Mister Wood. Fordern Sie, was Sie wollen. Setzen Sie alles daran, daß mein Vater gefunden wird.“
„Selbstverständlich. Ich werde mein Möglichstes tun, Miß Reed. Sie müssen mir das aber alles noch einmal zusammenhängend erzählen. Bisher gaben Sie mir nur eine — wie soll ich mich ausdrücken? — Brockensammlung. Vielleicht gestatten Sie mir, einige Fragen zu stellen.“
„Bitte!“
„Sie sagten, der Mann, der Sie überfiel, müsse im Hause Bescheid gewußt haben. Woraus schließen Sie das?“
„Daraus, daß er ganz genau wußte, wo meine Schwester und meine Base sich aufhielten.“
„Hm. Die Kravatte, die er Ihnen gezeigt hat, haben Sie tatsächlich als die Ihres Vaters wiedererkannt?“
„Jawohl.“
„Sie glauben nicht, daß die Sache vielleicht nur ein Bluff war?“
„Erlauben Sie, Mister Wood — — mein Papa hat tatsächlich seit drei Tagen nichts von sich hören lassen, so daß wir alle schon unruhig wurden.“
„Wo wollte er hin?“
„Er hat uns nur etwas von einer Geschäftsreise gesagt; er wollte uns später schreiben.“
„Er reiste mit seinem Auto?“
„Ja. Mit dem großen Packard.“
„Wer war noch mit?“
„Nur der Sekretär von Papa — und der Chauffeur William.“
„Hat einer von diesen beiden Familie?“
„Nur der Sekretär, Mister Shall.“
„Shall?“
„Ja.“ Miß Reed gab die Adresse an, die Wood sich aufschrieb. „Ich werde sofort nachforschen“, sagte er, „ob Mister Shall seiner Familie geschrieben hat. Darauf hätten Sie übrigens auch schon kommen können.“
Es lag ein feiner Tadel in diesen Worten. Helen rümpfte die Nase. „Ich bin kein Detektiv!“ sagte sie.
„Aber Sie lieben doch das Romantische! Sie spielen doch gern die große Abenteuerin!“
„Wer sagt Ihnen das, Mister Wood?“
Wood spitzte wieder pfiffig den Mund zu. „Oh — man erzählt sich sehr viel von Ihnen. Das muß Ihnen selber doch auch schon bekannt sein.“
„Wir kommen vom Thema ab, Mister Wood. Sie wollten mir Fragen stellen.“
Wood strich sich das etwas schüttere Haar zurecht und riß sich merklich zusammen. „Ja gut, — Sie deuteten mir da noch etwas an — — daß Ihr Herr Vater in letzter Zeit geheimnisvolle Korrespondenz gepflegt habe. Wie habe ich das zu verstehen?“
„Er erhielt öfter Einschreibebriefe, die der Bote ihm persönlich aushändigen mußte.“
„Haben Sie einmal solch einen Brief gesehen?“
„Nein. Daher weiß ich auch nicht, wo sie herkamen.“
„Welches Postamt bestellt bei Ihnen?“
„Das sechste.“
Wood machte sich wieder eine Notiz. „Sie haben sich darüber also Gedanken gemacht?“
„Ja. Meine Schwester übrigens auch. Es kam uns beiden so vor, als wäre der Vater, wenn er solch einen Brief erhielt, uns gegenüber stets etwas verlegen geworden.“
Wood kratzte sich an der Stirn. „Vielleicht kamen die Briefe von einer Frau. Trägt er sich etwa mit Heiratsgedanken?“
Helen mußte laut lachen. „Nein — das glaube ich ganz bestimmt nicht. Es muß etwas anderes sein. Möglicherweise hat man ihn schon direkt zu erpressen versucht.“
„Das glaube ich kaum. Woraufhin denn?“
„Dann ist mir das eben ganz unerklärlich.“
„Was?“
„Mit den Briefen.“
„Wissen Sie, ob er die Briefe beantwortet hat?“
„Nein, das kann ich nicht sagen.“
„Was meinte denn Henderson?“
„Henderson hat sich über gar nichts geäußert. Er sagte nur, daß er ganz im Stillen arbeiten wolle.“
„Er glaubt aber, daß Ihr Herr Vater irgendwo gefangengehalten wird?“
„Ja. Selbstredend wird er jetzt nach dem Auto forschen.“
„Sehr schön. Dann brauche ich das nicht mehr zu tun. Was Henderson in der Hand hat, das führt er auch durch.“
„Sie halten viel von dem Mann?“
„Ja. Denn er ist sozusagen der einzige hier bei der Polizei, der nicht mit einem geringschätzigen Achselzucken auf uns Privatdetektive herabschaut. Wir haben sogar schon in mehreren Fällen zusammenarbeiten können. Niemals versuchte er mir ein Verdienst zu schmälern — ebenso wie auch ich ihm niemals irgendwie Abbruch tat.“
„Dann werden Sie vielleicht gut tun, sich auch in meinem Fall mit ihm in Verbindung zu setzen.“
„Sie könnten ihm ja berichten, daß Sie mich gleichfalls beauftragt haben.“
„Das will ich gern tun.“ Helen erhob sich. „Haben Sie noch weitere Fragen, Mister Wood?“
„Nein, danke. Was Sie mir sagten, genügt mir vorerst. In erster Linie dreht es sich also darum, den Aufenthalt Ihres Herrn Vaters herauszubekommen.“ Wood trat ans Fenster. „Ich sehe — Sie werden bereits überwacht.“
„Ich? Überwacht?“ fragte Helen verwundert, „wieso?“
„Nun — weil Ihr ungebetener Gast sich doch wieder an Sie heranmachen könnte. Der Zettelverteiler da unten ist jedenfalls einer von Hendersons Leuten. Ich kenne die Burschen genau.“
Helen stand bereits in der Tür. „Also tun Sie Ihr Möglichstes, Mister Wood!“
Wood verneigte sich tief und warf ihr noch einen bewundernden Blick nach.
„Wünschen die Herren noch etwas zum Nachtisch?“
„Nein. Danke.“
„Hat das Essen geschmeckt?“
„Ausgezeichnet.“
„Große Ehre für mich, große Ehre! Empfehle mich, meine Herrn!“ Der Diener verschwand. Mister Florian Reed wandte sich an Shall, der immer noch kauend am Tisch saß. „Ich verstehe das alles nicht“, sagte Reed, während er sich mit einem Zahnstocher in den Mund fuhr, „man behandelt uns hier wie erlauchte Gäste, während man uns doch gefangenhält. Selbstverständlich ist es mir klar, daß dies auf eine Erpressung hinausläuft. Zum Teufel — — gibt es denn gar keine Möglichkeit — —?“
Shall erhob sich, zuckte die Achseln. „Wir sind eben regelrecht in die Falle gegangen“, erwiderte er, „aber wissen Sie, Mister Reed, mit William, da stimmt etwas nicht. Ich fürchte, der lebt nicht mehr.“
Reed fuhr herum. „Was — — Sie glauben, daß man ihn einfach erschossen hat?“
„Ja — weil er sich nämlich zur Wehr setzen wollte. Sie haben es doch selber gesehen.“
„Ich dachte, er sei nur verwundet worden.“
„Das glaube ich nicht.“
„Aber das wäre ja furchtbar, Shall!“
Der kleine vertrocknete Sekretär grinste. „Oh — diese Menschen schrecken vor nichts zurück. — Warum haben Sie heute eine andere Kravatte an, Mister Reed?“
Reed fuhr sich unwillkürlich mit der Hand an den Kragen. „Kravatte? Ja so — — die andere war verschwunden. Konnte sie jedenfalls nicht mehr finden. — Hören Sie, Shall — — wollen wir nicht noch mal in den Park gehen? Die Sonne scheint gerade so schön — — —“
„Bitte, Mister Reed“, verneigte sich Shall unterwürfig, „wenn nur der schwarze Halunke nicht wäre — —“
„Ach — der Aufsichtsrat?“ lachte Reed, „aber der gute Kerl tut ja schließlich nur seine Pflicht!“
Sie nannten den Schwarzen den „Aufsichtsrat“, weil er ihnen, wenn sie sich in den Park begaben, nicht von der Seite wich.
Langsam schritten sie die große Freitreppe hinunter. Reed steckte sich eine Pfeife an. Shall zog eine Zigarre vor. Sie machten beide den Eindruck, als befänden sie sich hier wirklich nur zu Gast.
„Was meinen Sie?“ fragte Reed plötzlich, „wenn wir hier draußen einmal ganz laut um Hilfe riefen?“
Shall schüttelte bedenklich den Kopf. Er meinte, daß dies doch zwecklos sei. Der kleine Park, behauptete er, werde von einem viel größeren noch umschlossen. Da sei alles Rufen umsonst. Man könne sich dadurch höchstens die Freiheit verscherzen, die man ihnen noch eingeräumt hatte.
Reed stieß eine dichte Rauchwolke aus. „Was sollen wir aber tun? Irgend etwas muß doch geschehen. Könnte man denn bei Nacht nicht über die Mauer klettern?“
Shall verzog sein Gesicht zu einer Grimasse. Es sollte wieder ein Grinsen sein. „Aber erlauben Sie“, gab er zu bedenken, „die Hunde! Und außerdem ist die ganze Mauer oben mit Scherben gespickt!“
„Das wäre allerdings weniger angenehm. Aber ich würde schon damit fertig werden. Man wirft bloß eine Decke hinüber — — und die Hunde müßten wir erst mal an uns gewöhnen. Dann bellen sie auch nicht mehr, wenn wir nachts Abschied nehmen.“
„Mister Reed — — Sie denken im Ernst daran? Sie würden sich unglücklich machen! Und wenn schon — — dann würde ich lieber versuchen, das Personal zu bestechen!“
„Personal? Wen bekommen wir schon zu sehen außer dem Diener, der uns das Essen bringt — — und außer dem Schwarzen da, der noch kein einziges Wort mit uns gesprochen hat und uns nur immer grienend die Zähne zeigt! — Wenn der Herr des Hauses sich nur endlich wieder blicken ließe!“
„Der scheint nicht hier zu sein.“
„Wissen Sie, Shall — ich glaube, daß man von unserem Verschwinden offiziell noch nichts bemerkt hat. Sonst wäre schon durch Radio etwas angesagt worden. Und wir hören doch alles mit.“
„Aber die Fräulein werden sich wohl Gedanken machen, wenn keine Nachricht kommt.“
„Mir ist die Sache auch noch in anderer Weise höchst unangenehm, Shall! Wenn man nun schließlich dahinterkommt, wohin wir eigentlich fahren wollten?“
„Das wäre allerdings äußerst peinlich, Mister Reed!“
„Nicht wahr! Man erwartet uns. Eric wird nicht still dazu sein —“
„Mister Reed — — wo haben Sie denn die Briefe verwahrt?“
„In meinem Geheimtresor — hinter dem Bild im Schlafzimmer. Den Schlüssel habe ich bei mir.“
„Aber dann wäre ja alles gut aufgehoben.“
„Einigermaßen — ja. Trotzdem fürchte ich, daß durch diese fatale Geschichte alles herauskommen wird.“
„Glauben Sie, Eric wird — —?“
„Eric wird nach mir forschen, wenn ich nicht eintreffe, selbstverständlich. Er wird erneut an mich schreiben — — na und — —?“
„Die Post wird eben zurückgehen, Mister Reed!“
„Vielleicht sieht man ihr auch auf die Finger!“
„Glauben Sie wirklich?“
„Fragen Sie nicht so dumm, Shall. Wenn nach einem Menschen geforscht wird, zieht man auch jede Möglichkeit in Betracht, die auf seine Spur führen könnte.“
„Hm hm“, machte Shall und strich sich über die schlaffe Wange, „dann wäre es doch wohl am besten, wenn Sie sich möglichst rasch loskaufen würden!“
Sie hatten die Grenze des Parks erreicht. Reed kehrte als erster um. „Das habe ich auch schon gedacht“, erwiderte er, „falls die Flucht doch zu schwierig wird —“
„Den Gedanken an eine Flucht würde ich fallen lassen“, wandte Shall ein, „wir laufen zu große Gefahr dabei. Fragen wir lieber den Diener mal, wann Mister Nemo zurückkommt.“
„Mister Nemo?“ horchte Reed auf, „wo haben Sie diesen Namen denn her?“
„Aber so hatte er sich doch selbst genannt!“
„So? Mister Niemand? — Das habe ich ganz überhört.“
Sie schritten wiederum auf das Haus zu, das nach der Art alter Schlösser gebaut war, aber in einem leichteren, gefälligerem Stil. Nord- und Südseite waren von je einem Turm flankiert. An diesen Türmen rankten sich fast bis zum obersten Absatz Efeu und wilder Wein empor. Die Fenster unter dem spitzen Dach sahen wie Schießscharten aus. Shall behauptete auch dahinter schon öfter ein Paar Späheraugen erblickt zu haben.
Als die beiden Herrn zur Terrasse zurückkehrten, hatte der Diener dort Tee serviert. Auch Gebäck und Sandwiches standen schon auf dem Tisch. Zwei bequeme Korbsessel waren zurechtgerückt.
Reed hielt nach dem Diener Ausschau. Als dieser nicht zu erblicken war, klingelte er. Gleich darauf kam der Mann und verneigte sich mit betonter Feierlichkeit. „Und die Herren wünschen?“
„Wir wünschen mit Ihrem Chef, Mister Nemo, zu sprechen.“
Die Miene des Dieners blieb kalt wie Stein. „Bedaure lebhaft, der Herr ist noch abwesend!“ erwiderte er.
„Wann wird er zurückkommen?“
„Morgen vielleicht. Nein — bestimmt sogar. Wir geben nämlich morgen eine Gesellschaft.“
„Was — — eine Gesellschaft?“
„Ja.“
„An der wir auch teilnehmen werden?“
Jetzt verrzog sich die Miene des Dieners zu einem überlegenen Lächeln. „Nein — wahrscheinlich wird man Sie nicht um Ihre Teilnahme bitten.“
„Schon gut. Ich danke Ihnen!“
Der Diener ging. Reed und sein Sekretär blickten einander an. Reed meinte: „Das wäre doch eine Möglichkeit, uns bemerkbar zu machen. Übrigens — eine Gesellschaft — — hier? Wahrscheinlich wird es eine Verbrechergesellschaft sein. Na — — und dann nützt uns auch alles nichts.“
Shall hob die Schultern hoch. „Ich glaube kaum, daß es eine Verbrechergesellschaft ist“, erwiderte er.
„Ah! Warum nicht?“ fragte Reed erstaunt.
„Weil ich nicht glaube, daß Mister Nemo viele Leute in seine Pläne einweihen wird. Es wird eine ganz gewöhnliche Gesellschaft sein.“
„Also — — Ahnungslose?“
„Natürlich.“ Shall schnupperte in der Luft herum. „Ich glaube bestimmt, daß wir hier in der Nähe von einem See sind.“
„Riechen Sie das?“
„Ja. Die Luft kommt mir feucht vor. Ich habe dafür eine Witterung.“
„Shall — auf die Gesellschaft bin ich gespannt!“
„Ich auch, Mister Reed!“
Genia Reed warf der Zofe den Mantel zu und begab sich ins Speisezimmer. „Ist meine Schwester nicht da?“ fragte sie noch zurück. Nein. Helen war ausgegangen.
„Und Constance?“ wollte Genia wissen.
Die Zofe trat jetzt doch noch herein. „Miß Constance“, erwiderte sie, „ist schon seit zwei Stunden zum Einholen fort.“
„Seit wann holt sie selber ein?“
„Ich weiß es nicht, Miß Genia.“
„Gibt es etwas Neues? War Kommissar Henderson hier?“
„Nein.“
„Hat jemand angerufen?“
„Ja. Ein Herr. Sie sollten sich keine Mühe geben.“
„Was heißt das?“
„So hat er gesagt.“
„Wie nannte er sich?“
„Nemo.“
„Nemo — Nemo — —? Das heißt doch: Niemand! Ob es etwa der Kerl war, der — —? Das wäre doch eine Unverschämtheit. Es ist ihm schon zuzutrauen. — Bringen Sie mir das Essen. Wenn Constance kommt, schicken Sie sie bitte sofort zu mir herauf.“
„Sehr wohl, Miß!“ Das Mädchen verschwand.
Genia blieb allein. Sie machte sich an den Palmen, die vor dem Fenster standen, zu schaffen, lief unruhig hin und her, pfiff leise zwischen den Zähnen. Ihre flache, etwas gedrungene Stirn war in Falten gezogen. Vor der Anrichte blieb sie stehen, stellte die Schale mit Früchten auf einen anderen Platz. Schüttelte den Kopf, — stellte die Schale wieder weg.
Zwischen ihrem Verlobten, dem Staatsanwalt Sellick, und Henderson hatte es Krach gegeben. Sellick wünschte des Verschwinden Reeds sofort an die große Glocke zu hängen, während Henderson davon abriet und alles im Stillen abmachen wollte. Hendersons Meinung blieb ausschlaggebend, da Sellick von seinem Bezirk aus in diese Sache nicht eingreifen durfte.
Genia hatte natürlich zu ihrem Verlobten gehalten und war nun auf den Kommissar nicht gut zu sprechen. Helen dagegen hielt wieder zu Henderson, und außerdem hatte sie sich auch noch mit Wood in Verbindung gesetzt. In aller Stille wurde ein riesiger Apparat aufgezogen, während Mister Nemo sich noch immer im Verborgenen hielt.
Aber — so überlegte Genia — er mußte doch schließlich wieder einmal zum Vorschein kommen, um seine Absichten durchzuführen. Bei dieser Gelegenheit würde er selbstverständlich verhaftet werden. Niemand, der hier im Hause wohnte, konnte jetzt auch nur einen einzigen Schritt unbeobachtet tun. Das war recht unangenehm — aber nicht zu ändern.
Die Tür öffnete sich, und Constance trat ein. Hinter ihr kam das Mädchen und trug das Essen auf, für Constance gleich mit.
Der Diener John erschien ebenfalls in einer reichlich phantastischen Livree, um den Wein einzugießen. Genia blickte die Dienerschaft mürrisch an. Sie wollte mit ihrer Base allein sein.
Endlich war es so weit. „Du forschst wohl auch schon auf eigene Faust nach Papa?“ fragte Genia mißgelaunt, „seit er fort ist, hältst du dich auch mehr draußen als im Hause auf.“
Constance fuhr bei diesem Tadel zusammen. Er traf sie — und traf sie auch wieder nicht. Ihr Fernsein hatte andere Gründe. Wozu sollte sie das aber gerade Genia gestehen? Nur darum, weil die sich anmaßte, hier im Hause das Regiment zu führen — — während sie doch eigentlich dazu bestellt war? Genia spielte sich überhaupt immer etwas zu sehr auf. Sie glaubte, wie sie sich einmal in lächerlicher Weise auszudrücken beliebte, in der „exzentrisch“ veranlagten Familie das ruhige, solide Bürgertum verkörpern zu müssen. Ihr träges Blut hatte sie wohl von der Mutter her. Da war Helen doch ein ganz anderer Kerl. Deren Temperament hatte bisher noch keiner bändigen können. Selbst der sonst gestrenge Papa wußte sie nur mit Not zu zähmen. Sie tat stets das, was ihr gerade in den Sinn kam.
Jetzt hatte sie es sich in den Kopf gesetzt, selber einmal die Detektivin mitspielen zu wollen. Dies entsprach ganz und gar ihrem stets auf das Romantische gerichteten Sinn.
Constance erwiderte auf die Bemerkung ihrer Kusine, sie habe nur einige dringende Besorgungen gemacht. Auf eine weitere Unterhaltung ließ sie sich nicht ein.
Genia suchte wütend ihr Zimmer auf. Einige Minuten später rief Helen an. „Constance — ist Genia schon zu Hause?“
„Ja.“
„Gut. Wo steckt sie?“
„Auf ihrem Zimmer.“
„Ich wollte dich bitten, noch ein wenig in den Palmengarten zu kommen. Ich esse gleich hier, verstehst du? Du kommst, nicht wahr?“
Constance sagte mit Freuden zu. Sofort kleidete sie sich entsprechend an und verließ das Haus.
Im Palmengarten wurde getanzt. Eine bunte Gesellschaft saß hier um kleine Tische gruppiert. Helen winkte der Base aus einer Nische zu. Sie saß allein am Tisch. Vor ihr stand eine Flasche Wein.
„Komm her, Constance, wir wollen etwas zusammen besprechen. — Tanzen möchte ich nicht, mir steht nicht der Sinn danach. Du wirst mich verstehen. Ich habe schon eine Menge Körbe verteilt.“
„Warum gehst du denn aber hierher?“
„Weil mir Wood und Henderson beide geraten haben, mich viel in der Öffentlichkeit sehen zu lassen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens soll niemand wissen, was überhaupt geschehen ist — und zweitens hofft man doch, daß Mister Nemo sich wieder an mich heranmachen wird.“
„Darauf wartest du wohl sozusagen?“
„Ja.“
„Hm — so unvorsichtig wird er nicht sein. Er kann sich wohl denken, daß du jetzt überwacht wirst.“
„Trotzdem wird er noch Mittel und Wege finden, um ungestört mit mir sprechen zu können.“
Constance blickte verblüfft. „Glaubst du das wirklich? Wie sollte er das aber tun?“
„Na — zum Beispiel erst den, der mich überwacht, aus dem Wege räumen, dann hätte er schon freie Bahn.“
„Du hast wirklich Ideen, Helen — —“
„Komm, laß uns von etwas anderem reden. Hast du ihn wiedergesehen?“
„Wen?“
„Nun — deinen neuen Verehrer natürlich. Du wolltest mir noch erzählen.“
Constance errötete. Sie rückte ihr Glas zurecht. Dann tat sie nachdenklich einen tiefen Zug.
Helen legte ihr eine Hand auf den Arm. „Rede nur, Kind!“ sagte sie, „du weißt ja, daß ich für alles Verständnis besitze, und daß du mir restlos vertrauen kannst.“
Kommissar Henderson streifte ein Stück Papier glatt, das zwischen den Akten lag. Es klopfte. „Herein!“
Staatsanwalt Sellick steckte den Kopf durch die Tür. „Störe ich, Henderson?“
Der Kommissar blickte verwundert auf und erhob sich. „Herr Staatsanwalt?“ Es lag wie ein kalter Hauch zwischen beiden.
Sellick trat langsam näher.
„Bitte nehmen Sie Platz!“ sagte der Kommissar.
Ein verlegenes Grinsen glitt über Sellicks spitzes Vogelgesicht. Er rückte an seinem goldenen Kneifer, hüstelte. „Tschäh — lieber Henderson — was ich sagen wollte — — — ich komme wegen des Falles Reed. Eigentlich geht mich die Sache nichts an, jedenfalls nicht beruflich, da ich hier in Ihrem Bezirk nicht zuständig bin, tschäh — aber privat — ja — — gewissermaßen, als offizieller Verlobter von Miß Genia Reed, als zukünftiger Schwiegersohn meines zukünftigen Schwiegervaters habe ich doch ein gewisses Interesse daran, daß dieser Fall möglichst rasch und in der richtigen Weise aufgeklärt wird.“
Über Hendersons linkem Auge zeigte sich eine steile Falte. Sein schmaler Mund blieb noch einen Augenblick fest geschlossen. Warum suchte sich Sellick schon wieder in diese Sache hineinzumischen? Als künftiger Schwiegersohn seines künftigen Schwiegervaters! Lächerlich! Ihm hatte der Staatsanwalt jedenfalls nichts zu sagen.
Sellick hatte sich hingesetzt. Henderson tat nun desgleichen. „Bisher“, sagte er spitz, „ist man mit meiner Arbeit noch immer zufrieden gewesen. Im übrigen bin ich Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Herr Staatsanwalt. Offiziell ist der Fall bisher überhaupt nur der Polizeibehörde bekannt.“
Sellick machte eine abwehrende Handbewegung. „Weiß ich ja, weiß ich ja, lieber Henderson — — war von mir auch ganz anders gemeint. Tschäh — — Ihre Absicht, zunächst ganz im Stillen zu arbeiten, mag wohl doch richtig sein — —“
„Ah! Sie haben sich also anders besonnen?“
„Ich habe mir das noch einmal überlegt, Henderson. Sie äußerten gestern die Meinung, der Täter stamme wahrscheinlich aus guten Kreisen und strecke überall in der Gesellschaft die Fühler aus.“
„Ja, das glaube ich, und ich möchte ihn gern noch etwas in Sicherheit wiegen, wenigstens im Ungewissen herumtappen lassen. Wie ich schon immer betonte, Herr Staatsanwalt: wenn wir die Sache im Großen aufziehen, kann der Gegner unsere Schachzüge immer genau verfolgen. Wenn wir aber im Stillen handeln, ist er dazu nicht imstande.“
Sellick setzte wieder seinen Kneifer zurecht. „Sie wissen doch schon, wer der Täter ist?“ fragte er.
„Nein — wieso?“ sagte Henderson verblüfft.
„Nemo!“
Der Kommissar fuhr zusammen. „Was? Nemo? Derselbe, der in Chikago damals die Riesenerpressung verübt hat — — und den man bis heute noch nicht erwischen konnte?“
„Es wird wohl derselbe sein. Ich weiß es natürlich nicht. Jedenfalls rief er als Nemo an.“
„Wen? Wo?“