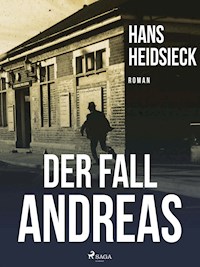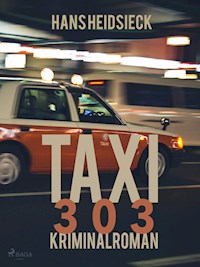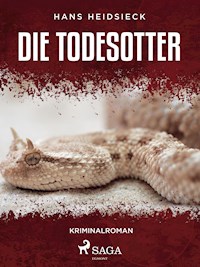
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine giftige Schlange, die plötzlich aus dem Arbeitszimmer von Doktor Ricardi versschwindet, versetzt das Institut in Angst und Schrecken. Der Hausmeister kann sie schließlich zur Strecke bringen – doch bei genauerer Untersuchung stellt sich heraus, dass es sich gar nicht um die Todesotter handelt! Doktor Ricardi, dem die schöne Viola gerade einen Korb erteilt hat, um sich mit Doktor Colonna zu verloben, schwört Stein und Bein, dass er mit dem Verschwinden der Schlange nichts zu tun hat. Doch in den letzten Wochen hat er mit dem Gift des Tieres experimentiert. Und dann findet man Viola – tot – Herzversagen! Was hat Ricardi mit dem tragischen Vorfall zu tun? Wird sein Chef, Professor da Costa, ihm auf die Schliche kommen? Oder kann Kommissar Nitti mithilfe von Violas Freundin Leona Licht ins Dunkel bringen?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Die Todesotter
Kriminalroman
Saga
Die Todesotter
German
© 1948 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508558
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Professor da Costa blickte betreten von der Lektüre eines Geschäftsbriefes auf, als sein Prokurist ohne Anmeldung und im Zustande höchster Erregung zu ihm hereingestürzt kam.
„Herr Professor!!!”
„Was gibt es, Giuliano?” fragte da Costa ruhig, der nicht leicht aus der Fassung zu bringen war.
Giuliano Conti blieb mit lebhaften Gesten dicht vor dem Schreibtisch stehen. „Die Todesotter ist ausgebrochen”, stammelte er, „Sie wissen doch, Herr Professor — die kleine Schlange, die Doktor Ricardi in einem Sonderbehälter verwahrt hielt. Der Behälter ist leer.”
Ein Zucken um die Mundwinkel des Professors verriet, daß auch er jetzt von der Erregung seines Prokuristen angesteckt wurde. Hastig erhob er sich. „So! Und was sagt der Doktor dazu?”
Conti wurde verlegen. „Er ist noch nicht hier”, erwiderte er mit schwankender Stimme, „ich habe ihn auch telefonisch noch nicht erreichen können. Sonst pflegt er um diese Zeit immer schon da zu sein.”
Da Costa warf einen Blick auf die Uhr. Es war genau dreizehn Minuten nach neun. „Haben Sie bereits alles abgesucht?” fragte er.
Conti wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Ja gewiß, selbstverständlich. Ich suchte das Zimmer des Assistenten ab und das Laboratorium. Die Schlange ist nirgends zu finden. Seltsamerweise hat die Tür zum Laboratorium offen gestanden; das Tier kann also auch weiter entwichen sein.”
„Weiß außer Ihnen jemand davon?”
„Ja. Der zweite Buchhalter, der den Doktor aufsucben wollte, um ihn etwas zu fragen. Er war es auch, der die Sache entdeckt hat.”
Der Professor schlug unwillig mit der Faust auf den Tisch. „Donnerwetter — das ist fatal. Es braucht nicht gleich im Hause herumzukommen, daß eine unserer gefährlichsten Giftschlangen unterwegs ist. Haben Sie dem Mann nicht gesagt, daß er den Mund halten soll?”
Conti starrte verwirrt vor sich nieder. „Herr Professor, ich war so erregt — — —”
Da Costa faßte ihn an der Schulter. „Kommen Sie! Kommen Sie! Da muß gleich was geschehen!”
Mit diesen Worten zog er den Prokuristen zur Tür hinaus.
Die beiden Herren rannten zum Hauptbüro der zoologischen Großhandlung, die hier von Genua aus den gesamten europäischen Kontinent mit Tieren jeglicher Gattung versorgte. Der zweite Buchhalter, ein scheuer und ängstlicher Mensch, hatte das böse Ereignis schon ausposaunt. Hierdurch war sofort eine panikartige Stimmung entstanden. Besonders die weiblichen Angestellten gebärdeten sich wie toll. Ein hysterisches Mädchen brach in Weinkrämpfe aus. Nur wenige Herren suchten mit ruhigen und vernünftigen Worten wieder Ordnung in dieses Chaos zu bringen.
Da Costa fuhr mit einem Donnerwetter dazwischen. „Seid ihr verrückt geworden? Das ist doch nur halb so schlimm! Außerdem wissen wir ja noch gar nicht, ob nicht Herr Doktor Ricardi das Tier zu Versuchszwecken mit sich hach Hause nahm. Im übrigen greift eine Schlange so leicht keinen Menschen an, wenn sie nicht gerade gereizt wird. Ich bitte Sie, ruhig wieder an Ihre Arbeit zu gehen. Inzwischen wird alles getan werden, um den Fall aufzuklären.”
Eine Stenotypistin, tiefrot im Gesicht, trat auf den Chef zu. „Die Polizei muß benachrichtigt werden!” rief sie mit fast überschnappender Fistelstimme. Dabei hielt sie scheu nach allen Richtungen Ausschau, ob die Schlange nicht bereits auf sie zukam.
„Die Polizei hat mit dieser Angelegenheit gar nichts zu tun”, erwiderte da Costa bestimmt und warf dem Mädchen einen verächtlichen Blick zu. „Was hier zu tun und zu lassen ist, das bestimme ich. Es ist unbedingt zu vermeiden, daß unser Institut durch eine solche Lächerlichkeit ins Gerede kommt. Wer es sich etwa einfallen läßt, meinen Anordnungen entgegenzuarbeiten, kann sich von Stund an als entlassen betrachten. Ich glaube hiermit deutlich genug gesprochen zu haben. Wenn Sie ein Hasenfuß sind, Signorina, gehen Sie ruhig nach Hause, bis die Angelegenheit aufgeklärt ist. Später sehe ich dann Ihrer mutigen Rückkehr entgegen.”
Das wirkte. Feigheit wollte sich niemand vorwerfen lassen. Die Leute begannen sich langsam auf ihre Plätze zurückzuziehen. Die Worte des Chefs, der bei alten hohe Achtung genoß, hatten ihre Wirkung getan. Die überlegene Ruhe, die ihn selbst stets beherrschte, übertrug sich auf seine Umgebung. Man sah ein, daß die Angelegenheit wirklich gar nicht so schlimm war, wie sie anfangs dargestellt wurde.
Im stillen machte sich allerdings mancher noch weiter seine Gedanken darüber. Eine gewisse Unruhe blieb bestehen. Aber äußerlich ließ man sich nichts mehr anmerken, — ja, man begann sogar Scherze zu machen und sich gegenseitig zu necken.
Da Costa zog sich mit Conti in sein Büro zurück. „Ich verstehe nicht”, sagte er, „daß der Doktor nicht kommt. Er könnte uns wahrscheinlich gleich eine Aufklärung geben. Ich verstehe das wirklich nicht.”
Während der Professor den Telefonhörer zur Hand nahm, fragte der Prokurist: „Und was soll nun veranlaßt werden?”
Da Costa sah ihn verwundert an. „Wie? Veranlaßt? Was zu veranlassen war, ist getan. Jeder weiß, was geschehen ist, und ich glaube kaum, daß ein einziger da ist, der nicht mit Luchsaugen Umschau hält. Wichtig erscheint mir nur, daß ich den Doktor erreiche.”
Der Professor hatte die Nummer der Leute gewählt, bei denen Doktor Ricardi zwei elegante Zimmer gemietet hatte. Eine Dame meldete sich.
„Verzeihen Sie bitte, Signora, — ich möchte Doktor Ricardi sprechen.”
„Doktor Ricardi? — Wer ist denn dort?”
„Hier spricht Professor da Costa.”
„Ach — Herr Professor — — — ich bin selbst ganz durcheinander. Der Doktor ist heute nacht nicht nach Hause gekommen. Eben bin ich in seinem Zimmer gewesen. Das Bett ist noch unberührt.”
Der Professor zuckte zusammen. „Hat er nichts hinterlassen?”
„Nein. Er ist immer so solide gewesen — — — bei Ihnen befindet er sich also auch nicht?”
„Dann hätte ich jetzt nicht bei Ihnen angerufen, Signora. Bitte benachrichtigen Sie mich sofort, wenn er kommt.”
„Selbstverständlich. Ob man nicht der Polizei davon Mitteilung machen soll?”
„Vorläufig nicht. Schließlich kann er ja mal woanders genächtigt haben. Ich habe das in früheren Zeiten sogar ziemlich oft getan. Wenn er freilich bis zur Mittagszeit nicht zurück ist — — na, darüber werden wir dann noch sprechen .....”
Da Costa legte den Hörer hin und starrte den Prokuristen an. „Er ist nicht zu Hause. Können Sie sich das erklären, Conti?”
„Nein, Herr Professor.”
„Ich auch nicht.”
„Vielleicht —” Conti kam nur zögernd damit heraus, — „vielleicht hängt es mit der Schlange zusammen.”
Da Costa horchte auf. „Meinen Sie? — Hm. Das wäre allerdings nicht beruhigend.”
Es war ein strahlender Tag, der über der Mittelmeerküste emporstieg. Die Sonne tauchte den Hafen von Genua, die Stadt und die Vororte in ein gleißendes Licht.
Ein wahrhafter Frühlingstag. Überall blühte es in den Gärten, hoben sich taubenetzte, buntfarbige Kelche dem Licht entgegen, — in einer prachtvollen Üppigkeit, wie man sie nur in diesen südlichen Ländern kennt.
Froh ihres Daseins, unbekümmert und unbeschwert jubilierte die tausendstimmige Vogelwelt in den lachenden Morgen hinein. Das silbern schimmernde Meer lag fast spiegelglatt. Schwer beladene Fischerboote kehrten von einer nächtlichen Fahrt zurück. Aus der Ferne vernahm man das gleichmäßige Knattern ihrer Motore.
Bunte Segel spiegelten sich auf der leuchtenden Flut.
Wer diesen Morgen erlebte, hatte es leicht, sich in einer gehobenen Stimmung zu fühlen und die Welt als ein Paradies anzusehen. Er konnte schwerlich auf den Gedanken kommen, daß auch an solchen Tagen das Schicksal seinen Weg ehern weitergeht und, ohne Rücksicht auf das Wohlbefinden des Einzelnen, seine dem Menschen ewig unerforschlichen Aufgaben erfüllt.
Der kleinen, hübschen, schwarzlockigen Leona Bastinelli lagen solche Betrachtungen jedenfalls fern, als sie in ihrer anmutig wiegenden Gangart die Promenade in Pegli entlangschritt, um ihre Freundin Viola zu besuchen, die gerade jetzt einige Tage Ferien hatte.
Leonas Gedanken kreisten um die letzten Ereignisse, die, wie sie meinte, geeignet waren, in ihr bisher wenig erfreuliches Schicksal eine entscheidende Wendung zu bringen.
Es handelte sich um die Verlobung Violas, die vor zwei Tagen dem jungen Colonna ihr Jawort gegeben hatte.
Eine gewisse Schadenfreude stieg in dem Mädchen auf. Doktor Ricardis Hoffnungen, die er sich bis zum letzten Tage gemacht hatte, sind nun durch Violas raschen Entschluß endgültig zerschlagen worden. Wie konnte man überhaupt so verbohrt sein und glauben, die Neigung eines Menschen gewinnen zu können, der deutlich zeigte, daß seine Wahl schon getroffen war?!
In seiner blinden Verliebtheit hatte er gar nicht bemerkt, wie ihm, während ihm Viola mehr und mehr entglitt, auf der anderen Seite die hübsche Freundin der Angebeteten eine immer stärker werdende Neigung entgegenbrachte. — —
Leona erschrak vor sich selbst. Hatte sie eben nicht einen Seufzer ausgestoßen — so laut, daß es deutlich zu hören war?
Sie streifte die unangenehmen Gedanken ab und gab sich der Hoffnung hin, daß nun alles bald anders werde. Vielleicht würde auch sie in Kürze, wie Viola, heiraten und glücklich sein.
In diesem Gedanken stieß sie einen Jubelruf aus. So langte sie in der besten Stimmung vor einem Häuschen an, das wie ein Schmuckkästchen in ein Meer duftender Rosen gebettet war. Es war das zu einer großen Villa gehörige Gartenhaus, dessen südliche Fenster einen prachtvollen Blick auf die See hinaus boten. Drei Räume besaß es. Für Viola war das übergenug. Ihre Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit stand in einem gewissen Gegensatz zu dem, was sie sich tatsächlich hätte leisten können.
Leona strebte mit tänzelnden Schritten dem Hause zu.
Antonio war ein Klubdiener, wie er sein soll: zurückhaltend, aufmerksam, ruhig — und vor allem diskret. Er kannte jede Schwäche der vielen Herren, die in ‚seinem Hause’ verkehrten, in dem er viel eher die Rolle eines liebenswürdigen Gastgebers, als die eines Dieners zu spielen schien.
Alles im Leben — so philosophierte Antonio — war eine ewige Wiederholung. Abend für Abend fanden sich die gleichen Gruppen über den Karten zusammen; Abend für Abend fachsimpelten drei Juristen am ‚Paragraphentisch’, und Abend für Abend trank der alte Kapitän Cato gerade so viel, daß er noch eben allein nach Hause fand.
Unerhört aber und aller göttlichen Ordnung zuwiderlaufend erschien es dem guten Antonio, wenn sich einmal etwas ereignete, was mit den Gebräuchen des Hauses nicht in Einklang zu bringen war.
So etwas war am gestrigen Abend geschehen. In Doktor Ricardi, diesen sonst so ruhigen und so sympathischen Menschen mußte der Teufel gefahren sein. Niemand kannte ihn bisher anders, als friedlich beim Schach mit einem Partner in einer Ecke hockend, wobei er bisweilen Bekannten ein freundliches Wort spendete. Manchmal auch unterhielt er sich mit einem Kollegen von der Universität über zoologische Fragen. Dabei trank er mit Maßen. Man hatte ihn niemals auch nur angeheitert gesehen.
Und gestern?
Gestern hatte er eine Flasche nach der anderen auffahren lassen. Alle, die an den Tisch traten, hatte er eingeladen. Man steckte die Köpfe zusammen; man fragte ihn, was denn los sei. Welches Glück war ihm zugestoßen? Hatte er in der Lotterie gewonnen? Fiel ihm vielleicht eine Erbschaft zu? Oder war ihm seine Frau durchgebrannt?
Aber er hatte ja gar keine Frau!
Sämtlichen Fragen wich er mit einem überlegenen Grinsen aus. Seine Züge waren verzerrt, seine Bewegungen hatten etwas Marionettenhaftes. Sein Blick war starr.
Als der Alkohol bei ihm zu wirken begann, war er plötzlich verschwunden. Zwei Stunden später tauchte er wieder auf, ließ neue Flaschen kommen, lud neue Gäste ein. Endlich konnte er sich nicht mehr aufrecht halten. Er saß und redete wirres Zeug. Er habe heute Abschied zu nehmen; Abschied von einer Lebensperiode.
Manche ahnten, was vor sich ging. Der junge Gelehrte tat ihnen leid.
Lallend begann er von Schlangen zu sprechen, und daß zwischen Schlangen und Frauen wirklich manchmal viel Ähnlichkeit herrsche. Er machte fade Witze darüber, — und damit verriet er sich.
Nach und nach zogen sich die anderen Gäste von ihm zurück: sie waren froh, von ihm loszukommen. Er achtete ihrer nicht mehr. Ob er zu ihnen sprach oder zu der tausendkerzigen Krone, die über ihm hing, war ihm gleichgültig.
Endlich hockte er, völlig in sich zusammengesunken, aber immer noch redend, allein in der Ecke.
Die meisten Gäste hatten das Haus verlassen. Es war schon spät.
Da kam Antonio und nahm sich des Einsamen an. Behutsam hob er ihn auf den Stuhl zurück, von dem er gesunken war. Dabei traf ihn Doktor Ricardis gläserner Blick. „An — Anto—nio!” lallte er, „Gu—gute Seele, bring — bring mir noch eine Fla — Flasche Wein!”
Antonio, aus Erfahrung schöpfend, benutzte diese Flasche als Lockmittel, um den Betrunkenen in ein anderes Zimmer zu bringen. Dieses Zimmer war leer von Gästen und enthielt eine Couch. Mit viel Takt und Geschicklichkeit brachte Antonio seinen ‚Patienten’ dahin, daß er sich auf dieser Couch niederließ.
Fünf Minuten später war Doktor Ricardi eingeschlafen...
Der Professor hatte bei allen möglichen Leuten herumtelefoniert. Erst zuletzt kam er auf den Gedanken, auch im Klub einmal anzurufen. Ob man von Doktor Ricardi was wisse? Wie, bitte? Ricardi befindet sich dort?
Da Costa atmete hörbar auf. „Rufen Sie ihn doch gleich an den Apparat.”
Antonios freundliche Stimme erwiderte: „Ich möchte ihn lieber ausschlafen lassen. Er hatte sich gestern abend ein wenig übernommen. Da blieb mir nichts anderes übrig, als ihn hier zu beherbergen, Herr Professor.”
„Es hilft nichts, Antonio. Wecken Sie ihn — ich muß ihn unbedingt sprechen.”
„Ist es wirklich so dringend?”
„Ja! Es handelt sich um — — aber das kann ich Ihnen telefonisch nicht sagen. Jedenfalls ist Gefahr im Verzuge.”
„Warten Sie, Herr Professor — — ich hole ihn!”
„Gefahr im Verzuge — Gefahr im Verzuge” — murmelte Antonio immerfort, während er in das Zimmer eilte, in dem sich der Doktor befand.
Ricardi mußte gerade erwacht sein. Vielleicht von dem Läuten des Telefons. Er blinzelte mit den Augen, rieb sich über die Stirn.
„Wo bin ich — —? Du lieber Himmel —!”
„Kommen Sie mit mir, Herr Doktor. Der Professor wartet am Telefon. Es ist Gefahr im Verzuge!”
Ricardi sprang mit einem Satz hoch. Taumelnd schritt er der Tür zu. Antonio führte ihn zum Apparat.
„Herr Professor!”
„Sind Sie es wirklich, Doktor? Ihre Stimme klingt ja so fremd.”
„Mag schon sein, Herr Professor. Ein wenig rauh, wollten Sie wahrscheinlich sagen. Das hat seine Gründe. Ich muß um Entschuldigung bitten.”
„Beantworten Sie mir sofort eine Frage, Doktor! Wo steckt die Todesotter?”
Doktor Ricardi fuhr einen Schritt zurück, starrte den Apparat an, als begreife er nicht, was eben gesprochen wurde. Endlich erwiderte er, fast belustigt, als habe der Professor nur einen Scherz gemacht: „Selbstverständlich ist sie in meinem Zimmer in dem Blechkasten eingesperrt.”
„Nein. Eben nicht. Die Schlange ist fort. Der Kasten stand offen. Ich glaubte, Sie hätten sie vielleicht mitgenommen.”
Vier, fünf Sekunden verstrichen, bis Doktor Ricardi sich so weit gefaßt hatte, daß er antworten konnte. „Ich habe die Schlange nicht. Wenn der Kasten tatsächlich offen stand, muß ihn ein Fremder geöffnet haben. Hat man denn das Tier nicht im Zimmer gefunden?”
„Nein. Niemand weiß, wo es steckt. Es wird sich in irgend einen Winkel des Hauses verkrochen haben. Die Aufregung, die hier herrscht, werden Sie sich vorstellen können. Kommen Sie bitte sofort!”
Der Passagierdampfer ‚Genova’, ein stolzes Schiff neuerer Bauart, brach sich durch eine mäßig bewegte See seine Bahn.
Das letzte Tageslicht, blaß verglimmend, wich der anrückenden Nacht.
Doktor Colonna, der Schiffsarzt, wurde vom Capitano angerufen, der auf der Kommandobrücke die Instrumente verglich. „Kommen Sie noch ein wenig zu mir herauf, Dottore!” sagte der Kapitän. Dann deutete er in die Ferne, wo sich an dem sonst klaren Himmel düstere Wolken zusammenballten. „Ich fürchte, wir werden in dieser Nacht noch ein Wetter bekommen!”
Colonna stieg mürrisch die eiserne Treppe hinauf. Er haderte mit dem Schicksal. Seine Gedanken kreisten um Viola. Vorgestern hatte er sich mit ihr verlobt, und er hatte damit gerechnet, einige Tage an Land bleiben zu können. Aber schon am folgenden Tage hatte er wieder mit auslaufen müssen. Der Urlaub war schon bewilligt gewesen, — da wurde seine Vertretung krank, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als diese Fahrt nun doch wieder mitzumachen. Das Ziel des Dampfers war Kairo.
Gewiß — Dienst ist Dienst, — aber wenn es so kam, machte es keinen Spaß mehr. Warum hatte nur der Kollege gerade jetzt krank werden müssen!
„Colonna — Sie träumen ja?!” hörte er plötzlich die rauhe Stimme des Kapitäns.
Er fuhr sichtlich zusammen. „Verzeihen Sie, Capitano —”
Der lächelte. „Oh — ich verstehe schon, — wenn man sich gerade mit einem hübschen Mädchen verlobt hat, kommt einem die See nur noch salzig vor. Ja ja, das war Pech, mein Lieber, daß Sie nun doch gleich wieder fort mußten. Aber nach unseren persönlichen Wünschen geht es ja leider nicht, — oder wenigstens doch nur selten. Daran müssen wir uns gewöhnen. Wie man sich damit abfindet, — daran erkennt man den inneren Kern eines Menschen.”
„Verzeihen Sie, Capitano — aber ich glaube, mein Kern ist noch ziemlich weich.”
Beide lachten. Aber Colonna wurde gleich wieder ernst. Er versuchte vergeblich mit dem ‚sich abfinden’ fertig zu werden, — obwohl er doch eigentlich sonst recht vernünftig war, — viele Jahre und eine reiche Erfahrung, wie etwa der Kapitän, hatte er allerdings noch nicht auf dem Buckel.
Er blieb einsilbig und verdrossen. Der Capitano fand diesmal nicht den erwünschten Unterhalter an ihm.
Colonna zog sich auch bald mit einer knappen Entschuldigung in seine Koje zurück. Er träumte mit offenen Augen von seiner Braut. Dabei dachte er mit dem Gefühl einer tiefen Genugtuung darüber nach, wie sich alles entwickelt hatte.
Jeder Außenstehende würde behauptet haben, daß hier das Schicksal keine außergewöhnliche Leistung vollbracht habe. Dem jungen Verliebten kamen jedoch die Dinge besonders romantisch vor.
Er hatte Viola vor zwei Jahren kennen gelernt. Damals trat sie als Sekretärin in das große Speditions- und Lagerhaus seines Vaters ein. Professor da Costa, dessen Nichte sie war, hatte sie dem Vater empfohlen. Der alte Colonna gab viel auf diese Empfehlung und fuhr auch nicht schlecht dabei.
Da Costa hätte seine Nichte gern bei sich beschäftigt; er hielt dies jedoch nicht für das richtige.
Ottone Colonna wurde erst auf sie aufmerksam, als der Assistent des Professors, Doktor Ricardi, dem jungen Mädchen in der auffälligsten Weise den Hof zu machen begann. Plötzlich entdeckte Ottone, daß hier etwas nicht in Ordnung sei, — ohne gleich den Grund seiner seltsamen Aufregung zu erkennen.
Heute wußte er ihn: es war Eifersucht. Durch die Schwärmerei eines anderen war er selbst zum Schwärmer gewordeh. Auch er begann nun dem eigenartig hübschen Mädchen seine Neigung zu schenken und — diesen Umstand fand er besonders romantisch — ihre Wahl fiel auf ihn. Er war der Glückliche, der als Sieger aus diesem Rennen hervorging; der gute Assistent hatte das Nachsehen.
Diese Ereignisse batten sich in aller Ruhe und Friedfertigkeit abgespielt. Allerdings machte Ricardi bis zuletzt noch Versuche, den verlorenen Posten zurückzugewinnen. Aber das half ihm nichts. Violas Herz, ihr strahlendes Lächeln, das glückliche Aufblitzen ihrer Augen galten ja doch nur ihm.
Wie sich Ricardi wohl damit abfinden mochte? Er mußte inzwischen von der Verlobung erfahren haben. Leicht war es bestimmt nicht für ihn.
Colonna verspürte eine angenehme, erschlaffende Müdigkeit. Er spann seine Träume weiter und schlief alsbald, von den schönsten Bildern umgaukelt, ein.
Leona hatte schon mehrere Male geläutet und, als niemand öffnete, an die Tür geklopft. Es blieb still im Hause. Nichts regte sich. Sollte Viola schon zum Baden gegangen sein?
Die Freundin hatte gewiß nicht daran gedacht, daß sie, Leona, heute noch frei hatte. Sie war wegen einer starken Erkältung dem Betriebe mehrere Tage lang fern geblieben, hatte sogar das Bett hüten müssen. Heute freilich fühlte sie sich wieder wohl.
Viola war gewiß zum Strande hinuntergegangen.
Also machte sich auch Leona dorthin auf den Weg. Sie tänzelte einen schmalen steinigen Pfad hinunter, der sich zwischen stachligen Kakteen hindurchwand. Zwischen den Kakteen wucherte eine üppige Blumenpracht.
Im Wasser tummelten sich bereits zahlreiche Badende, vorwiegend Fremde, die das entzückende Pegli zum Kuraufenthalt gewählt hatten. Badehäuschen und Liegestühle mit farbigen Schirmen leuchteten in verwirrender Buntheit. Die vielfarbigen Badeanzüge der Damen vervollständigten das abwechslungsreiche Bild.
Spielende Kinder tobten lärmend am Strande entlang.
Leona hielt überall Ausschau, aber sie konnte ihre Freundin nirgends entdecken. Viola war nicht hier.
Etwas enttäuscht kehrte das junge Mädchen auf dem gleichen Wege zurück, auf dem es gekommen war. Der bequemere Promenadenweg, der sich etwas weiter nördlich zur Höhe hinaufwand, war ihr gar zu belebt. Sie wollte für sich allein bleiben und ungestört ihren Betrachtungen nachgehen können.
Die Tür, die in Doktor Ricardis Zimmer führte, wurde nur einen Spalt weit geöffnet und gleich wieder zugemacht.
Niemand befand sich in dem großen, behaglich eingerichteten Raum. Wenigstens kein menschliches Wesen. In dem Herbarium, das in der Nähe des Fensters stand, herrschte allerdings Leben genug. In ihm befanden sich prächtig schillernde exotische Eidechsen der verschiedensten Art.
Einige Minuten waren vergangen, da wurde die Tür abermals, diesmal vollständig, aufgemacht.
Der Hausmeister, gefolgt von Herrn Conti, trat in das Zimmer. Da Costa hatte beiden den Auftrag gegeben, noch einmal gründlich Umschau zu halten.
Plötzlich stieß der Hausmeister einen Schreckensruf aus.
„Die Schlange! Die Schlange! Schauen Sie — — dort in der Ecke, Herr Prokurist!”
Auch Conti starrte das Tier an, das sich in einen Winkel des Zimmers geflüchtet und dort zusammengeringelt hatte. Es machte durchaus nicht den Eindruck, als ob es auf einen Angriff bedacht sei.
Der Hausmeister hielt einen langen Stock in der Hand. Er begann der Schlange näher zu rücken.
Conti suchte ihn davon abzuhalten. Aber der Mann war wie behext. „Ich schlage sie tot!” rief er. „Nur wenn sie tot ist, wird man uns glauben, daß sie unschädlich gemacht worden ist.”
Mit diesen Worten hieb er in blinder Wut auf das Tier ein.
Die nicht sehr große Schlange war bald erledigt. Der Hausmeister faßte den noch lange zuckenden Körper am Schwanz und hob ihn empor. Triumphierend zog er, von dem Prokuristen begleitet, davon.
Im Hauptbüro wurde die Schlange herumgezeigt. „Die Gefahr ist vorüber. Niemand braucht jetzt mehr Angst zu haben.”
Die meisten lächelten. Angst? Pah — Angst hatte doch überhaupt niemand gehabt!
Ihren Mienen sah man jedoch die Erleichterung an.
Eine Viertelstunde später kam Doktor Ricardi. Er sah elend und blaß aus. Seine sonst immer frischen und lebhaften Züge waren erschlafft. Ein schwacher Bartansatz umrahmte seinen Kinn. In der Eile hatte er keine Zeit gefunden, sich zu rasieren. Es war ihm darum zu tun, sofort mit dem Professor zu sprechen.
Da Costa empfing ihn mit einem Lächeln. „Da kommt ja der plötzlich unsolide Gewordene!” rief er. „Nehmen Sie Platz, Herr Doktor. Wie fühlen Sie sich?”
Ricardi ärgerte sich über die Art, wie er empfangen wurde. Auch wunderte er sich darüber, daß der Professor nicht gleich auf die Schlange zu sprechen kam. Er erkundigte sich deshalb danach, ohne auf die Frage da Costas zu antworten.
„Oh — die Otter?” sagte da Costa ruhig, „die ist inzwischen gefunden worden. Sie hatte wohl nur einen kleinen Ausflug durch Ihr Zimmer gemacht. Wahrscheinlich wollte sie einmal eine Abwechslung haben.”
Die ganze Art, wie der Professor sprach, paßte dem Doktor nicht. Aber er schwieg dazu. Endlich fragte er: „Hat man sie wieder in den Kasten gesperrt?”
„Nein, — leider muß ich Ihnen berichten, daß der Hausmeister sie erschlagen hat. Das wäre allerdings nicht nötig gewesen — aber man muß es schon seiner Erregung zugute halten. Auch dem übrigen Personal gegenüber war es wohl besser, wenn man sich überzeugen konnte, daß das Tier tot ist.”
Doktor Ricardi fuhr erschrocken zusammen. „Was — tot?” rief er. „Man brauchte die Schlange doch nicht gleich zu erschlagen. Das werde ich dem Hausmeister nicht verzeihen. Ich machte gerade eingehende Experimente mit dem Gift dieses Tieres. — Wo hat man es hingebracht?”
Da Costa zuckte mit den Achseln. „Was weiß ich! Jedenfalls bin ich froh, daß der Aufruhr im Hause beigelegt und kein Grund mehr zu Befürchtungen da ist. Ich verstehe nur nicht, wie das Tier hat entweichen können.”
Der Doktor rückte nervös auf seinem Stuhl hin und her. „Ich auch nicht. Meines Wissens ist der Kasten, als ich fortging, fest verschlossen gewesen.”
„Hm. Ihres Wissens. Sie sind also nicht ganz fest davon überzeugt?”
„Doch. Ich möchte einen Eid darauf leisten.”
Der Professor blickte seinen Assistenten von der Seite an. „Mit Eiden muß man vorsichtig sein, lieber Doktor!”
„Möglicherweise hat jemand anders den Kasten aufgemacht.”
„Wer sollte das denn gewesen sein?”
Doktor Ricardi schwieg. Er erhob sich und trat ans Fenster.
Man hatte von hier aus einen weiten Blick über den Hafen. Eben lief ein großer Frachter aus Übersee ein und bewegte sich majestätisch langsam zwischen den unzähligen anderen Fahrzeugen hindurch auf die Mole zu, an der er festmachen wollte.
An einer anderen Stelle strömten zahlreiche Menschen zusammen, um einen Passagierdampfer zu besteigen, der nach Ostindien ausfahren wollte. Die verwehten Klänge einer Kapelle schallten herüber. Der schrille Pfiff einer Pinasse klang jäh dazwischen.
Dieses Bild prägte sich der Doktor mit einer unnatürlichen Schärfe ein. Es war ihm zu Mute, als sei er auf einmal aus einem Traum in die Wirklichkeit zurückversetzt worden.
Der Professor sprach weiter: „Jedenfalls wollen wir froh sein, daß die Sache behoben ist, — und da nichts passierte, brauchen wir ihr auch nicht weiter nachzugehen. Aber ich möchte Sie doch bitten, auf Ihre gefährlichen Pfleglinge in Zukunft ein noch wachsameres Auge zu haben, Herr Doktor!”
Ricardi empfand diese Mahnung als unberechtigt. Aber er wollte sich jetzt nicht streiten. Er hob nur bedauernd die Schultern und ging hinaus.
Leona hatte beim Friseur und in verschiedenen Geschäften nach ihrer Freundin Umschau gehalten. Aber Viola war nirgends zu finden.
Endlich kehrte das junge Mädchen zu dem Häuschen zurück, um dort noch einmal sein Glück zu versuchen.
Es wurde ihm wieder nicht aufgemacht.
Daraufhin wandte sie sich an die Bewohner der Villa, zu der das Häuschen gehörte. Ob man Viola heute noch nicht gesehen habe?
Nein. Weder die Herrschaften noch das Personal hatten das junge Mädchen erblickt. Was jedoch nichts zu bedeuten habe, da man Viola des öfteren tagelang nicht zu Gesicht bekam. Sie pflegte selten den Haupteingang zu benutzen. Meistens betrat sie das Grundstück vom Garten her.
Leonas Unrute wuchs. Irgend etwas, das fühlte sie deutlich, stimmte hier nicht.
Sie kehrte zu dem Häuschen zurück. Von der Veranda aus konnte man in Violas Schlafzimmer blicken. Leona ging die kurze Treppe hinauf und hielt Umschau. Das Fenster war nicht völlig geschlossen. Die junge Späherin drückte es vollends auf.
Da sah sie in höchstem Erstaunen, daß Viola in dem Zimmer auf ihrem Bett lag.
Ohne Bedenken stieg Leona über Sims und Blüstung und drang in das Zimmer ein.
Der Hausmeister hatte die tote Schlange herumgezeigt und war im Begriff, sie in den Hof zu bringen, um den Kadaver dort in einem Abfalleimer verschwinden zu lassen.
Unterwegs hielt ihn der Tierpfleger Pucci an. „Zeige mal her das Biest! Ich habe eben ein wenig abseits gestanden und konnte es nicht recht sehen.”
„Was ist daran schon zu sehen!” versetzte der Hausmeister mürrisch und schickte sich an, seinen Weg fortzusetzen. „Eine Schlange wie jede andere.”
Pucci tippte sich an den Kopf. „Hast du eine Ahnung! Wie jede andere! Weißt du, wie viele verschiedene Arten es gibt?”
„Wenn du fachsimpeln willst, mußt du zu Doktor Ricardi gehen.”
„Zeig mal die Schlange her!”
Der Hausmeister hielt das Tier dem Pfleger so dicht vor den Kopf, daß es fast die Nase des Mannes berührte.
„Da hast du sie! Kannst sie dir sauer einlegen lassen oder auch um den Hals hängen, wenn du willst! — Warum starrst du das Vieh denn so an?”
Tatsächlich hatte Pucci die Augen weit aufgerissen. Dann schüttelte er den Kopf. Aber das einzige, was er hervorbrachte, war: „Sehr merkwürdig!”
„Was ist merkwürdig?” fragte der Hausmeister, „wieso kommt dir diese Schlange merkwürdig vor?”
„Ach — ich vergleiche sie in Gedanken mit einer anderen. Legst du großen Wert darauf, sie auf den Müll zu werfen?”
„Was heißt das?”
„Ich möchte sie haben.”
„Brate sie meinetwegen und friß sie auf!” rief der Hausmeister, warf dem anderen das tote Tier vor die Füße und ging davon.
Pucci nahm einen Zeitungsbogen aus seiner Tasche, raffte die Schlange auf und wickelte sie vorsichtig, als ob sie etwas besonders Kostbares sei, in den Bogen ein.
Eine Minute später ließ er sich bei Doktor Ricardi melden.
Ricardi hatte sich nach der Aussprache mit dem Professor rasieren lassen, um dann gleich in sein Zimmer zurückzukehren. Er hatte verschiedene wichtige Arbeiten vor, in die er sich mit Eifer versenkte. Auf diese Weise kam er am besten über alles hinweg.
Es klopfte. Pucci trat ein.
„Verzeihen Sie, wenn ich störe, Herr Doktor — — — ich wollte Ihnen bloß etwas zeigen. Es handelt sich um die Todesotter, die bei Ihnen entwichen war.”
Ricardi wandte sich mürrisch um, erhob sich und trat mit fragender Geste auf den Mann zu. „Ja — also was ist mit ihr? Ich hörte, daß sie erschlagen wurde.”
Der Pfleger packte die Schlange aus. „Das ist sie jedenfalls nicht, nicht wahr?”
Der Doktor starrte die Schlange an. „Nein, natürlich nicht. Es war eine Todesotter. Dies ist eine ganz andere Gattung.”
„Deshalb bin ich gekommen, Herr Doktor. Dies ist das Tier, das als Todesotter herumgezeigt wurde, — als die in Ihrem Zimmer erschlagene Todesotter.
Ricardi erblaßte. „Aber das ist ja — — ich verstehe das nicht.”
„Mir ist es auch schleierhaft. Irgend etwas stimmt da doch nicht.”
„Nein. Gewiß nicht. — — Kommen Sie, kommen Sie! Das muß aufgeklärt werden. Wir wollen gleich zum Professor gehen.”
Mit diesen Worten zog Doktor Ricardi den Mann zur Tür hinaus.
Leona war an das Bett ihrer Freundin getreten. „Viola!” rief sie, „wach auf!”
Ihr war unheimlich zu Mute. Sie wußte, sie fühlte schon, daß ihr Rufen vergeblich war. Viola konnte sie nicht mehr hören. Sie lag steif und still, rührte sich nicht mehr — war tot.