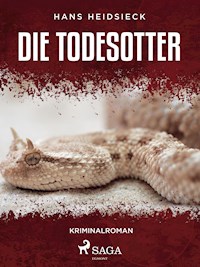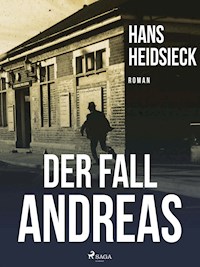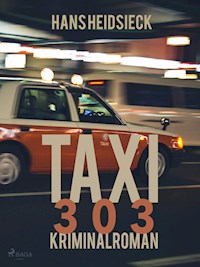Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Entwicklungsroman der besonderen Art! Peter Steffens lebt einsam mit seinem Vater, seinem Bruder Johann und seiner Stiefmutter auf dem Eisenkahn Margarete. Vater und Bruder sind ständig betrunken und die Stiefmutter ist abgrundhässlich und gemein. Doch Peter, intelligent und strebsam, will dieses Milieu verlassen. Er will um die Welt reisen, macht im Vorbeigehen eine bahnbrechende Erfindung und verhilft dem Geheimrat Melander wieder zu seinem Brillantkreuz, das ihm gestohlen worden war. Dabei lernt er die einzige Tochter des Geheimrats, Hedwig, kennen. Sie verliebt sich in ihn und er hält es mit Morgenstern: "Und hier beweist sich messerscharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf." Melander, der große Reeder, erkennt die Begabung Peters und fördert ihn, bis er erkennen muss, dass die Beziehung seiner Tochter mit Steffens auf eine Heirat hinauslaufen wird. So wird aus Peter – dem Geförderten – Peter der Verfemte beim Geheimrat. Doch Peters Aufstieg geht unaufhaltsam weiter.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Schiffe auf dem Rhein
Saga
Schiffe auf dem RheinCopyright © 1952, 2019 Hans Heidsieck und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711508473
1. Ebook-Auflage, 2019 Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Erstes Morgenläuten zittert über den Rhein, der plötzlich durch den Nebel emporsteigt.
Ein Riesenkran reckt sich über den Hafen. Eiserne Kähne erwachen aus tiefem Schlaf. Ketten beginnen zu rasseln. Ein Köter klefft einen Matrosen an, der mit Eimer und Scheuertuch über die Planken schlurft . . .
Schrill pfeifend stampft eine Dampfpinasse heran. Sie kommt wie ein Schatten durch den weichenden Nebel geschwommen. — Die Hafenpolizei unternimmt eine Rundfahrt.
Hinter den Schleiern hebt sich die Stadt empor; die grosse Stadt am Rhein mit ihren Zinnen und Türmen wischt sich den Schlaf aus den Augen . . .
Bald regt es sich überall. Luken werden geöffnet; Rufe erschallen; tappende Schritte dröhnen auf eisernem Bootsbelag.
Der Matrose hat mit Scheuern begonnen. Dabei pfeift er einen Gassenhauer zwischen den Zähnen. Vom Dach der Kajüte aus schaut ihm der Köter zu.
An den Dampser, tief ins Wasser gedrückt, schmiegt sich ein beladener Eisenkahn; aus der Wohnkajüte steigt bläulicher Rauch empor. —
Plötzliches Kettenrasseln und Zischen verkündet, dass der grosse Dampfkran seine Arbeit begonnen hat. Er keucht wie ein gewaltiges Tier dabei. Ueber die Hafenstrasse, die eine Erneuerung ihres Pflasters sehr nötig hat, holpert ein schwer beladener Wagen. Auf dem Gleisanschluss rollt eine Lokomotive. Grelle Pfiffe reissen die Luft entzwei.
Die Wohnkajüte des Eisenkahns ‚Margarethe’ wird soeben geöffnet. Ein junger Mann steigt, seine Augen gegen die aufsteigende Sonne schützend, an Deck empor. Er steckt in einem Matrosenanzug, der ihm zu weit ist. Helle, blaue Augen schauen gross in den lachenden Morgen hinaus. Er reckt sich, gähnt und atmet aus voller Brust, als ob er die ganze Schönheit dieses Morgens in sich aufsaugen wolle. Dann tritt er in die Kajüte zurück und klopft an die Tür einer Bretterverkleidung.
„He, — Vadder! ’s wird Zeit!“
Eine brummende Stimme erwidert etwas von innen; doch man versteht sie nicht.
Der Jüngling nimmt sich des Herdes an. Er hatte schon vor einer Viertelstunde Feuer entzündet; es will aber noch nicht brennen.
Ein anderer, älterer Bursche tritt in Hemdärmeln aus der Bretterverkleidung. „Nu, — haste Kaffee gekocht?“
„Ne! Dat Holz will nicht brennen! Kommt Vadder bald?“
„Vadder is wieder eingeschlafe“ erwiderte unwirsch der Ältere. „Und übrigens könnte der Kaffee längst fertig sein!“
„Du has gut rede! Hilf mer lieber mal blase!“
Mit vereinten Kräften schürten beide die Glut. Endlich brannte das Feuer. Aber der Kaffee kochte noch nicht, als der Vater kam.
Der Mann hob seine schwielige Rechte und knallte, ohne ein Wort zu sagen, dem jüngeren seiner beiden Söhne eine Maulschelle herunter. Der duckte sich wie ein geschlagener Hund. Dann hantierte er ruhig weiter. „Dat Holz war nass“, sagte er nur zur Entschuldigung.
Der Bruder schnitt sich eine Scheibe Brot ab, die er dick mit Butter bestrich. Endlich konnte man Kaffee trinken . . .
Da ertönte eine keifende Stimme aus dem Innern des Bretterverschlages: „Pitter! Is de Kaffee all fertig?“
Peter, der junge Koch, steifte sich auf. „Ja, Mudder!“ rief er nach dem Inneren der Kajüte. „Von mir aus kannste jetz uffsteh’n!“
Die Stimme von innen nahm einen kratzenden Ton an, indem sie erwiderte: „Von dir aus! — Ich will dir: von dir aus! Warte nur, bis ich ’rauskomm’, dummer Schöps, woste bis!“
Kurze Zeit später kam eine alte, hässliche Person im Unterrock in die Küche gehumpelt. Peter war jetzt allein. Vater und Bruder hatten die Kajüte verlassen. „Wo is dä Kaffee?“
„Wo is dä Raffee?“
„Hier!“
„Warum haste mir noch nit einjeschenkt?“
„Dann wär’ er jo kalt geworde! Und iwerhaupt haste jo nix jesagt!“
Die Stiefmutter gab dem Jungen einen energischen Rippenstoss, dass er gegen die Ofenbank taumelte. „Man kann euch zu nix gebrauche!“ wetterte sie, während sich der Junge die Hüfte rieb.
Ein graubärtiger Mann trat in die Kajüte. Die Frau blickte auf:
„Nu, Matjes Sepp — — alleweil so früh schon am Morge —?“
„Ich sollte entlade helfe. Dä grosse Kran wird erst zu Mittag frei. Wo is enger Mann?“
„Minge Mann? Uff un davon! Wahrscheinlich zum ‚Onkel Tom’. Ihr wisst doch, dass er am ersten Tag nach der Landung zu feiern pflegt . . .“
„Ja, dat weiss ich. Aber man sollte ihn hole. Diesmal is’s eilig. Dä Jung könnt’ ja mal hinspringe!“
Peter trat an den Tisch, wo die Stiefmutter eben anfing, schmatzend Kaffee zu schlürfen.
„Auch ebbes Kaffee gefällig, Herr Matjes!“ fragte er freundlich.
„Ne! Aber ’n Schnaps, wenn’s wat sein muss. Un dann mach, dass de zum Vadder kommst. Haste verstande? Ich warte hier. Die Kiste von Amsterdam müssen heut noch zu Stucker und Kompagnie.“
Peter ging. Als er die Tür hinter sich zuschlug, bemerkte er noch, wie der Mann ganz dicht an seine Stiefmutter heranrückte . . . .
‚Zum Onkel Tom’ hiess die Hafenkneipe, in der Peter Vater und Bruder zu finden wusste. Vor beiden stand je ein grosses Glas Kognak. Eine feiste Kellnerin, die ihre Morgentoilette noch nicht völlig beendet hatte, hantierte mit einer Flasche hinter dem grossen Buffet umher.
Peter wurde mit lautem Hallo begrüsst. Auch einige Leute vom Nachbarkahn sassen schon in der Kneipe.
„Vadder,“ sagte Peter, als er endlich nach der Begrüssung zu Worte kam, „du sollst rasch komme, der Kahn muss heute entlade werde.“
Die beiden starrten den Sprecher an, als ob er verrückt sei. Dann packte ihn der Vater am Kragen.
„Jüngelche, — dat Entlade hat Zeit. Erst lösche mer mal unsere Durst, — und dann kütt die Ladung noch lange nich. Haste verstande? Nu bleibste gleich hier un trinkst mit — Kathinka! Bring ens noch e Bittere!“
Als Peter sich sträuben wollte, hielt man ihn mit Gewalt fest. Unter lautem Gejohle aller Beteiligten wurde ihm der Schnaps Glas auf Glas in die Kehle gegossen. Endlich lag er ganz still und rührte sich nicht mehr. Abends schleppten ihn Vater und Bruder völlig betrunken nach Hause.
Die Mutter war nicht daheim. Sie wäre zu Bekannten gegangen, erzählte eine Frau von dem benachbarten Eisenkahn, während ein eigentümliches Lächeln ihre Züge umspielte. —
Am folgenden Morgen begann man die Ladung zu löschen. Wieder brach ein herrlicher Herbsttag an. Peter griff wacker zu. Er machte sich nützlich, wo er nur eben konnte, obwohl er völlig zerschlagen war. Er musste Vater und Bruder bewundern, denen man gar nichts anmerken konnte. Die beiden taten, als ob nichts geschehen sei . . .
Ihm kam das alles ekelhaft vor — die schmutzige Kneipe, — — das liederliche Weib mit den aufgedunsenen Backen, — — — und vor allem der brennende Branntwein, — das wollte ihm nicht mehr aus dem Kopfe gehen . . . .
Über Mittag erschien auf einmal ein fremder Herr, der behauptete, mit Peters Eltern verwandt zu sein. Er sei ein Vetter des Vaters, erzählte er, was er aber erst unlängst erfahren habe. Er wolle doch seine Verwandten auch einmal kennen lernen.
Peter sah sich in das Haus eines wohlhabenden Kaufmanns geladen.
Als der Vetter gegangen war, machte der Vater eine verächtliche Handbewegung. „Dä soll uns in Ruh’ lasse!“ sagte er mit seiner tranigen Stimme, „mer brauche keine Landratteverkehr!“
Peter und Johann suchten den neuen Onkel aber doch heimlich auf. Er wohnte in einem geräumigen Hause und besass eine stattliche Frau. Von drei Kindern war die älteste Tochter ein fast erwachsenes Mädchen.
Den beiden Besuchern kam das friedliche Leben in einem Bürgerhause ganz neu vor. Sie fühlten sich aber in dieser Umgebung wohl.
Der Vater brummte, als er von diesen Besuchen erfahren hatte, zumal ihm Johann dadurch entzogen wurde, den er als eifrigen Trinkkumpan schätzte. Aber er machte keinen ernstlichen Einwand dagegen, als er bemerkte, dass die Liebe im Spiele war. Wie man hörte, sollte der Vetter Vermögen haben, und wenn seine Tochter mit einem der Jungen — — das liess sich schon überlegen!
Wirklich hatten sich beide Jungens bald in die hübsche Paula verliebt. Dadurch kamen die Brüder heftig zusammen. Johann hegte eine erbitterte Feindschaft gegen den jüngeren Bruder und suchte, ihn mit allen Mitteln aus dem Felde zu schlagen.
Peter sprach über seine Gefühle nicht; er tat vielmehr, als ob ihm das Mädchen gleichgültig sei, und gestand sich selbst nur im stillen seine Neigung ein . . .
Paulas Wohlwollen wandte sich Johann zu. Der verstand besser zu prahlen und zu renomieren, als sein in diesen Dingen unbeholfener Bruder.
Johann wusste gegen ihn so spitze und giftige Stiche zu führen, dass Peter in den Augen des Mädchens allmählich minderwertig und verächtlich erscheinen musste. Er aber war eine zu gerade Natur, um sich mit gleichen Waffen zu wehren.
Zu Hause hetzte Johann auch die Eltern noch gegen den Bruder auf. Dadurch spitzte sich das Verhältnis zwischen Peter und seiner Umgebung immer mehr zu.
Er war ein Aussenseiter, — das empfand er ganz deutlich. Es drängte ihn, aus dem Schmutz und Chaos seiner Umwelt herauszukommen; er war doch nur das Aschenbrödel seiner Familie . . . .
Der Schlepper fuhr nach Holland hinunter, um erst nach einigen Wochen wieder zurückzukehren. Da hätte Peter Gelegenheit finden können, abermals mit Paula zusammenzutreffen. Indessen blieb er dem Hause des Kaufmanns fern. So tief auch diese, erste Liebschaft in seiner jungen Seele gewurzelt hatte, er hatte sie doch überwunden. Instinktiv fühlte er, dass ein solches Mädchen wie Paula einer tieferen Neigung nicht fähig und auch nicht wert war. Andererseits wusste er wohl, dass er sich dieser Neigung nicht mehr würde entziehen können, wenn er wieder in dem Hause des Onkels verkehrte. Deshalb mied er peinlich jede neue Berührung. Für die triumphierende Miene des Bruders hatte er nur ein überlegenes Achselzucken.
Das Verhältnis zwischen Peter und seiner Stiefmutter war bald unerträglich geworden. Auch die Reibereien zwischen ihm und dem Vater nahmen kein Ende mehr. Als ihn der Alte einmal im Rausch über die Reling ins Wasser geworfen hatte, sodass er nur mit knapper Not vor dem Ertrinken davonkam, verliess er die ‚Margarethe‘ und verdingte sich auf einem grösseren Handelsschiff.
Die Eltern trauerten ihm nicht nach. Schon lange war er ihnen ein Dorn im Auge gewesen. Durch seine Beobachtungsgabe und scharfe Kritik erschien er ihnen nur lästig und unbequem, wenn er auch meistens nur wenig sprach. Sie hatten seine Verachtung des liederlichen Lebens herausgefühlt, in das man versunken war.
Johann, ein wenig angeheitert, grinste dem Bruder, als er mit seinem kleinen Bündel davonschreiten wollte, frech ins Gesicht.
„Na — alles Gute, Pitter! Du willst ja woll höher hinaus — wennsde erst Millionär bist und siehst mich irgendwo Drehorgel drehe, wirfste mer auch mal e Grosche in minge Mütz, gell?“
Peter wandte seinem Bruder verächtlich den Rücken und schritt davon . . .
Auf der ‚Hansa’, wo er zunächst nur Hilfsdienste leistete, wusste man seinen Eifer und seine Gewissenhaftigkeit bald zu schätzen. Trotz aller Verspottungen seitens der Kameraden, die ihn einen Duckmäuser nannten, blieb er ein anständiger Junge.
Eines Tages hatte er in der Kajüte des Kapitäns aufzuwischen. Bei dieser Gelegenheit fiel ihm ein Buch in die Hände. Das zog ihn an, obwohl es nur ein kaufmännisches Handbuch war. Er blätterte und las eifrig, bis ihn der Kapitän überraschte.
„Nu, Jüngsken, was machste da?“
Peter drehte das Buch verlegen in seiner Hand.
„Ich hab als emol da ringekuckt“ gestand er offen. Der Kapitän lächelte und meinte, wenn er in seiner freien Zeit einmal mehr darin lesen wolle, so solle er das Buch ruhig eine Weile behalten.
Peter benutzte nun jede freie Minute, um zu studieren. Auch unterhielt er sich vielfach mit einem Holländer, der auf dem Dampfer als Hilfsheizer angestellt war. So lernte er in wenigen Wochen eine fremde Sprache beherrschen.
Eines Tages, als er eben Lampen putzte, trat der Sohn des Kapitäns zu ihm heran, um das kaufmännische Handbuch von ihm zu erbitten. Dieses Buch, erzählte der junge Herr, der ein Student war, gehöre ihm, und nicht seinem Vater, dem er es nur zur Orientierung über Havariefragen geliehen habe.
Peter machte ein recht bestürztes Gesicht dazu. Die Rückforderung des Buches kam ihm sehr ungelegen. Dem jungen Philologen entging das nicht. Lächelnd legte er dem Jungen seine Hand auf die Schulter.
„Ich sehe,“ sagte er „Sie interessieren sich scheinbar sehr für dieses Buch. Ich kann mir schliesslich ein neues kaufen. Um Ihnen eine Freude zu machen, schenke ich es Ihnen. Da die ‚Hansa’ hier doch noch einige Tage vor Anker bleibt, können Sie mich auch einmal besuchen. Morgen früh um 10 Uhr bin ich zu Hause. Kommen Sie dann einmal zu mir. Es ist leicht möglich, dass ich Ihnen noch etwas anderes leihen kann, was Sie noch mehr interessieren wird.“
Peter war durch dieses freundliche Anerbieten so sehr überrascht, dass er zunächst gar nichts sagen konnte. Endlich stammelte er unbeholfen seinen Dank.
Am folgenden Morgen klopfte er bei dem Studenten an. ‚Franz Urfeld’ stand auf einer sauberen Karte an der Tür.
Der Raum, den Peter betrat, war an drei Seiten mit Bücherborten umstellt. Einbände jeder Art, sauber und mit Liebe geordnet, blickten freundlich von den Wänden her.
Urfeld erhob sich und streckte seinem Besucher die Hand hin. „Guten Morgen, Herr Steffens,“ sagte er lebhaft „nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind!“
Der ungekünstelte, offene Ton, in dem diese Worte gesprochen wurden, nahm Peter alle Befangenheit. Einfach zwar aber sauber und mit Sorgfalt gekleidet, brauchte er sich vor dem jungen Herrn nicht zu schämen.
„Es freut mich, dass ich Ihnen wirklich willkommen bin,“ sagte er, den Händedruck des Studenten erwidernd, und in offener Bewunderung fügte er gleich hinzu: „Herrgott, haben Sie viele Bücher da stehen!“
Der Student musste lächeln. „Ja,“ sagte er „wenn man das alles im Kopfe hat, was da drinnen geschrieben steht, so kann man sich gratulieren. Wofür interessieren Sie sich denn aber am meisten?“
Peter blickte ihn gross und verwundert an. Diese Frage kam ihm zu überraschend. Er wusste nicht, was er antworten sollte. Urfeld wollte ihm helfen.
„Es muss doch wohl etwas geben, worüber Sie sich ganz besonders gern unterrichten wollen!“ bemerkte er.
„Eigentlich interessiert mich alles,“ erwiderte Peter „und man kann wohl auch nie genug lernen. Um weiter zu lernen, fehlen mir leider die Mittel. Aber als Kaufmann glaube ich vielleicht noch etwas leisten zu können.“
Der junge Student nickte dem geraden, offenen Burschen ermunternd zu.
„Nach allem, was mir mein Vater von Ihnen erzählt hat, glaube auch ich, das hoffen zu dürfen. Bei der Schiffahrt wollen Sie also nicht bleiben?“
Über meine Zukunft lässt sich noch gar nichts sagen,“ erwiderte Peter, „das steht noch in Gottes Hand.“
Urfeld rückte auf seinem Stuhl hin und her. „In Gottes Hand, sagen Sie?“ wiederholte er etwas verhalten. Peter blickte ihm fest in die Augen:
„Ja, allerdings. Ich sagte dies nicht etwa so obenhin. Ich habe Vertrauen zu Gott. Mehr kann ich nicht sagen; aber ich weiss, dass er mich führen wird, wie es am besten ist.“
Der Student erwiderte nichts darauf. Diese Glaubensfreudigkeit lag ihm sern. Auch mutete sie ihn etwas altmodisch an . . .
„Sie wollen sich also — — abwartend verhalten?“ fragte er. „Jedenfalls wünsche ich Ihnen alles Gute im Leben. Wenn Sie etwa zu Ihren privaten Studien irgendwelcher Bücher bedürfen, so steht Ihnen meine Bibliothek jederzeit gern zur Verfügung.“
„Ich danke Ihnen herzlich;“ erwiderte Peter „morgen fahren wir weiter; es geht nach Mainz. Wenn ich mir da vielleicht etwas mitnehmen dürfte — —?“
Als Peter Steffens gegangen war, blickte Urfeld noch lange still vor sich nieder. Ihm war, als besitze jener noch etwas, was ihm selbst verloren gegangen war, und ein Gefühl wie Neid durchzuckte ihn augenblicklich. Aber dann machte er sich wieder an seine Arbeit . . .
Dichte Nebel hingen noch über den Bergen; aber schon brach sich die Sonne Bahn. Die ‚Hansa‘ stampfte stromaufwärts. Sie musste sich jeden Meter erkämpfen.
Die sieben Berge tauchten schattenhaft aus den Nebeln auf. Zur Rechten grüssten die Zinnen von Bonn am Rhein. Mandoline spielend zog ein Trupp Wanderer am Ufer vorüber. Weit scholl ihr Spiel in den frischen Morgen hinaus . . .
Peter Steffens stand auf der ‚Hansa’ hinten beim Steuermann. Seine Augen tranken die Schönheit der Landschaft ein. Obwohl er schon unzählige Male hier vorüber gefahren war, konnte ihn diese Strecke doch immer wieder begeistern. In seinem Gefühlsüberschwang wagte er sogar einmal eine diesbezügliche Bemerkung fallen zu lassen. Der Steuermann nickte ihm gütig zu, etwa wie einem Kinde, dem man seinen Mutwillen nachsieht . . .
Erleichtert atmete Peter auf, als man ihn abberief. Am Bug des Schiffes war eine Kajütentür aus den Angeln gegangen; man brauchte einen geschickten, kräftigen Menschen, der sie wieder einsetzen sollte.
Peter traf hier mit seinem Freunde, dem Holländer, wieder zusammen. Jack Larsen war ihm mit der Zeit immer näher gekommen. Im allgemeinen recht wortkarg, besass er doch ein gutes Gemüt. Schon die rastlose Mühe, die er sich beim Sprachunterricht mit Peter gegeben hatte, liess eine grose, selbstlose Aufopferungsfähigkeit des jungen Menschen erkennen.
Larsen war auch nicht neidisch, obwohl er sah, wie Peter ihn in allem bald überflügelte. Er wusste genau, dass er dem Freunde doch nicht gewachsen sei und fand dies ganz in der Ordnung. Sein Begriffsvermögen arbeitete nicht so einwandfrei wie bei Peter; dafür besass er manchen anderen Vorzug. Vor allem bewiess er einen festen Charakter. Das zeigte seine Anhänglichkeit zu dem Freunde, den alle übrigen immer nur hänselten. Larsen focht es nicht an, dass man Peter den ‚Streber’ hiess. Er hatte alsbald durchschaut, dass nur der Neid auf das Können und die Geschicklichkeit des Freundes diesen Ausdruck aufgebracht hatte. —
Peter streckte Larsen die Hand hin, als er ihm bei der Kajüte begegnete.
„Nun, Jack, wie schaut’s?“
„Danke! Es ist herrlich draussen!“
„Warst du unten bei den Maschinen?“
„Ich habe Kohlen schaufeln geholfen, Peter. Das war eine mühsame Arbeit. Aber ich habe mich dabei in die Kohle hineingeträumt. Den langen Weg, den sie gemacht hat, sah ich ganz deutlich vor mir. Vor zehntausend Jahren vielleicht — —“
Peter lächelte überlegen. „Du träumst zu viel!“ sagte er vorwurfsvoll. „Das ist dein Fehler. Du solltest mehr in der Wirklichkeit leben. Schau hier den Drachenfels, wie er im Sonnenglanz daliegt. Das ist auch wie ein Traum, aber doch Wirklichkeit.“
Sie beschäftigten sich mit der Tür, die bald wieder in Ordnung war. Dann plauderten sie noch ein Weilchen. Es gab im Augenblick weiter nichts zu tun.
Sie unterhielten sich über die Landschaft, und Peter erzählte eine Geschichte aus dem Siebengebirge: „Ursprünglich sind es sieben Riesen gewesen,“ begann er „die kaperten Schiffe und beraubten alles, was ehemals auf dem Rheine stromab fuhr. Bis eines Tages die Kunde kam, ein Königskind aus den Alpen habe sich auf den Weg gemacht; es fahre verkleidet auf einem gewöhnlichen Kaufmannsschiff.
„Von diesem Tage ab unterliessen die Brüder ihr Räuberspiel, da sie es mit dem Königskind nicht verderben wollten. Nur einer von ihnen gedachte sich die veränderte Lage zunutze zu machen. Wer weiss — dachte er — ob die Meldung überhaupt wahr ist! Um dieses Gerüchtes willen aber auch alle anderen schonen, wäre sehr unvorteilhaft; ich plündere weiter, wie es mein gutes Recht und meine Gewohnheit ist . . .
„Also spannte er ein grosses Seil über den Rheinstrom, oberhalb, etwa bei Rolandseck. Von der Stelle aus, wo heute der Rolandsbogen noch aufragt, lauerte er auf seine Opfer. Seine Mannen aber lagen verschanzt am Ufer um aufzupassen . . .“
Peter machte jetzt eine Pause, während ihm Jack gespannt ansah. „Und weiter?“ fragte der Holländer.
„Ja, siehst du,“ fuhr Peter fast kindlich fort „die Königstochter aus den Alpen war schlau genug, um einen ihrer Zauberer vorzuschicken, der ebenfalls als Kaufmann verkleidet stromab fuhr: Als nun das Schiff des Zauberers sich in dem Seile verfangen wollte, verwandelte es der Mann auf der Stelle in ein harmloses Seidenband, das beim ersten Anprall in Stücke riss. Dann wandte er sich an das Ufer, wo er die Mannen vermutete, und hat sie auf der Stelle in Schweine verwandelt. Den Riesen aber holte er von der Höhe herunter und sprach einen schrecklichen Fluch aus. ‚Siebenmal verflucht sei dein Name!’ so rief er, ‚und alle, die ihn tragen, sollen verwandelt werden zu Stein!’
„Damit drehte er seinen Zauberring, sodass im Augenblick der Fluch in Erfüllung ging und die Brüder zu jenen Bergen erstarrten, die du dort liegen siehst.“
„Ja, — als aber dann die Prinzessin der Alpen kam?“
„Denke dir — in der folgenden Nacht war dem Zauberer der Ring verloren gegangen. Eine Maus — so erzählte man — hatte ihn aus der Kajüte getragen, und eine Welle hatte Mäuschen und Ring in die Fluten des Rheines hinabgespült. Der Zauberer aber vermochte nur mit Hilfe des Ringes zu zaubern. So war er hilflos geworden. — Vergeblich forderte die Prinzessin, dass er die sieben Brüder wieder erlösen sollte. Der Zauberer wurde erhängt, in Köln, auf demselben Platze, wo heute der Dom steht. Er hatte sich, da ihm der Ring verloren gegangen war, nicht davor retten können . . .“
Larsen hatte Peters Erzählung andächtig zugehört. Diese einfache Sage gefiel ihm sehr. Sinnend hatte er sich in die Handlung hineingeträumt. Dann aber sagte er plötzlich:
„Schau mal — nun erzählst du mir selbst ein Märchen, — vorhin aber, als ich dir sagte, dass ich beim Kohlenschaufeln ins Träumen gekommen sei —“
Peter unterbrach ihn mit Eifer. „Ja,“ meinte er „du träumtest aber zur unrechten Zeit. Wahrscheinlich wirst du nicht sehr viele Kohlen geschaufelt haben. Jetzt aber dürsen wir träumen, denn es leidet keine Arbeit darunter. Das meinte ich!“
Larsen gab dem Freunde innerlich recht. Dann musste Peter noch einige andere Sagen erzählen. —
Die ‚Hansa’ glitt an Oberwinter vorüber und steuerte Remagen zu. Die sieben Berge blieben in bläulichem Dunst zurück. —
Peter stand wieder beim Steuermann. Er verlor jetzt kein Wort mehr . . .
Ein kleines Motorboot schoss mit fröhlichen Menschen backbords vorüber. Ein bekanntes Rheinlandlied wurde gesungen, und zwischendurch ertönte eine jubelnde Mädchenstimme . . .
Peter erlebte alles tief in der Seele mit. Aber er liess das Steuer keinen Augenblick aus den Händen.
Schwere, schwarze Rauchwolken quirlten aus den Schloten der ‚Hansa’ auf. Gegen Mittag passierte man Andernach. Ein Kohlenschlepper mit leeren Kähnen glitt talwärts an der ‚Hansa’ vorüber. ‚Mathias Stinnes’ stand auf dem Dampfer zu lesen. Peter entsann sich, diesen Namen schon sehr häufig gesehen zu haben. Viele Schiffe auf dem Rhein schien dieser Mann zu besitzen.
Es ging schon spät auf den Abend zu, als die ‚Hansa’ bei Oberwesel endlich vor Anker ging. Peter fühlte eine Entspannung. Er hatte zuletzt fast ununterbrochen am Steuer gestanden und streckenweise das Schiff schon allein geführt. „Euch kann man’s schon anvertrauen!“ sagte der Steuermann, und Peter hatte sehr glücklich dazu gelächelt . . .
An diesem Abend wälzte sich Peter lange auf seinem Lager, ohne Schlaf finden zu können. Seine Gedanken beschäftigten sich mit der Tür, die er mit Larsen zusammen eingerenkt hatte. Es musste doch möglich sein, eine Befestigung zu erfinden, die völlig gegen Windstösse sicherte!
Der Gedanke, eine Erfindung zu machen, trieb ihn zu rastlosem Eifer an. In den letzten Tagen hatte er über ‚Patentrecht’ gelesen. Die Lektüre gab ihm einen äusseren Anstoss.
Wirklich fiel ihm die denkbare Lösung ein. Lächelnd blickte ihm am anderen Morgen der Kapitän in die Augen, als er von seiner Erfindung berichtete. Im Grunde genommen gewann der alte Seebär einen höllischen Respekt vor dem jungen Mann . . .
Einige Tage später konnte der jugendliche Erfinder Franz Urfeld wieder einmal besuchen. Begeistert erzählte er von der Sache, die er während der langen Fahrt bis ins Kleinste ausgearbeitet und durch Zeichnungen Veranschaulicht hatte.
Urfeld hörte ernst und mit Spannung zu. Dann riet er, Peter solle das Weitere einem Fachmann zur Bearbeitung überlassen. Und er gab dem jungen Freunde die Wohnung eines Mechanikers an, der ihm gewiss bei allem gern behilflich sein würde.
Peter freute sich ungemein, bei dem Studenten Anerkennung zu finden. Noch am gleichen Tage suchte er den Mechaniker in einem abgelegenen Stadtteil auf.
Herr Lewald empfing den Ankömmling in einem düsternen Arbeitsraum. Seine grossen, rollenden Augen blickten unstät umher, hafteten aber schliesslich doch mit einiger Spannung auf den Zeichnungen, die ihm Peter zur Erläuterung vorgelegt hatte.
„Hm, — hm, die Sache scheint gut zu sein,“ sagte er nach längerer Prüfung „aber das muss doch alles erst einmal ausprobiert und weiter bearbeitet werden. Lassen Sie diese Zeichnungen bitte hier. Ein Modell muss hergestellt werden. Das weitere wird sich dann finden.“
Peter, hocherfreut, dass seine Arbeit auch bei diesem Manne Anerkennung und Billigung fand, wollte ihm die weitere Ausarbeitung gern überlassen und sagte: „Ich will Sie am Gewinn beteiligen. Auch können Sie schon mit einem Patentanwalt sprechen. In 14 Tagen komme ich wieder. Ich muss noch inzwischen nach Holland hinunter.“
„Schon gut, schon gut! —“ erwiderte der Mechaniker.“ ‚Sie können sich auf mich verlassen.“
Peter, der noch gar nicht die Absicht hatte, zu gehen, fühlte sich durch die kurze und schroffe Art dieses Mannes sonderbar abgestossen.
Herr Lewald beachtete ihn überhaupt nicht mehr sondern wandte sich kurzerhand einer anderen Beschäftigung zu.
Peter verspürte Lust, ihm die Zeichnungen wieder fortzunehmen. Aber er nahm sich zusammen, grüsste knapp und verliess das Haus. —
Wenn aus der Erfindung etwas würde, — überlegte er beim Nachhausegehen, — dann konnte er gewiss eine schöne Summe verdienen. Und weite Perspektiven eröffneten sich vor der galloppierenden Phantasie des jungen Erfinders.
Wenn er Urfeld gegenüber neulich geäussert hatte, er lege alles in Gottes Hand, so hatte er dies ehrlich gemeint. In der neuen Sache sah er eine Fügung des Himmels, und er blickte alles sehr rosig an.
Der Zufall führte ihn eines Tages auf der Strasse wieder mit Paula zusammen. Seinem Bruder war das Mädchen längst leid geworden, wie man das voraussehen konnte. Der zog jetzt eine Kellnerin vor.
Peter zuckte zusammen, als er sie plötzlich sah. An ein Ausweichen oder Vorübergehen war nicht zu denken. Er musste sich schon gefallen lassen, dass sie ihn am Ärmel zupfte und ansprach. —
Paula war zu einer üppigen Schönheit herangeblüht. Sie schien sich ihrer Reize auch bewusst zu sein.
Aber um ihre Mundwinkel war ein unangenehmer Zug getreten, und in den Augen schillerte etwas, was man als Blasiertheit oder Spottsucht ansprechen musste. Für eine gewisse Gattung von Männern mochte sie an Reizen gewonnen haben.
„Ei Peter!“ sagte sie übermütig, „auch noch unter den Lebenden —?“
Sie blickte ihn kokett von der Seite an und spielte mit dem Griff ihres Regenschirms. Ihre Kleidung war sorgfältig aber dennoch geschmacklos. Peter durchzuckte es wieder. Wie hätte er sich an dieses Mädchen wegwerfen können!
„Wie du siehst“ erwiderte er. „Unkraut vergeht ja bekanntlich nicht!“
Krampfhaft bemüht, auch zu scherzen, konnte er den leichten, frivolen Ton doch nicht recht finden.
„Warum bist du gar nicht mehr zu uns gekommen?“ fragte sie obenhin.
Er redete sich unbeholfen heraus. Er habe zu viel zu tun. Auch jetzt müsse er eilig wieder zur ‚Hansa’ hinunter.
Damit nickte er ihr leicht zu und war plötzlich spurlos im Gewühl der Strasse verschwunden. — —
Die ‚Margarethe’ mit Peters Eltern und seinem Bruder Johann an Bord, befand sich auf dem Wege nach Mainz hinauf. Der Alte lag betrunken in dem Kajütenraum. Johann, auch nicht mehr nüchtern, lehnte am Steuer, wobei er sich mit einem anderen jungen Manne unterhielt.
Die Stiefmutter wetterte unten im Küchenraum, wo ihr die Suppe zu schaffen machte. —
Draussen glitt im schönsten Sonnenschein die lieblichste Landschaft vorüber. Aber von einer friedlichen Stimmung konnte man auf der ‚Margarethe’ nichts spüren.
„Weisste,“ sagte Johann zu seinem Genossen, dem Steuermann, „dat stumpfsinnige Lebe auf diesem Äppelkahn bin ich satt geworde. Wenn mer bloss ebbes Vernünftiges anfange könnt’!“
Der andere, ein frecher, junger Bursche mit Blatternarben und einer geröteten Nase meinte mit einem fragenden Ton in der Stimme:
„Ja, weisste — — mit ehrliche Arbeit is heute nix zu verdiene. Da musste scho — lange Finger mache!“
Ein lauernder Blick fiel auf Johann, der ihn gar nicht bemerkte. —
Er lachte rauh und verbissen auf.
„Biste noch nich mit der Polizei in Konflikt gerate?“ fragte er unvermittelt.
„Na, dat gerade nich. Polizei! Pah — von wegen: Die hat mich so leicht nich beim Krawickel!“ Er zog eine goldene Uhr aus der Tasche: „Wie gefällt dir dat Ding da?“
Johann wog die Uhr in der Rechten.
„Dunnerkiel!“ sagte er aufrichtig bewundernd. „Ein schlankes Stückt!“
„Dat is’ ’n Erbstück von ’nem verstorwene Engländer. Als ich noch auf dem Holländer Steward war, is dä nämlich mitte uff der Fahrt mit Tod abgegangen. Ich hatte in der Kajüte zu räumen. Die Uhr lag uff ’m Tisch. — Nur dat Testament hat noch nicht danebe jelege. ‚Herrgott,’ sagte ich mir, als ich da Ding da sah, „dir hätte er se ja doch vermacht. Warst du et nich, der em immer der viele Schnaps gebracht hat, an dem ä sich endlich dat Lewe versoffe hat?’ — Na — — siehste — — wäre ich hingegange, um meine berechtigte Ansprüche geltend zu mache, so hätt et nix als Schererei gegebe; ich aber hätt’ meine goldne Uhr am End’ doch nich bekomme; da hab’ ich mer einfach die Müh gespart!“
Johann hatte der Erzählung des Mannes vergnügt zugehört. Der Steuermann hatte sie mit den drolligsten Gesten begleitet.
„Wenn ich dich nu aber wegen der Uhr anzeige tu’?“ fragte Johann plötzlich mit einem teuflischen Grinsen.
Der andere blieb vollkommen ruhig dabei.
„Dann brauch ich ja nur deinem Alten so allerlei zu verzähle, wer seiner Stiefmudder als so lustig die Zeit vertreibt, wenn dä Olle besoffe in der Kaschemme liegt!“
Johann erblasste. Er tat eine Bewegung, als ob er dem anderen an den Hals springen wollte. Dann aber besann er sich wieder.
„Mach keine faulen Witze!“ sagte er einrenkend. „Mer wolle uns lieber verdrage. Möglicherweise lässt sich in Mainz mal ä Ding drehe!“
Der Steuermann zwinkerte mit den Augen und gab dadurch zu erkennen, dass er verstanden hätte. —
In einer der folgenden Nächte begannen beide ihre unheimliche Tätigkeit, von der zunächst nur ein bestohlener Juwelier etwas merkte. Aber auch die Kriminalpolizei kam dahinter, und sie streckte bald ihre Fühler aus.
Irgendeine Spur hatte sie auf die ‚Margarethe‘ verwiesen. —
Der alte Steffens, ausnahmsweise einmal ganz nüchtern, stand breitbeinig in der Kajütentür, als ein Herr im Touristenanzug über den Steg kam.
Drüben streifte ein Hafenarbeiter scheinbar planlos am Ufer hin.
„Bin ich hier richtig?“ fragte der Fremde freundlich den Alten, der zunächst keine Lunte roch. „Ich suche einen Herrn Steffens.“
„Bin ich!“ erwiderte kurz der Gefragte, indem er eifrig an seiner Pfeife sog.
„Dann dürfte es doch wohl Ihr Sohn sein. Wir waren ehemals auf der Schule zusammen. Wo steckt denn der Johann, wenn ich fragen darf?“
Ein langer, misstrauischer Blick streifte den Fragenden.
„Wat weiss ich, wo dä steckt, dä Halunke!“ erwiderte er. „Ich warte selbst als uff den Bengel. Gestern abend is ä mit dem Steuermann weggegange. Beide sind noch nich wieder zurückgekomme!“