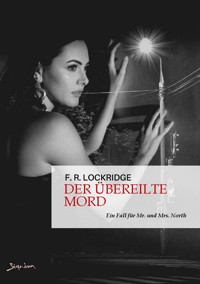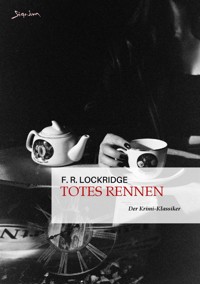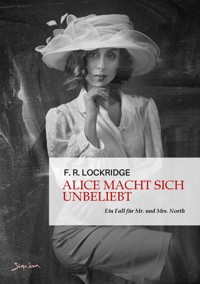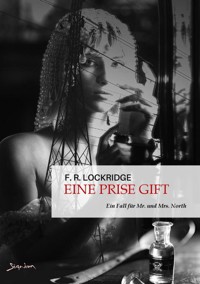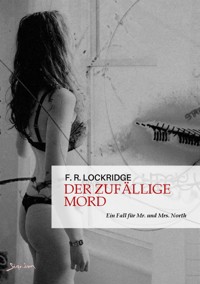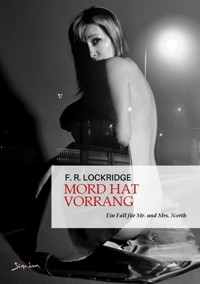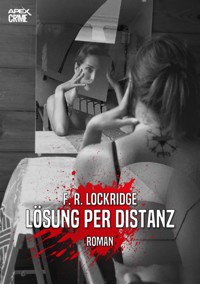6,99 €
Mehr erfahren.
Das Haus, das zu verkaufen selbst die Grundstücksmakler für unmöglich hielten, war groß. Ein Fachwerkgebäude, weit von dem Seitenweg abgesetzt, stand auf einem jetzt völlig von Unkraut überwucherten Feld. Verwahrlost, baufällig, seit Ewigkeiten nicht mehr gestrichen. Nachdem Ackerman im Funkstreifenwagen langsam den kaum noch erkennbaren Anfahrtsweg hinauf und dann um das Haus herum auf einem halbkreisförmigen Weg zu den Scheunen gefahren war, sah auch Heimrich, der in der Limousine folgte, dass die Bodenplanken der vorderen, die ganze Breite des Hauses ein-nehmenden Veranda niedergebrochen waren. Werk der Verwitterung und vermutlich auch der Termiten. Die Fensterscheiben in der Fassade waren fast alle zerschlagen. Das Werk junger Vandalen, zum Teil mindestens...
Der Roman Das zweite Testament von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1962; eine deutsche Erstveröffentlichung folgte 1964.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. R. LOCKRIDGE
Das zweite Testament
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DAS ZWEITE TESTAMENT
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Das Buch
Das Haus, das zu verkaufen selbst die Grundstücksmakler für unmöglich hielten, war groß. Ein Fachwerkgebäude, weit von dem Seitenweg abgesetzt, stand auf einem jetzt völlig von Unkraut überwucherten Feld. Verwahrlost, baufällig, seit Ewigkeiten nicht mehr gestrichen. Nachdem Ackerman im Funkstreifenwagen langsam den kaum noch erkennbaren Anfahrtsweg hinauf und dann um das Haus herum auf einem halbkreisförmigen Weg zu den Scheunen gefahren war, sah auch Heimrich, der in der Limousine folgte, dass die Bodenplanken der vorderen, die ganze Breite des Hauses ein-nehmenden Veranda niedergebrochen waren. Werk der Verwitterung und vermutlich auch der Termiten. Die Fensterscheiben in der Fassade waren fast alle zerschlagen. Das Werk junger Vandalen, zum Teil mindestens...
Der Roman Das zweite Testament von F. R. Lockridge (eigentlich Richard Orson Lockridge; * 26. September 1898 in Missouri; † 19. Juni 1982 in South Carolina) erschien erstmals im Jahr 1962; eine deutsche Erstveröffentlichung folgte 1964.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
DAS ZWEITE TESTAMENT
Erstes Kapitel
Von der Terrasse aus konnte Susan Heimrich den Autobus nicht sehen, wohl aber das Kreischen seiner Bremsen beim Stoppen hören - ein ziemlich lange dauerndes Kreischen, so dass sie, wie stets, einen Moment innerlich bebte. Mussten Bremsen wirklich so kreischen? Die Gegend war hügelig, da brauchten die Busse einwandfreie Bremsen. Kreischten sie gerade hier vielleicht so, weil...? Wie stets, schüttelte sie den Gedanken ab. So eine übernervöse Mutter bist du doch gar nicht, ermahnte sie sich. Sie hörte Kinderstimmen und dann das harte, mahlende Geräusch, als der Bus wieder startete und aut der High Road weiterfuhr: zur Kurve in den Van-Brunt- Pass. Als er das Tempo in der Kurve verlangsamte, protestierten die Bremsen wieder, aber dort war es ja erklärlich.
Ein so schöner Morgen, einer der ersten Junitage. Sie hatte sich wieder ganz beruhigt.
Eine ungewöhnlich große dänische Dogge kam die steile Zufahrt zum Hause herauf, in einer Gangart, als könne jeder Schritt der letzte sein. Als der Hund Susan im Sonnenschein auf der Terrasse stehen sah, machte er halt und schüttelte den Kopf, und sie dachte, dass er gleich eine seiner schweren Vorderpfoten erheben würde, um die immer tränenden Augen auszuwischen. Doch das tat er nicht. Schwerfällig ging er weiter - ein Hund ohne Ziel, der aussah, als hätte er Selbstmordgedanken.
»Er kommt ja zurück, Colonel«, rief Susan ihm über den Rasen hinweg zu. An einem so schönen, frischgrünen Sommertag durfte doch ein Hund nicht unglücklich sein! »Du weißt doch, dass er kommt.«
Colonel blieb wieder, das mächtige Haupt senkend, ein Weilchen stehen, dann schritt er auf schweren Beinen in die Richtung zu ihr, und sie glaubte ihm anzumerken, dass er nun den harten Schicksalsschlag zu ertragen bemüht war. Der Junge ist fort - er wird nie wiederkommen, schien er zu denken. Es ist bitter, ein Hund zu sein. Die Liebe lohnt nicht.
Er lernt es nie, dachte Susan. Manchmal finde ich ihn ein bisschen beschränkt. Ist ja auch nicht so wichtig. »Komm mal her, Colonel«, rief sie, »ich will’s dir noch mal erklären.«
Colonel kam auf die Terrasse, ließ sich schlapp hinfallen, legte den Kopf auf die Pfoten und schaute Susan Heimrich von unten her an. Mochte sie es ihm wieder mal erklären - er glaubte ihr, wie früher auch, kein Wort davon.
An fünf Tagen in der Woche begleitete er vom Hause bis zur Straße den Jungen und wartete dort neben ihm. An den fünf Tagen sam das Ungeheuer mit dem schrecklichen Geruch herangesaust und nahm den Jungen in sich auf, und wenn er dann seinem kleinen Abgott, diesem Jungen, folgen wollte, sagte der: »Nein, Colonel, nein, das geht nicht.« Dann setzte Colonel sich hin, zog den Schwanz dn und weinte. Das übelriechende riesige Ding sauste davon, mit dem Jungen in sich. Und er trottete die Anfahrt hinauf, obwohl das doch gar keinen Sinn mehr hatte. Nichts hatte Sinn.
»Er kommt ja wieder«, sagte Susan ganz ernst zu dem bekümmerten Tier. »Kurz nach drei. Und dann gehst du doch hin, zehn Minuten zu früh, und sitzt vor dem Haus, und wenn du den Bus kommen hörst, bellst du einmal kurz und tollst ihm entgegen Sie hielt inne. Nein, es war nicht Colonels Art, zu tollen. Er, ja, was tat er denn? Latschte er? »Dann rennst du zum Tor hinunter, und der Bus hält und er steigt aus«, sagte Susan zu ihrem Hund, der eigentlich Michael gehörte. »Du weißt doch, wie’s immer ist, nicht wahr?«
Colonel schloss die Augen. Was die Menschen einem Hund so vorlügen! Die Frau kraulte ihm die Schulter, das war ja ganz angenehm, aber - diese Lügerei!
»Komm mit, ich will mal nachsehen, ob schon Zinnien aufgeblüht sind«, sagte Susan, stand auf, ging in den Garten und suchte zwischen dem Unkraut nach jungen Blüten. Die mussten doch jetzt eigentlich aufgehen, wenn auch der Frühling so spät begonnen hatte. Manchmal gab es hier ja wirklich einen Frühling, über den die Zeitungen schrieben; einen, der so war, wie er nach dem Kalender sein sollte, nicht wie diesmal, mit Schnee noch Mitte Mai. Fast ihr ganzes Leben wohnte sie schon in der kleinen Stadt Van Brunt, bei Hawthorne im Staat New York, und einen ganz richtigen Frühling hatte es noch nie gegeben. Jedes Jahr hatte sie die Leute sagen hören - und es auch selbst gesagt -, der Frühling beginne dieses Jahr recht spät. Und sie redeten das so hin, als habe er sonst immer pünktlich begonnen. Vor drei Wochen hatte es noch geschneit, freilich. war der Schnee rasch geschmolzen. Und auf einmal dieser herrliche Morgen. Sommer!
Ob wohl schon Zinnien aufgeblüht sind? Für das Unkraut jedenfalls ist der Frühling günstig gewesen, grübelte sie. Aber da war ja eine, und dort! Und da, wahrhaftig, ein halbes Dutzend dicht beieinander, ganz vom Unkraut eingezwängt. Pflanzen sind doch lächerlich, dachte Susan, kniete sich auf die Erde und fing an, Unkraut auszureißen.
Sie war Ende der Zwanzig, schlank und Ziemlich groß, hatte weit auseinanderstehende graue Augen, braunes, kurz geschnittenes Haar und etwas kantige Schultern. Zu weiten Cordhosen, weißen Söckchen und alten Tennisschuhen trug sie ein weißes, ihr viel zu großes Männerhemd, die Ärmel an den Handgelenken umgeschlagen, und stützte sich bei ihrer Arbeit ab und zu auf die Hände. Sie roch etwas nach Insektenbekämpfungsmitteln. Die Eintagsfliegen waren dieses Jahr ganz bösartig. Wie jedes Jahr.
Ein Sohn in der Schule, der Mann beruflich unterwegs, und die Frau zwischen zudringlichem Unkraut nach zaghaft wachsenden Zinnien suchend. Alles schön und gut, friedlich, wie es sein sollte. Susan wehrte ein leises Schuldgefühl ab. Martha Collins betreute sicher das Geschäft aut der Van Brunt Avenue ganz ordentlich - den Laden im Zentrum des Ortes, der eigentlich mehr eine kleine Ausstellung war. An dessen einem Schaufenster, links unten in der Ecke, mit kleinen eleganten Buchstaben Susan Faye, Textilien stand. Also war es für Susan Heimrich noch früh genug, wenn sie morgen dort wieder mit dem alten Namen auftrat, der ihr in letzter Zeit viel unwichtiger erschien als früher. Morgen mochte das Unkraut weiterwachsen - und das tat es ja nicht zu knapp! Sie widmete sich dann wieder ihrer Gouache-Malerei und klatschte Farben auf Zeichenpapier. Heute, dachte sie, bin ich nur Mrs. Heimrich, Hausfrau und Unkrautrupfer der Familie.
Oh, jetzt habe ich eine Zinnie ausgerissen! Sie grub die kleine Wurzel wieder ein, aber ohne Zuversicht. Umpflanzen soll man die erst, wenn sie vier Blätter haben, und diese hatte nur zwei, das arme Pflänzchen. Viel zu jung noch...
Der große Hund, der das Suchen nach Blumen für unter seiner Würde gehalten hatte, bellte laut. Nur einmal, ein Zeichen, dass irgendetwas geschah, und dann noch ein paarmal, was bei ihm Missfallen an dem, was er wahrnahm, bedeutete. Susan erhob sich. Der Blumengarten lag hinter dem Hause, das, in seiner Form noch die niedrige Scheune verratend, die es einst gewesen war, auf einer Anhöhe stand, von der man zum Hudson hinabblicken konnte. Als Colonel weiterbellte, jetzt so, wie Hunde es tun, wenn sie sich als Wächter fühlen, ging sie ums Haus zur Terrasse. Draußen stand Colonel, mit gesträubtem Rückenhaar, und spähte nach der Einfahrt, Dann begann er, sich auf steifen Beinen dorthin zu bewegen, laut bellend und dazwischen zornig knurrend.
»Colonel!«, rief Susan hinter ihm her. »Platz, Colonel. Hörst du nicht! Platz!«
Der Hund legte sich nicht hin. Er machte in seinem bedrohlichen Vormarsch ein Stückchen vor dem Mann halt, der zum Hause heraufkam. Der ging sehr langsam, die Steigung ermüdete ihn offenbar. Als er Susan sah, blieb er einen Augenblick stehen, bevor er, ihr und dem ergrimmten Colonel entgegen, weiterschritt.
Er schien sehr alt zu sein. Nicht groß, und ganz mager. Sogar aus der Entfernung, die noch über dreißig Meter betrug, konnte Susan die grauen Bartstoppeln in dem Greisengesicht sehen. Der Fremde trug schwarze Hosen, die an der rechten Seite einen Riss hatten, niedergetretene schwarze Schuhe, wie sie früher zum Frack üblich waren, ein dunkles Hemd und eine Mütze, die in ihrer Kleinheit wie die Karikatur der sogenannten Sportmütze wirkte. Er ging mühsam auf dem Kies der Anfahrt weiter. Colonel bellte, stand aber jetzt still, und der Mann beachtete ihn gar nicht, sondern blickte auf den Weg zu seinen Füßen, als zähle er die Schritte, die vielen, vielen Schritte, die er noch machen musste.
Ein Landstreicher, dachte Susan - in dieser Gegend, wo man fast nie einen sieht. Ein armer alter Mensch, der um Almosen bettelt. Kein Wunder also, dass Colonel gebellt hat, denn Hunde sind ja Snobs. Dieser elende Alte, so müde, aber anscheinend harmlos, war schlecht gekleidet und sah ungewaschen aus. Es war sehr gut möglich, dass Colonel, sogar bei dem Abstand, die Unsauberkeit roch. Und das vor allem war es wohl, was den Hund so empörte: Ein Fremder kam und - ging zu Fuß! Fremde kommen in Autos, nicht zu Fuß, das weiß jeder Hund in den Dörfern.
»Platz, Colonel!«, rief Susan wieder. »Und lass jetzt das Kläffen sein!« Kläffen war kaum die rechte Bezeichnung bei Colonel, einem kolossalen Hund, dessen gewaltiges Bellen man weithin zwischen den Hügeln als Echo hörte.
»Platz!«, rief Susan nochmals, so laut und streng sie es vermochte.
Und genau in diesem Augenblick stürzte, als gehorche er ihrem Befehl, der kleine alte Mann zu Boden. Er fiel ohne jeden Versuch, den Sturz zu vermeiden, und lag reglos auf dem Kiesweg. Ein dunkler Klumpen, am hellen, sonnigen Vormittag.
Susan lief zu ihm, zuerst über den Rasen, dann ein Stück auf der Zufahrt, wobei der Kies unter ihren eilenden Füßen knirschte. Als sie dem Alten näher kam und mehr erkennen konnte, hielt sie einen Moment inne und hob unwillkürlich die Hand vor den Mund. Dann trat sie dicht an den Fremden heran, der da im Sonnenschein auf dem weißen Kies blutete, und kniete neben ihm nieder. Sehr schlimm, das viele Blut. Dunkel kam es aus seinem offenen Mund. Die Augen waren weit geöffnet.
Zuerst schien es ihr, als seien sie schon blicklos, aber nein, ihr Ausdruck hatte sich doch soeben verändert? Sie beugte sich tiefer über den Greis. Und da versuchte er, etwas zu sagen - es klang unklar, war eher ein Gurgeln als Sprechen. Die Mütze war ihm beim Fallen vom Kopf gerutscht, sein langes graues Haar war schmutzig. Wieder mühte er sich um Worte, doch was er hervorbrachte, war wieder kaum hörbar.
Ein Wort fing sie auf, oder den Teil eines Wortes, das wie ell klang. Ein Name? Susan konnte nur raten. Vielleicht war es nur ein Fluch gewesen, ein hoffnungsloses zum Teufel? Sie wiederholte, dass sie nichts verstehen könne, und wollte schon sagen, ich hole Hilfe, da versuchte er es noch einmal. Und jetzt schien das einzige Wort, das er formte, wie well zu klingen. Ein well, das vielerlei bedeuten konnte. Es mochte heißen: Unglaublich, weil er nicht wusste, wie ihm geschah. Oder: Na, nicht zu ändern, weil er sich in sein Schicksal ergab. Seine blassblauen Augen schienen zu fordern, dass sie ihn verstehe, und gleichzeitig verzweifelnd darum zu bitten. Als er jetzt abermals zu sprechen versuchte, quoll das Blut dicker aus seinem Munde, so dass kein Wort mehr durch die Lippen dringen konnte. Seine Augen blickten leer, ohne Ausdruck.
Susan wusste, dass er tot war. Das kann ein Unerfahrener nicht immer gleich wissen, aber sie wusste es. Susan Heimrich erhob sich und blickte auf den Toten hinab. Da sah sie zum ersten Mal, dass das Blut, in dem er lag, nicht seinem Munde entströmt war. Eine Seite seines dunklen Hemdes war ganz durchtränkt. Verblutet war der schwache alte Mann, doch nicht so wie sie gedacht hatte. Er hatte schon eine Verletzung gehabt, eine tödliche Verletzung!
Helfen konnte sie ihm nun nicht mehr. Sie wandte sich von der Leiche ab und lief zum Hause zurück. Der große Hund stand noch starr, mit gesträubtem Fell, auf dem Wege. »Komm, Colonel«, sagte sie und merkte, dass ihre Stimme jetzt schrill klang. Colonel kam, sie hielt die Tür für ihn auf und ging mit ihm in die Wohnung, wo er zu wimmern begann.
Rasch drehte sie die Wählscheibe des Telefons, aber es kam ihr lange vor, bis sie die erwartete Antwort hörte: »Staatspolizei, Sergeant Blake.«
»Neil«, sagte sie, »hier Susan Heimrich. Ich...«
»Nanu sagte Neil Blake, da sie plötzlich schwieg. »Hallo, Mrs. Heimrich!«
»Es ist was passiert«, begann sie wieder. »Ist der Captain da? Ich habe einen
»Moment«, sagte Sergeant Neil Blake, und es ging auch sehr schnell. Eine vertraute Bassstimme sagte »Heimrich«, und schon, als sie »Su gesagt hatte, die erste Silbe ihres Vornamens, fragte er, schnell, besorgt: »Was gibt’s denn, Schatz?« Und dann hörte er zu. Stellte nur eine einzige Frage: »Bist du sicher, dass er tot ist?«
Ja, sie war ganz sicher.
»Viertelstunde«, sagte er. »Du solltest aber doch lieber...«
»Ich weiß«, erwiderte sie, und wieder fand sie die eigene Stimme so sonderbar fremd. »Es ist nur - wirst du auch...?«
»Wir beeilen uns«, versicherte Captain Merton Heimrich, von der Kriminalabteilung der Staatspolizei in Hawthorne, seiner Frau. Susan tat, was er ihr gar nicht hätte zu sagen brauchen: Sie verließ die Wohnung, schloss den noch wimmernden Hund ein und zwang sich, den Weg bis zu dem Toten wieder hinunterzugeben. Er lag unverändert da. Sie ging wieder zur Terrasse und setzte sich dort hin. Wenn ein Mensch durch Gewalt zu Tode kommt, soll nichts verändert werden, soll er nicht vom Platz bewegt, nicht angefasst und auch sonst nichts getan werden, was den Eindruck des Tatbildes verwischen könnte. Es kam ihr lange vor, bis sie, noch in der Ferne, ei ne Polizeisirene hörte.
In einem Funkstreifenwagen fuhren zwei Polizeiwachtmeister vor. Sie kannte beide nicht, doch der eine kannte sie und sagte, eigentlich sinnlos: »Tut mir leid, die Sache da, Mrs. Heimrich.« Darauf gab es keine direkte Antwort. Ebenso sinnlos sagte sie: »Ich weiß.«
Dann kam im zweiten Wagen, einer neutralen Limousine, Heimrich selbst mit Sergeant Charles Forniss. Sie stiegen jeder an einer Seite aus. Beide waren groß, breit und kräftig. Der, der rasch über den Rasen ging, hatte auffallend blaue Augen. Er streckte Susan beide Hände entgegen. »Hast du’s gut überstanden?«, fragte er, indem er sie besorgt ansah.
»Aber ja«, antwortete sie, und es war wieder ihre richtige Stimme, klang sogar beinah forsch.
Merton Heimrich lächelte ein wenig. »Na schön«, sagte er, »will dich ja nicht bemuttern«, legte ihr aber doch für ein Weilchen einen Arm um die Schultern und drückte sie an sich. So viel, dachte er, darf sich ja wohl ein Polizeibeamter auch im Dienst erlauben.
Sergeant Forniss hockte neben dem Toten und betrachtete ihn genau, ohne ihn zu berühren. Als Forniss aufstand und zur Terrasse kam, zog Heimrich den Arm von der Schulter seiner Frau zurück. Susan hätte, trotz des Ernstes der Situation, über seinen schüchternen Liebesbeweis beinahe gelacht.
»Morgen, Mrs. Heimrich«, sagte Forniss, und zu seinem Captain: »Jawohl. Ist tot. Anscheinend erschossen.«
»Da, wo er umfiel also«, gab Heimrich zurück.
»Jawohl. Vermutlich genau auf dem Fleck.«
Susan schaute zu ihrem Mann empor. »Weil er«, sagte Heimrich, »wie du durchgabst, den Weg heraufkam, vielleicht dreißig Meter, vom Eingang gerechnet - stark blutend, und weil auf der Strecke keine Blutspur zu sehen ist. Einen Schuss hast du nicht gehört?«
»Nein«, erwiderte sie. »Das heißt: Ich entsinne mich nicht, einen gehört zu haben. Der Hund machte solchen Spektakel. Ich...«
Sie wurde unterbrochen. Es kam noch eine Limousine, der mehrere Männer in Zivil entstiegen. Einer mit einer Kamera und zwei mit Kästen, den Geräten des Spurensicherungsdienstes. Der Fotograf begann sofort Aufnahmen zu machen. Ein weiterer Wagen brauste heran, er brachte den Arzt, der mit seiner schwarzen Tasche gleich zu dem Toten ging, sich neben ihn hockte und ein Stethoskop ansetzte. Er erhob sich rasch wieder, schaute sich um und ging, als er die Gruppe sah, zur Terrasse,
»Tot - gar keine Frage«, sagte er zu Heimrich. »Schusswunde. Geschoss hat wahrscheinlich die Aorta gestreift...«
»Aus größerer Entfernung?«
»Aber Captain, wie soll ich das jetzt schon wissen! Wenn die Schusswaffe eine Pistole war: nein. War’s ein Gewehr, dann kommt es doch sehr auf Kaliber und Reichweite an, nicht wahr? Werden’s wissen, wenn wir ihn sezieren.«
Der Mann mit der Kamera machte wettere Aufnahmen. Ein Beamter nahm Abdrücke von den toten Fingern. Ein dritter Beamter, mit Zeichenblock, machte eine Skizze vom Tatort.
Hinter dem Wagen des Arztes kam eine Ambulanz. Zwei Männer in weißen Lazarettmänteln stiegen aus. Der Arzt ging zu ihnen und sagte: »Tot vorgefunden. Schusswunde, dem Augenschein nach.«
Heimrich und Sergeant Forniss gingen zu der den Toten umstehenden Gruppe. Diesmal setzte Heimrich sich auf die Hacken und betrachtete ihn eine Weile. Als er aufstand, sagte er: »In Ordnung, Doktor, Sie können ihn haben«, und ging wieder zur Terrasse.
Einer der Wachtmeister sagte: »Captain...« Heimrich blieb stehen, und der Beamte erklärte ihm etwas, was Susan nicht mithören konnte. Heimrich machte kehrt und betrachtete, jetzt stehend, abermals den Toten. Dann winkte er Forniss mit kurzer Kopfbewegung zu, und sie gingen zusammen auf die Terrasse.
Männer in Weiß legten den Toten auf eine Bahre und schoben sie in den Sanitätswagen, der rückwärts im Leerlauf zur Landstraße hinausrollte. Nach einem Weilchen hörten sie den Motor starten.
Es war schnell gegangen, nach Susans Empfinden eigentlich oberflächlich. Das zu denken fand sie unvernünftig und blieb trotzdem dabei. Sie hatten einen Toten gefunden, hatten ihn fotografiert, Fingerabdrücke von ihm genommen und ihn fortgeschafft. Fehlte da nicht etwas? Sie konnte sich nicht denken, was, aber etwas hätte doch da noch geschehen müssen? Sie merkte, dass ihr Mann sie ansah, nicht mit dem harten Blick wie beim Dienst. »Ganz wie üblich, Susan«, sagte er, als hätte er ihren Gedanken erraten.
»Nur...«, begann sie.
»Wenn du siehst, wie’s passiert - eben noch lebendig, auf einmal tot wirkt’s natürlich anders.«
Ich muss auf meine Gedanken achten, er hört sie gewissermaßen, sagte sich Susan. »Ganz anders«, bestätigte sie. »Wer war er denn, was meinst du? Und weshalb kam er hierher?«
»Wachtmeister Ackerman meint, es sei ein Mann namens Tom. Mehr weiß er nicht, jedenfalls nicht viel. Wohnte in einer Hütte im Wald, hier in der Umgegend. Machte Gelegenheitsarbeiten. Ackerman glaubt sich an ein Grundstück zu erinnern, wo er ihn mal arbeiten sah. Wir werden’s ja feststellen. Und nun - willst du’s mir noch mal schildern, ja?«
»Colonel bellte«, sagte sie. »Du weißt ja, wie. Er war mit Michael zur Straße gegangen und zurückgekommen, ganz wie sonst, und hatte sich hingelegt. Mit einer Miene, als ob er sterben möchte. Weißt ja, wie er ist. Ich war beim Unkrautjäten, da fing er an zu bellen, und Sie unterbrach sich und blickte nach der Auffahrt. »Wenn Michael heimkommt sagte sie. »Die - die Stelle dort. Das dürfte er eigentlich nicht sehen...«
»Ich weiß«, sagte Heimrich. »Wir werden da vorher noch was tun. Also Colonel bellte...«
Sie berichtete ihm alles noch einmal, langsamer und viel genauer, als sie es am Telefon getan hatte. Dass sie den Alten für einen Landstreicher gehalten habe, der betteln wollte. Dass sie nachher mit Sicherheit gewusst habe, dass er tot war, und nur daran gedacht habe, ihn - ihren Mann - gleich anzurufen. Den Hund hatte sie in der Wohnung eingeschlossen. »Der war ganz verschreckt.«
»Blut macht denen Angst«, sagte Heimrich. »Bringt sie auch in Wut, manchmal. Einen Schuss hast du nicht gehört?«
Sie schüttelte den Kopf.
Colonel hatte den Mann angebellt, sehr laut, sonst aber sei nichts zu hören gewesen. »Mag sein, dass ich einen gehört habe«, sagte Susan. »Müsste ich ja beinah, nicht wahr? Wie weit entfernt kann das denn gewesen sein?«
»Ein ganzes Stück«, antwortete Heimrich. »Wenn's ein Gewehrschuss war. Wissen wir erst, wenn wir das Geschoss haben. Falls sie das finden, und das werden sie wohl. Aber außer Hörweite war’s nicht.«
»Man hört ja auch mal etwas, ohne dass es einem bewusst wird«, sagte Susan. »Auf dem Lande wird doch ziemlich viel geschossen. Und seitdem Ollie Perrin das zu seinem Hobby gemacht hat...« Sie zuckte mit ihren schlanken, etwas eckigen Schultern in dem lächerlich weiten Hemd von ihrem Mann. »Könntest es freiwillige Taubheit nennen«, ergänzte sie.
»Hat er denn heute Morgen geschossen?«
»Ich glaube nicht. Kann aber sein. Und ich mag es gehört und gedacht haben: Der Ollie ist wieder im Gange - gehört haben, ohne dass es in mein Bewusstsein drang. Könnte sein, ja.«
Sergeant Forniss räusperte sich leise, als ob er sich vergessen fühlte.
»Unsere Nachbarn meint sie«, sagte Heimrich zu ihm. »Die Perrins. Oliver Perrin und Frau. Das Haus können Sie von hier aus nicht sehen. Ist ziemlich groß, sozusagen ein...« Er sah Susan fragend an.
»Ein unbetont modernes«, sagte sie. »Was man manchmal zeitgemäß nennt. Wenn die Bäume belaubt sind, wie jetzt, sieht man’s von hier nicht.«
»Ungefähr vierhundert Meter entfernt. Nach dorthin.« Heimrich deutete ostwärts, in die vom Fluss abgewandte Richtung. »Auf derselben Anhöhe wie unseres. Seit ein paar Wochen hat Perrin mit Scheibenschießen angefangen. Hat einen Graben mit Kugelfang, alles vorschriftsmäßig, Charlie. Und...«
»Und«, sagte Charles Forniss, »entschieden zu weit weg, vierhundert Meter. Nur...«
»Also, Charlie«, sagte Heimrich, »sieh’s dir mal richtig an.« Er wiederholte seine Geste, östlich von seinem Haus - das mal eine Scheune gewesen war und noch danach aussah - lag ein Stück Wiese, ohne Baum und Strauch, etwa sechzig Meter breit, begrenzt durch eine Mauer. Hinter der Mauer war das ansteigende Terrain bewaldet.
»Wenn einer den Zufahrtsweg raufkommt«, begann Heimrich leise, und Forniss nickte und sagte: »Sicher!«
»Flüstern ist unhöflich«, sagte Susan. »Und reden in Geheimsprache auch.«
»Als der Alte unseren Zufahrtsweg raufkam, ging er also in nördlicher Richtung. Der Schuss hat ihn links getroffen. Falls jemand mit einer Pistole - oder einem Revolver - von Perrins Haus gekommen ist, hätte er eine weite Schussbahn gehabt - mit Pistole oder Revolver - von jenseits der Mauer. Und wäre er über die Mauer geklettert, dann hättest du ihn gesehen, Susan. Es sei denn...«
»Nein«, sagte Susan, »der alte Mann hat sich nicht umgedreht. Er kam geradenwegs auf mich zu, als er stürzte. Langsam, schwerfällig, aber doch so, als wüsste er genau, wohin er wollte. Ja, ganz entschlossen und zielbewusst eigentlich. Ich dachte ja, er wollte betteln, aber...«
»Ja«, unterbrach ihr Mann sie, »vielleicht ist er auch gekommen, um mit einem Polizisten zu reden. Und gesagt hat er nichts weiter als ell oder hell oder so ähnlich, ja? Oder well. In was für einem Ton? Beleidigt? Ärgerlich, oder wie?«
»Ich weiß nicht recht«, antwortete Susan. »Es klang jedenfalls ganz anders, als ich das von einem Mann, den soeben ein tödlicher Schuss getroffen hat, erwartet hätte. Da kommt ja gerade Ollie Perrin.«
Die Augen der Männer folgten ihrem Blick, nach der Richtung, in die Heimrich soeben gezeigt hatte. Ein großer Mann in Polohemd und kurzen Hosen stand auf der Mauer. Jetzt sprang er leichtfüßig herab und kam über die Wiese auf die Gruppe zu: »Hallo, Nachbarn, was gibt’s denn hier für ’n Radau?«, fragte er.
Zweites Kapitel
Oliver Perrin war tief gebräunt und trug sein schwarzes Haar militärisch kurz. Sehr nobel und distinguiert, hatte Susan gedacht, als sie die Perrins kennenlernten, und hatte bisher ihre Meinung nicht zu ändern brauchen. Sein erstes, schon von der Mauer her gerufenes Hallo hatte ganz vergnügt geklungen, und lächelnd war er über die Wiese gekommen. Als er sich der Gruppe näherte, wurde er beim Anblick der ernsten Gesichter auch ernst. »Etwas passiert?«, fragte er.
»Ein Mann wurde getötet«, sagte Captain Heimrich, mit einer Kopfbewegung zur Auffahrt. »Dort.«
Perrin richtete den Blick auf die dunkle Stelle im weißen Kies, dann sah er den Captain fragend an.
»Erschossen«, sagte Heimrich. »Haben Sie einen Schuss gehört, so etwa um Er machte eine kleine Pause. »Innerhalb der letzten Stunde?«
Perrin schüttelte den Kopf. »Wer ist es denn?«, fragte er.
»Soweit wir bis jetzt wissen, wahrscheinlich ein gewisser Tom, Familienname noch unbekannt«, antwortete Heimrich. »Älterer Mann. Soll hier irgendwo in einer Hütte gewohnt haben und
»Der alte Tom?«, sagte Perrin, und es klang sehr ungläubig. »Weshalb sollte den wohl jemand umbringen wollen?«
Das wusste Heimrich nicht. »Sie kannten also den alten Tom?«
»Ja, Merkwürdiger Kauz«, erwiderte Perrin. »Ein Verrückter eigentlich, aber harmlos. Hat der sich denn bei Ihnen noch nie gezeigt?«
»Nein, Ollie«, sagte Susan, und Perrin fand das sonderbar, weil er geglaubt hatte, Tom müsse bei allen Hausbesitzern im Ort bekannt gewesen sein.
Sie warteten auf weitere Einzelheiten.
»Kam man morgens aus dem Hause, dann war er plötzlich da«, berichtete Perrin. »War ohne Aufforderung erschienen und machte sich nützlich. Harkte vielleicht die Wege oder entfernte Unkraut aus den Blumenbeeten. Oft waren es Arbeiten, die man sich selbst schon vorgenommen, aber noch nicht ausgeführt hatte. Rief man ihm guten Tag zu, dann gab er keine Antwort, sondern arbeitete still weiter.«
»Sie meinen, er kam von allein und begann mit irgendeiner Arbeit, ohne vorher zu fragen?«, sagte Susan.
»Ja«, antwortete Perrin. »Und immer- fing er mit etwas an, was sowieso getan, werden musste oder jedenfalls nützlich war. Arbeitete eine Stunde, vielleicht auch mal drei Stunden, dann meldete er sich und sagte: Alles für heute, und man bezahlte ihn. Was es Ihnen wert ist, sagte er, steckte in die Tasche, was er bekam, und ging still weg. Ich dachte, er sei schon überall gewesen. War er wirklich noch nicht bei Ihnen?«
»Nein, das weiß ich genau«, sagte Susan, und Perrin wiederholte: »Sonderbar.« Dann schnipste er mit den Fingern. »Ach so, der Hund«, sagte er. »Vor dem hatte er sicher Angst.«
»Weiß nicht«, sagte Susan. »Colonel hat ihn angebellt, doch das kümmerte ihn gar nicht.«
Perrin zuckte mit den Schultern. Sei ihm nur so eingefallen. Wäre ja denkbar, nicht wahr? »Dann muss Ihr Grundstück wohl das einzige gewesen sein, wo er nicht - nicht aufgeräumt hat. Das einzige auf Meilen im Umkreis. Zu uns kam er immer, wenn’s ihm gerade einfiel, zuerst schon, als wir eben eingezogen waren. Und gehört hatten Sie von ihm auch noch nicht?«
Nein, das hatten sie nicht - bis er vor ihrem Hause starb. Auch Susan wusste nichts von ihm, und sie wohnte schon lange hier, hatte schon als Susan Faye in diesem Hause gewohnt, Jahre bevor sie es als Susan Heimrich bewohnte. Hatte dort vorher allein gewohnt mit ihrem heranwachsenden Jungen und dem alternden Hund, und mit den Erinnerungen, aus denen langsam der Schmerz wich, so dass sie sie schon still in sich verschließen konnte - Erinnerungen an einen Michael, der im Krieg gefallen war.
»Nein«, wiederholte sie und sah ihren Mann an, der den Kopf schüttelte.
»Sie wissen, wo er gewohnt hat?«, fragte Forniss, doch nun schüttelte Perrin den Kopf. »Irgendwo hier im Umkreis, in einem einsamen Gebiet, wo sonst kein Mensch hingeht. Nicht mal die Besitzer des Grundstücks«, erklärte er. »Hier gewöhnt man sich sowieso schwer ein, wenn man sonst in der Stadt gelebt hat. Das ist nun mal so.«
Jedenfalls war anzunehmen, dass der alte Tom, wenn er sich auf einem Grundstück, das ihm nicht gehörte, häuslich niederließ, dazu zumindest die stillschweigende Erlaubnis des Besitzers gehabt hatte. Forniss merkte sich diesen Punkt vor.
»Der Schuss«, sagte Heimrich. »Vermutlich aus einem Gewehr. Sie haben ihn wohl nicht gehört?«
Perrin schüttelte den Kopf.
»Waren selbst auf Ihrem Schießstand, beim Üben?«, fragte Heimrich.
Perrin schüttelte wieder den Kopf, diesmal lachend. »War unten in meiner Dunkelkammer«, sagte er.
Heimrich nickte. Er kannte die Dunkelkammer im Keiler vor, Haus Perrin. War mit seiner Frau schon öfter bei den Perrins gewesen, wenn sie eine größere Party gaben. Während Heimrichs selbst sich größere Gesellschaften kaum leisteten. Oliver Perrin und seine Frau fanden ihr Haus sehr schön und zeigten es gern Gästen.
»Als Strohwitwer beschäftigt man sich ja mit allem möglichen Kleinkram«, sagte Perrin. »Die Zeit wird einem lang.«
»Haben Sie von Marian schon Nachricht?«, fragte Susan, der wieder einfiel, dass Mrs. Perrin verreist war.
»Sitzt gesund und munter in London«, antwortete er. »Amüsiert sich großartig. Meint, ich müsste auch gleich dabei sein. Möchte ich selbst gern. Bekam gestern ein Telegramm.« Er seufzte. »Dauert aber vielleicht noch ’ne Woche, bis ich im Büro alles so weit geordnet habe. Um auf den Schuss zurückzukommen: Ich habe keinen gehört. Nein. Die Dunkelkammer ist ja beinah schalldicht. Meistens höre ich nicht mal, wenn das Telefon oben klingelt.«
»Aber die Sirenen haben Sie gehört«, sagte Heimrich.
Da sei er gerade heraufgekommen, um frische Luft zu schnappen, erklärte Oliver Perrin. Und Sirenen, das sei ja eine ganz andere Sache. Aber Schüsse, auf dem Lande - nun, man könne sagen, die gingen zu einem Ohr rein und zum andern raus, ohne dass man darüber nachdächte. Polizeisirenen allerdings - vor allem, wenn die Wagen beim Nachbarn anhielten - fielen einem natürlich auf. »Also spähte ich mal über die Mauer, sozusagen. Mit der Neugier, die den Katzen manchmal verhängnisvoll wird. Hat denn sonst niemand den Schuss gehört?«
»Also, Mr. Perrin«, sagte Heimrich, »das weiß ich nicht, ob sonst jemand. Susan hat ihn nicht gehört. Ich selbst war nicht hier. Dem Anschein nach müsste er aus Ihrer Richtung gefallen sein.«
Perrin zog die Brauen hoch, wodurch sein Gesicht einen unschuldigen, fast kindlich naiven Ausdruck bekam.
»Nach der Richtung, in der der Alte ging, zu urteilen. Und wie und wo der Schuss ihn traf«, ergänzte Heimrich.
»Na ja, Deckung gibt’s dort ja reichlich. Sie meinen, dass sich jemand mit einer Flinte auf unserem Grundstück herumtrieb? Und einfach drauflos ballerte?«
So hätte es sein können.
»Ganz gut, dass ich nicht beim Schießen war«, sagte Perrin. »So wild bin ich darauf gar nicht, und ich habe ja auch den Schutzgraben, aber...« Er hielt inne. »Aber trotzdem bin ich froh, dass ich nicht am Knallen war«, schloss er.
»Ihr Schießstand liegt zweihundert Meter von dort«, sagte Heimrich und deutete wieder auf die dunkle Stelle im Kies.
»Ja...«
»Das Geschoss, egal aus welcher Waffe, traf mit voller Wucht. Hatte noch Durchschlagskraft.«
»Für die Akten«, sagte Perrin: »Ich besitze gar kein Gewehr.«
Die Bemerkung war nicht wichtig gemeint, aber Heimrich sagte ernst: »Nehme es zur Kenntnis.« Und Perrin blickte, etwas hastig, auf seine Uhr und sagte, er hätte beinah vergessen, dass er einen telefonischen Anruf erwartete.
»Tut mir leid, dass ich nicht behilflich sein kann«, sagte er. »Habe leider den Schuss nicht gehört. Auch nicht den Kerl gesehen, der ihn abgefeuert hat.« Er blickte wieder zur Auffahrt hinüber. »Wer hat bloß den armen Tom umbringen wollen?«, sagte er noch einmal. »Verstehe ich nicht. Harmloser alter Knabe. Gegen den kann doch keiner etwas gehabt haben?«
Das waren natürlich rhetorische Fragen. Heimrich zuckte mit den Schultern. Sie beobachteten Perrin, wie er flott über die Wiese ging, leicht die Mauer übersprang und im Gehölz dahinter verschwand.
»Da hat er eigentlich recht«, meinte Forniss. »Man sollte nicht annehmen, dass es sich lohnte, den alten Kauz zu ermorden. Glauben Sie, dass der Schuss einem anderen zugedacht war?«
Auch das war nur eine rhetorische Frage.
»Heute ist Freitag«, sagte Forniss. »Dieses Büro, wo Perrin erst noch alles ordnen wollte - hat er das in seiner Villa?«
»Sie sind ja sehr misstrauisch, Sergeant«, sagte Susan. »Nein, sein Büro ist in New York. Eine Maklerfirma, und er ist dort - was ist er eigentlich, Merton?«
»Kundenberater«, antwortete ihr Mann. »Arbeitet sich dabei vermutlich nicht zu Tode. Seine Frau hat ein ganz schönes Vermögen. Und - sie amüsiert sich in London prächtig. Möchte mal wissen, weshalb der alte Tom nie zu uns kam, um sich nützlich zu machen, wie auf den anderen Grundstücken.«
»Vielleicht hatte Ollie ja recht«, sagte Susan. »Dass er’s wegen Colonel nicht wagte.«
»Aber er kam doch heute, ohne sich um den Hund zu kümmern, wie du selbst sagst«, gab Heimrich zurück. »Weil er wusste, dass hier ein Polizeibeamter wohnt?«
»Ja, heute kam er ohne Bedenken.«
»Hat sich sonst eben von der Polizei ferngehalten«, fuhr Heimrich fort. »Ganz begreifliche Vorsicht. Geht nur im Notfall zur Polizei, Leute! Wahrscheinlich hat er oft auch unbefugt Grundstücke betreten. Vielleicht hat er, wenn die Herrschaften zu Hause waren, gearbeitet, und wenn sie fort waren, ein bisschen gemaust. Kleinigkeiten, über die sich kein Mensch aufregte. Mal ein bisschen Gemüse aus dem Garten zum Beispiel, oder ein paar Eier aus dem Hühnerstall. Und dann war’s ja dumm gewesen, sich bei der Polizei unnötig bekannt zu machen.«
»Möglich ist das«, gab Susan zu.
»Bis er sie dann brauchte«, betonte Heimrich. »Aber aus welchem Grunde?«
Ich bin ein Resonanzboden oder ein Brett, von dem Bälle zurückprallen, dachte Susan. Dieser verflixte Merton! Errät ständig meine Gedanken. »Weiß ich nicht, Captain«, sagte sie, mit dem Rang, den sie im Gespräch nur gelegentlich nannte.-
»Friedlicher alter Sonderling«, sagte Heimrich. »Keine Mordtat wert. Aber infolge einer Verwechslung, hm?«
»Wüsste keinen hier, dem er ähnlich sah«, entgegnete Susan. »Können wir das dort - nicht von jemand wegschaffen lassen? Oder noch Kies aufschütten, damit man’s nicht sieht? Ehe Michael von der Schule zurückkommt.«
»Ähnlich sah er also keinem, findest du. Jedenfalls keinem hier im Ort oder in der Umgegend. - Ja, ich lasse das wegmachen. Schicke gleich einen her.«
Sie nahmen, als sie fortgingen, eine Probe von dem blutbefleckten Kies mit. Natürlich war nicht zu bezweifeln, von wem das Blut stammte, doch vor Gericht werden Tatsachen oft bezweifelt. Begründete wie auch vorgetäuschte.
Schon lange, bevor der Schulbus draußen anhielt und Colonel, der eine Viertelstunde mit immerhin merklich gespitzten Ohren gewartet hatte, hinrannte, hatten zwei Männer einen ganzen Kubikmeter Kies gebracht und über die bewusste Stelle verteilt. Niemand hätte sehen können, was da passiert war.
Vorne am Hause hing ein Schild Zu verkaufen. Es hing schief an einer Stange, und niemand machte sich die Mühe, es geradezurücken. Das gab einen gewissen Anhaltspunkt. Falls hier einer nötig war. Als Wachtmeister Ackerman hörte, um welches Grundstück es sich handelte, brauchte er Heimrich und Sergeant Forniss über das Verkaufsschild nicht zu informieren. Das alte Grundstück der Walthams, das kannte ja hier jeder. War seit Jahren schon unbewohnt.