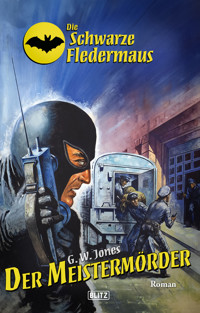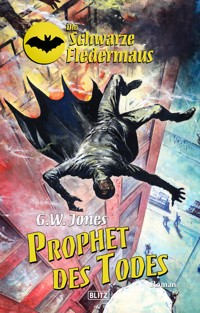Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die schwarze Fledermaus (Kult-Kriminalromane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Aus dem Amerikanischen von Harald GehlenEine Bank wird überfallen, doch Dieb und Beute scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben. Ein Juwelier wird ausgeraubt, aber weit und breit ist kein Täter zu entdecken. Ein wertvolles Diadem löst sich in einem voll besetzten Auktionshaus in Nichts auf.Captain McGrath zweifelt an seinem Verstand und hofft gegen seine innere Überzeugung auf die Hilfe der Schwarzen Fledermaus.Die Printausgabe umfasst 204 Buchseiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE SCHWARZE FLEDERMAUSBand 16
In dieser Reihe bisher erschienen:
6001 – Der Anschlag von G. W. Jones
6002 – Der Sarg von G. W. Jones
6003 – Angriff der Schwarzen Fledermaus von G. W. Jones
6004 – Ein harmloser Fall von Angelika Schröder
6005 – Tote schweigen nicht von Margret Schwekendiek
6006 – Liga der Verdammten von G. W. Jones
6007 – Die Spione von G. W. Jones
6008 – Der Kreuzzug von G. W. Jones
6009 – Der Flammenpfad von G. W. Jones
6010 – Der Sieg der Schwarzen Fledermaus von G. W. Jones
6011 – Das Trojanische Pferd von G. W. Jones
6012 – Die Spur des Drachen von G. W. Jones
6013 – Das Gesetz der Schwarzen Fledermaus von G. W. Jones
6014 – Das nasse Grab von G. W. Jones
6015 – Stadt in Angst von G. W. Jones
6016 – Der unsichtbare Tod von G. W. Jones
6017 – Die Stimme der Gerechtigkeit von G. W. Jones
6018 – Die Augen des Blinden von G. W. Jones
Die Hauptfiguren des Romans:
Die Schwarze Fledermaus
Carol Baldwin
Silk Kirby
Butch O'Leary
Inspector McGrath
G. W. Jones
Der unsichtbare Tod
Aus dem Amerikanischen von Harald Gehlen
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2018 BLITZ-VerlagRedaktion: Harald GehlenFachberatung: Dr. Nicolaus MathiesIllustrationen: Dorothea MathiesTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-016-1Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
G. Wayman Jones – hinter diesem Pseudonym verbirgt sich meistens der amerikanische Autor Norman A. Daniels, so auch beim vorliegenden Roman.
Daniels wurde am 3. Juni 1905 in Connecticut geboren, brach sein Studium aus finanziellen Gründen ab und begann 1931 eine beispiellos produktive Karriere als Autor. Allein in den folgenden drei Jahrzehnten veröffentlichte er über 2.000 Geschichten: Comics, Bücher, Radiohörspiele, aber vor allen Kriminal- und Superheldenromane. Für den Chicagoer Verlag Thrilling Publications erschuf er die Figur der Schwarzen Fledermaus und verfasste einen Großteil ihrer 62 Abenteuer, die zwischen 1939 und 1952 in den USA erschienen. Daniels starb am 19. Juli 1995 im Alter von 90 Jahren in Kalifornien.
Das Abenteuer Der unsichtbare Tod erschien im September 1941 unter dem Titel The Black Bat‘s Invisible Enemy in dem amerikanischen Magazin Black Book Detective.
Kapitel 1 – Ein unsichtbarer Mörder
Die Wertpapier- und Treuhandbank öffnete um 9.30 Uhr, mit der gleichen exakten Pünktlichkeit wie seit über siebzig Jahren. Einer der ersten vor Ort, bevor der Arbeitstag offiziell begann und die schweren Kupfertüren für die Kunden geöffnet wurden, war Roy Banton. Er arbeitete hier schon lange als Kassierer und Angestellter; die Jahre wollte er am liebsten gar nicht zählen. Aber er war noch kein alter Mann, in keinerlei Hinsicht. Seine Schritte waren noch immer leicht und er konnte 10.000 Dollar in großen Scheinen genauso schnell durch seine Finger blättern lassen wie jeder seiner jüngeren Kollegen.
Die Bank war ein imposanter Ort. Sobald die Kupfertüren geöffnet waren, würden die Kunden durch die inneren Glastüren das Gebäude betreten. Im Innenraum stießen sie dann auf einen Halbkreis von Kassen- und Kundendienstschaltern. Die Sachbearbeiter waren im hinteren Teil des Gebäudes untergebracht. Um zu ihnen zu gelangen, musste man zuerst einem bewaffneten Wachmann den Grund des Besuches erklären.
Der große Raum besaß eine gewölbte Decke und war gut beleuchtet. In der Mitte der nördlichen Wand befand sich der glänzende Safe mit seinen massiven Scharnieren, seinen Zahlenschlössern und mit der verzierten und verchromten Klinke, die an das Steuerrad eines Schiffes erinnerte.
Roy Banton warf einen Blick auf die Uhr, während er sich seines Mantels und seiner Weste entledigte. Er schlüpfte in ein graues Jackett aus einem leichten Stoff, als er zum Safe eilte. Das Zeitschloss würde sich in zwanzig Sekunden öffnen. Dann würde der Kassenassistent seinen Teil zur Öffnung des Mechanismus beitragen. Der alte Gaube würde aus seinem Buchhaltungsbüro gewackelt kommen, um ein weiteres Zahlenschloss zu bedienen und Roy Banton würde sich schließlich um das letzte Schloss kümmern.
Nur im Zusammenspiel des Zeitschlosses und dem gemeinsamen Bemühen der drei Männer ließ sich der Tresorraum öffnen. Sogar der Präsident der Bank könnte dies nicht alleine machen.
Nun schwangen die tonnenschweren Türen auf, so leicht wie die Terrassentür eines kleinen Bungalows. So einer wie das Haus, in dem Roy Banton mit seinem Vater lebte. Der Tresor war eine beeindruckende Konstruktion. Kein Dieb und keine Gaunerbande könnte ihn mit Sprengstoff, Bohrern, Brechstangen und aller Zeit der Welt öffnen. Die Erbauer hatten diesen Tresor als einbruchssicher eingestuft und das war er auch.
Roy Banton betrat den Tresor und verteilte Geldscheine und Silber an die anderen Kassierer. In fünf Minuten würde die Bank öffnen.
Banton befand sich immer noch im Safe, als die ersten Kunden die Bank betraten. Um 9.30 Uhr befanden sich bereits elf Kunden im Kassenraum.
Genau in diesem Moment hörte man Roy Banton aus der Tiefe des Tresors laut aufschreien. Er stolperte aus dem Tresorraum heraus, sein Gesicht weiß wie Alabaster. Er wedelte mit den Armen und brabbelte etwas, das niemand verstehen konnte. Schließlich kehrte seine Stimme zurück.
„Die Lohntüten der Albee-Baugesellschaft. Sie sind weg! Sie sind weg! Sie sind mir einfach aus der Hand geklaut worden. 200.000 Dollar in Scheinen. Einfach aus meiner Hand geklaut!“
Malloy, der Vorgesetzte der Wachleute, rannte zu Banton und gab gleichzeitig Anweisungen, dass man Alarm geben sollte. Er packte Banton und schüttelte ihn heftig.
„Hören Sie mir zu, Roy! Hören Sie mir zu. Niemand hat den Safe verlassen! Befindet der Dieb sich noch im Tresor?“
„Nei-nein! Das Geld – ich hatte es in meinen Händen! Man hat es mir entrissen und ich konnte noch nicht mal den Mann erkennen, der das getan hat. Er war – unsichtbar!“
Draußen erklang eine Alarmglocke. Malloy stürmte in den Tresorraum, eine Waffe in der Faust. Niemand konnte sich dort verstecken und er war erleichtert, den Raum leer vorzufinden. Ein anderer Wachmann, der zuvor damit beschäftigt war, Kugelschreiberminen an den Schreibtischen auszutauschen, zog seine eigene Waffe und eilte zum Haupteingang, um dort seinen Posten zu beziehen.
Er hatte die Tür beinahe erreicht, als er stolperte und hart zu Boden fiel. Ein Stöhnen kam über seine Lippen.
Eine Frau in seiner Nähe schrie und fiel ebenfalls leise zu Boden. Jeder in der Bank – und es waren genug, um die Geschichte später zu bestätigen – sahen, wie eine der Glastüren am Eingang plötzlich nach außen aufschwang und sich dann wieder schloss, als ob jemand, den man nicht sehen konnte, hindurch geeilt war.
Malloy half zuerst der heulenden, hysterischen Frau wieder auf die Füße und stützte sie auf dem Weg zu einer der mit Leder überzogenen Bänke. Dann schnaubte er wütend, als er sich dem älteren Wachmann näherte.
Was für ein Weichei, einfach zu Boden zu gehen. Die ganze Sache war absurd, aber der Zusammenbruch des Wachmanns der verrückteste Teil des Ganzen. Malloy beugte sich zu dem Mann hinab, packte ihn an der Schulter und drehte ihn auf den Rücken. Dann trat er mit einem scharfen Aufschrei zurück. Sein Mund stand offen und sein Atem kam keuchend.
Der Wachmann war nicht in Ohnmacht gefallen – außer man betrachtete den Tod als eine permanente Form von Ohnmacht. Der Wachmann war tot und ein dünnes, graues Messer ragte aus seiner Brust, direkt über dem Herzen.
Die Polizei, Streifenwagen und Mitarbeiter der Sicherheitsfirma der Bank näherten sich in Scharen dem Gebäude. Malloy erholte sich soweit von dem Schock, dass er sich, wie ferngesteuert, zu einem Telefon bewegen konnte. Er ließ sich mit dem Polizeihauptquartier verbinden.
„Hier spricht Malloy, oberster Wachhabender bei der Wertpapier- und Treuhandbank“, sagte er. „Hier kam es gerade zu einem Vorfall. Ich kann es nicht erklären, nur dass einer meiner Männer tot ist. Ja, tot, ermordet. Ein Kassierer behauptet, dass 200.000 Dollar fehlen. Wer das getan hat? Mann, ich weiß es nicht. Es sieht aus, als hätte ein Geist die Verbrechen begangen. Ja, Sie haben mich richtig verstanden.“
Als Malloy an die Stelle zurückkehrte, wo die Leiche seines Kollegen lag, berührte ihn einer der Kunden am Arm. Malloy wirbelte zu ihm herum.
„Halten Sie mich nicht für verrückt“, berichtete der Mann, „aber ich – nun – ich würde schwören, dass jemand, den ich nicht sehen konnte, an mir vorbeigeflitzt ist, bevor der Wachmann zu Boden gegangen ist. Es fühlte sich an wie ein Windstoß. Wissen Sie, als würde jemand ganz nah an mir vorbeilaufen.“
Malloy hob beide Hände in einer Geste, mit der er seine Umgebung um Ruhe bat.
„Hören Sie bitte, Sie alle“, sagte er bedeutungsschwer, „und damit meine ich die Bankkunden genauso wie die Angestellten. Wir können nicht alle verrückt sein. Es muss eine Erklärung dafür geben. Wenn Sie einfach etwas Geduld haben, werden wir der Sache auf den Grund gehen. Niemand darf das Gebäude verlassen, ist das klar? Fähige Polizeibeamte von der Mordkommission sind schon auf dem Weg.“
Die Frau, die in Ohnmacht gefallen war, riss den Kopf hoch.
„Mo-Mordkommission?“ Sie schluckte. Ihre Augen wanderten zu der Stelle, an der der Wachmann ausgestreckt auf dem Marmorfußboden lag. „Meinen Sie damit ...?“
Dann rutschte sie von der mit Leder überzogenen Bank und kauerte sich so leise zusammen wie ein Kätzchen nach einer ausgiebigen Mahlzeit. Malloy fluchte leise und fragte sich, warum die Beamten so lange brauchten.
Die Eingangstüren waren versperrt und wurden von der Polizei bewacht. Einer Sache war Malloy sich sicher – noch nicht mal ein weiterer Unsichtbarer kam durch diese Tür durch.
Ein Streifenwagen hielt vor der Bank und als erster stieg Captain McGrath aus dem Auto. Er ebnete sich mithilfe seiner Ellbogen einen Weg durch die Menge, nahm die Begrüßungen der Streifenpolizisten, die ihm einen Pfad zur Tür bahnen wollten, zur Kenntnis und stand schließlich im Kassenraum der Bank.
McGrath war ein kräftig gebauter Mann mit einem ordentlich gestutzten Schnauzbart und wachen, kleinen Augen. Sein Gesicht zeugte von Charakter und seine Schultern von Stärke. Er war stadtbekannt und das aus zwei Gründen: wegen seiner Ehrlichkeit und seines Schwurs, die Schwarze Fledermaus irgendwann zur Rechenschaft zu ziehen. Die zweite Eigenschaft war beinahe zur Obsession für McGrath geworden, auch wenn er manchmal gezwungen war, die Schwarze Fledermaus für ihre Arbeit und ihre Methoden zu bewundern. Die Fledermaus brach oft das Gesetz, aber er kennzeichnete seine Arbeit mit kleinen Aufklebern in der Form einer Fledermaus mit ausgestreckten Schwingen, damit der Verdacht auf niemand anderen fiel.
Für McGrath waren alle Gesetzesbrecher gleich und mussten von der Polizei gejagt werden. Captain McGrath vergaß nie, nicht mal für eine Sekunde, dass er Polizeibeamter war, und da die Schwarze Fledermaus ein Gesetzesbrecher war, war McGrath felsenfest davon überzeugt, dass es seine Pflicht war, die Fledermaus seiner gerechten Strafe zuzuführen.
In der Bank eingetroffen, versuchte Malloy ihm nun zu erklären, was passiert war, aber McGrath nahm ihn nicht ernst.
„Was für einen Unsinn erzählen Sie mir denn da?“, bohrte er nach. „Ein Unsichtbarer entwendet 200 Riesen in bar direkt aus den Händen des Kassierers? Nehmen wir mal an, der Typ war wirklich unsichtbar und Sie konnten nicht sehen, wie er durch die Bank schlenderte. Wie kommt es dann, dass niemand das Geld gesehen hat, heh? Wo ist dieser Kassierer? Ich möchte mal gerne wissen, was der Mann geraucht hat, bevor er zur Arbeit gekommen ist. Ein Unsichtbarer, so ein Quatsch!“
Malloy war stinksauer. Er zeigte auf die Leiche des Wachmanns am Boden.
„Sieht das für Sie wie Quatsch aus?“, fragte er. „In Bills Herz steckt ein Messer. Niemand hat sich ihm genähert. Das heißt, niemand, den wir sehen konnten. Wie ist das Messer also in seine Brust gekommen, heh? Kommen Sie, Sie können mit dem Kassierer sprechen. Und bedenken Sie eines: Roy Banton arbeitet schon lange für diese Bank. Er ist grundehrlich. Hat noch nie auch nur einen Penny geklaut oder nur geliehen. Wenn er sagt, dass man ihm die Kohle aus den Händen geklaut hat, dann hat man sie ihm aus den Händen geklaut, haben Sie das verstanden?“
McGrath funkelte Malloy an.
„Eines habe ich verstanden. Sie sind noch verrückter als der Kassierer. Wo ist der Mann?“
McGrath untersuchte den ermordeten Wachmann, ließ einen Streifenpolizisten als Wache bei der Leiche zurück und begab sich anschließend zu einer der Kabinen der Finanzberater hinüber. Malloy und Roy Banton waren bereits dort. McGrath setzte sich und zündete den Stummel seiner Zigarre erneut an. Er beäugte Banton kritisch und musste zugeben, dass der Typ vertrauenerweckend aussah.
„Nun, Banton“, grunzte McGrath, „geben Sie mir die Details. Erzählen Sie mir alles.“
Banton schluckte. „Nun, es waren die Lohntüten der Albee-Baugesellschaft. Die heuern immer eine Menge Tagelöhner an und bezahlen sie dann in bar, jeden Mittwoch. Gestern Abend hab ich das Bargeld vorbereitet und in den Tresor gesteckt. Es war in einen Sack aus Leinen verpackt. Das Silber befand sich in einem anderen Sack. Heute Morgen haben wir wie üblich den Safe geöffnet. Ich habe den Kassierern Bargeld ausgehändigt, habe Geld für ein paar Abhebungen entnommen und dann den Sack mit den Löhnen gepackt. Und in diesem Moment, da – da ... Sie glauben sicher, dass ich den Verstand verloren habe, aber das ist die Wahrheit! Ich fühlte, wie etwas an meiner Wange vorbei strich. Dann wurde mir der Sack mit dem Geld direkt aus der Hand genommen. Obwohl außer mir niemand im Tresorraum war, das schwöre ich.“
Captain McGraths Augen verengten sich. Junkies, die beim Plündern eines Ladens erwischt wurden, erzählten glaubwürdigere Geschichten als diese.
„Ich höre“, blaffte er. „Erzählen Sie weiter.“
Banton befeuchtete seine Lippen und fuhr mit dem Finger so kraftvoll an der Innenseite seines Kragens vorbei, dass der oberste Knopf absprang.
„Das – das ist alles“, murmelte er. „Der Sack schwebte für ein paar Sekunden in der Luft und ich sah, wie das Bargeld herausgenommen wurde. Sobald die Geldbündel herauskamen, verschwanden sie. Sie lösten sich einfach in Luft auf! Sie brauchen mich gar nicht so anzuschauen. Ich weiß, dass das verrückt klingt. Es ist verrückt – aber wer hat Bill, den Wachmann, getötet? Wer ist durch die Türen verschwunden? Ich habe gesehen, dass sie sich geöffnet haben.“
„Dazu kommen wir später“, grunzte McGrath. „Bleiben Sie bei dem, was sich im Tresor abgespielt hat.“
„Nun, ich wurde plötzlich mit Gewalt in eine Ecke gestoßen. Mein Kopf traf das Stahlregal. Ich-ich schätze, dass ich für eine Minute bewusstlos war. Das ist alles. Der leere Sack liegt immer noch auf dem Boden ... Ich-ich fühl mich nicht wohl.“ Banton ließ sich in einen Stuhl fallen. „Ich glaube nicht an Geister. Zumindest habe ich das bisher nicht getan ... Malloy, irgendjemand muss Bill doch getötet haben? Und jemand hat doch das Gebäude durch die Eingangstüren verlassen?“
„Halten Sie ihn im Auge“, knurrte McGrath. „Ich seh mir diesen Tresor einmal näher an.“
McGrath verbrachte viel Zeit damit, den Tresorraum und den leeren Leinensack zu untersuchen, in dem sich das Geld befunden hatte. Er klopfte die stählernen Wände und den Boden ab und kletterte sogar auf das Regal, um mit dem Griff seiner Waffe gegen die Decke zu schlagen.
Er war davon überzeugt, dass es im Tresor selbst keinen versteckten Ausgang gab. Dann rief er mehrere seiner Männer zusammen, um die gesamte Bank zu durchsuchen. Das Ergebnis war, dass das Einzige, was fehlte, 200.000 Dollar waren, ordentlich gebündelt.
Die Spurensicherung kümmerte sich um den toten Wachmann und untersuchte den Griff des Messers besonders intensiv.
„Absolut sauber, Captain“, berichtete einer von ihnen McGrath. „Keinerlei Verschmutzungen am Griff. Was zum Teufel geht hier vor?“
„Geister“, erwiderte McGrath. „Gespenster, böse Feen und unsichtbare Männer. Pah! Bald haben sie mich so weit, dass ich an meinem eigenen Verstand zweifele.“ Er schaute sich um. „Jemand meinte, ein Kunde hätte etwas berichtet. Wer war das?“
Der Mann, der Malloy von dem Luftzug berichtet hatte, den er gespürt hatte, trat zu ihnen und wiederholte seinen Bericht. Um den Zweifel in McGraths Augen zu zerstreuen, wurde sein Ton beharrlicher.
„Ich gebe zu, dass es absurd klingt, dass es ein Unsichtbarer war, aber ich schwöre, dass etwas an mir vorbeigelaufen ist. Meine Augen und meine Ohren sind sehr gut, aber ich habe niemanden gesehen und auch keine Schritte gehört. Direkt darauf ging der Wachmann zu Boden. Ich dachte, er wäre ausgerutscht und beim Sturz k.o. gegangen.“
„Haben Sie gesehen, wie sich das Messer durch die Luft bewegt hat?“, fragte McGrath skeptisch. „Oder war das auch unsichtbar?“
„Ich habe kein Messer gesehen. Es ist unmöglich, dass das Messer auf den Wachmann geworfen wurde. Ich stand keine fünf Meter von der Tür entfernt. Niemand befand sich zwischen ihm und dem Eingang. Zumindest niemand, den ich sehen konnte. Sie können sich nicht hinter einem Mann befinden und das Messer in einem Bogen auf ihn werfen, so dass die Klinge durch seine Brust geht, während er Ihnen seinen Rücken zudreht.“
„Hey, Murphy!“, rief McGrath zu einem seiner Mitarbeiter rüber. „Nehmen Sie Namen und Adresse dieses Mannes auf. Und lassen Sie es sich besser bestätigen, anhand von Papieren oder durch ein paar Anrufe. Stellen Sie sicher, dass er der Mann ist, der er behauptet zu sein. Am besten filze ich ihn hier auf der Stelle. Die 200 Riesen müssen hier irgendwo sein. Ich weiß nicht, wie jemand so viel Knete in seinen Klamotten verstecken kann, aber mir sind schon merkwürdigere Dinge passiert.“
„Mein Name“ – der Fremde holte Papiere hervor, um seine Worte zu bestätigen – „ist Tom Murnay. Ich bin ein Ingenieur. Diese Papiere belegen das.“
Eine Stunde verging mit der Durchsuchung. McGrath sprach mit einem Kassierer nach dem anderen und anschließend mit allen Kunden. Er befragte den Präsidenten der Bank nach Roy Bantons Reputation und betrat schließlich den Beraterraum, wo Banton in einer niedergeschlagenen Haltung saß.
„Sie glauben immer noch, ich wär verrückt, oder?“ Banton sah auf. „Ich kann es Ihnen nicht verübeln. Ich hätte nie ein Wort darüber verlieren sollen, was im Tresorraum passiert ist. Ich hätte damit rechnen müssen, dass man mir nicht glaubt, aber ...“
„Spucken Sie es aus“, blaffte McGrath ihn an. „Sie halten doch was zurück, Banton. Sie haben uns nicht alles verraten.“
Banton schüttelte niedergeschlagen den Kopf. „Doch, das hab ich. Wie ich Ihnen schon gesagt habe – jemand, den ich nicht sehen konnte, hat mich geschubst. Im gleichen Moment habe ich eine Stimme direkt an meinem Ohr gehört. Sie warnte mich, wenn ich etwas verrate, würde der Sprecher zurückkehren und mir den Rest geben. Sie lachen. Ich wünschte, Sie wären an meiner Stelle in dem Tresorraum gewesen. Ich wünschte, irgendjemand anders wäre an meiner Stelle dort gewesen. Ich muss an die Luft. Mir ist schlecht! Können Sie nicht sehen, dass mir schlecht ist?“
„Bringen Sie ihn zur Hintertür raus“, befahl McGrath Malloy. „Wenn er ausbüxt, dann geben Sie ihm Saures. Aber er kann nicht entkommen. Der ganze Block ist gesichert. Beeilen Sie sich, los! Der Typ bricht uns gleich zusammen.“
McGrath saß alleine im Beraterzimmer für zwei bis drei Minuten. Er versuchte, sich die fantastischen Details des Falls vor Augen zu führen. Er sagte sich immer wieder, dass so etwas wie Unsichtbarkeit nicht existierte.
Und doch ... Er schaute hinaus in die Haupthalle der Bank. Der Raum war von hellem Tageslicht erfüllt. Die verrückte Geschichte des Kassierers passte zu dem Bericht eines Kunden – und zu dem toten Wachmann. McGrath wusste, dass sich niemand zwischen dem toten Wachmann und der Tür befunden hatte, als er sich auf den Ausgang zubewegt hatte. Wie also konnte das Messer in sein Herz gerammt werden? Wo war das Geld? Wer hatte die Glastür am Eingang aufgedrückt? Es gab so viele Zeugen für das Phänomen.
McGrath stöhnte. Dieser Fall wuchs ihm über den Kopf. Es schien keine andere Lösung zu geben, als dass der Kassierer, der im Tresorraum gewesen war, nicht die Wahrheit sagte. Ein Unsichtbarer hatte zu ihm gesprochen! Wie lächerlich!
Dann schoss McGrath wie vom Donner gerührt aus seinem Stuhl. Ein Schuss war von der Rückseite des Bankgebäudes zu hören. Er rutschte über den Marmorboden, eilte den langen Korridor hinunter und an den Büros der Sachbearbeiter vorbei, bis er die Hintertür erreichte. Er stürmte hindurch und sah Malloy mit einer rauchenden Waffe in der Hand, der die Wand des benachbarten Gebäudes emporblickte. McGrath folgte seinem Blick und fluchte laut.
Roy Banton stieg die Feuerleiter empor, mit der Geschwindigkeit und Gewandtheit eines Äffchens.
„Er ist mir entkommen!“, sagte Malloy. „Ich habe einen Warnschuss abgegeben, doch ich wollte ihn nicht treffen. Ich hätte ihn töten können, aber der Typ ist unschuldig, ganz gleich, was Sie sagen.“
McGrath fuhr mit der Hand in seine Tasche, zog eine Waffe hervor und begab sich zur Feuerleiter.
„Sicher“, spottete McGrath. „Unschuldige Männer klettern immer Feuerleitern hinauf, als wär der Teufel hinter ihnen her.“
McGrath war auch ein schneller Kletterer und konnte sogar den Vorsprung des Flüchtenden verkürzen. Einmal jagte er eine Kugel nahe an Bantons Kopf vorbei und brüllte den Befehl, stehen zu bleiben, aber Banton lief weiter, als wären ihm tausend Teufel auf den Fersen. Er schwang sich aufs Dach und verschwand.
McGrath erreichte das Dach nur ein paar Sekunden später. Mit gezogener Waffe riskierte er einen Blick über das Dach. Banton hätte in der Zwischenzeit irgendwo eine Waffe auflesen können und McGrath wollte sich nicht freiwillig aus dieser Höhe abschießen lassen.
Aber Banton hatte das Dach bereits überquert und stand am Rand der gegenüberliegenden Seite. Er taumelte wie ein Betrunkener, um das Gleichgewicht zu halten. McGrath eilte zu ihm.
Banton lehnte sich nach vorne, bis er das Gleichgewicht verlor. Einen Entsetzensschrei ausstoßend, schoss er auf den Bürgersteig zu. Als McGrath über die Kante blickte, sah er Banton, der unten mit ausgestreckten Gliedern dalag.
McGrath wandte sich ab, steckte aber seine Waffe nicht weg. Vielleicht mochten ihn einige Leute dafür für verrückt halten, aber er hätte schwören können, dass etwas, was er nicht sehen konnte, Banton vom Dach geschubst hatte. Wenn der Kassierer Selbstmord begehen wollte, hätte er nicht krampfhaft versucht, das Gleichgewicht zu halten, sondern hätte sich einfach Hals über Kopf in die Ewigkeit gestürzt.
McGrath stellte fest, dass er übermäßig schwitzte und sein Hals trocken war. Dieser Vorfall übertraf sogar die Schwarze Fledermaus in der Disziplin, sich bei Bedarf in Luft aufzulösen.
Kapitel 2 – Ein Hilferuf für die Schwarze Fledermaus
In einem der besten Wohnviertel der Stadt befand sich ein weitläufiges Anwesen mit Blumengärten, Sträuchern und einem perfekt gemähten Rasen. Von der Straße abgeschirmt wurde es durch eine Reihe großer Laubbäume. Auf einem kleinen Schild am Tor des Anwesens war zu lesen:
ANTHONY QUINN
In dem großen Gebäude hantierte ein schlanker Mann mit einer hohen Stirn, einem hageren Gesicht und lebendigen, kleinen Augen in der Empfangshalle emsig herum. Er trug einen dunklen Anzug und eine Fliege, aber er sah nicht wie ein Diener aus, auch wenn er sich selbst so bezeichnet hätte. Um genau zu sein, war Silk Kirby eine Kombination aus Butler, Chauffeur, Kammerdiener und Assistent eines blinden Mannes.
Es gab einen Grund dafür, dass er sich in der Halle aufhielt: Seine Aufmerksamkeit galt der Eingangstür, als würde er auf jemanden warten. Er hörte, wie ein Auto anhielt, eine Tür zugeschlagen wurde und das Tor quietschte. Silk sah einen großen, gut gekleideten Mann, der auf die Haustür zuschritt. Silk stürmte durch die Halle, betrat das Arbeitszimmer und klopfte an der Wand. Dann kehrte er zur Eingangstür zurück.
Ein Stück der Wand, gegen die Silk geklopft hatte, öffnete sich, auch wenn dieser Mechanismus selbst für einen Experten für Geheimtüren zuvor komplett verborgen war. Der Mann, der heraustrat, trug ein Smokingjackett, hielt einen Gehstock in der Hand und eine Pfeife zwischen seinen Zähnen. Sein Körperbau war muskulös, wie der eines Athleten. Seine Augen waren hell und freundlich – abgesehen von der Haut, die sie umgab. Etwas hatte sich tief in Tony Quinns Gesicht gebrannt und furchtbare Narben als ein unübersehbares, ewiges Andenken zurückgelassen.
Die Türklingel surrte und da passierte etwas Merkwürdiges. Aus Tony Quinns hellen Augen wich alles Leben. Das Grau der Augen schien sich in Weiß zu verwandeln. Er trat langsam und steif zum Kamin und nahm in einem bequemen Sessel Platz. Seine Bewegungen waren die eines komplett blinden Mannes und außer für drei Menschen war Tony Quinn das auch. Unheilbar und für alle Zeiten. Die besten Chirurgen in der Welt hatten das bezeugt.
Silk öffnete die Haustür, verbeugte sich leicht und begrüßte den Besucher.
„Wie geht es Ihnen, Sir? Ich hatte Richter Leslie erwartet. Bitte entschuldigen Sie meine Überraschung.“
„Das ist schon in Ordnung.“ Der Besucher lächelte. „Ich bin der Kanzleipartner von Richter Leslie, Jim Charters. Mister Quinn ist im Haus, nehme ich an?“
„Oh ja, Sir“, antwortete Silk, wobei er den Besucher heimlich musterte. „Richter Leslie hatte den Besuch telefonisch angekündigt.“
„Gut.“
Jim Charters, so entschied Silk mit seiner guten Menschenkenntnis, war ein feiner Kerl. Die Art von Mann, die ein treuer Freund oder ein tödlicher Feind sein konnte. Er führte ihn ins Arbeitszimmer und kündigte ihn an.
Tony Quinn erhob sich nicht aus seinem Sessel. Er streckte lediglich fahrig seine Hand aus. Charters ergriff sie und Quinn lächelte.
„Hallo, Mister Charters. Richter Leslie hat Sie natürlich schon öfters erwähnt. Was ist los? Warum ist er nicht selbst gekommen?“
Charters öffnete ein Zigarettenetui und hielt es Quinn hin. Dann steckte er es, leicht peinlich berührt, wieder weg. Es war kaum festzustellen, dass dieser Mann blind war, bis man ihm in die Augen sah. Doch dann bestand kein Zweifel mehr an Tony Quinns Gebrechen.
Charters nahm in einem Sessel Platz.
„Ich habe Leslie überredet, nicht zu Ihnen zu fahren, Mister Quinn“, sagte er. „Ich glaube, dass ich Ihnen die Situation unter den gegebenen Umständen viel besser beschreiben kann. Etwas Schlimmes ist dem Sohn des Richters passiert. Sie kennen doch den jungen Bob, oder?“
Quinn nickte. Er hatte den Kopf in Charters’ Richtung gedreht, aber seine Augen waren irgendwo links von seinem Besucher ins Leere gerichtet.
„Ja. Bob ist ein guter Kerl und hat außerdem das Zeug dazu, ein guter Anwalt zu werden. Erzählen Sie mir bitte, was ihm passiert ist.“
Charters nahm einen langen Zug von seiner Zigarette und stieß den Rauch lautstark aus.
„Es fällt mir nicht leicht, davon zu erzählen, Quinn. Ich erzähle Ihnen alles der Reihe nach und rolle den Fall komplett auf, wie wir es vor Gericht machen. Zuerst einmal: Richter Leslie vertraut Ihnen mehr als jedem anderen. Er hat das regelmäßig erwähnt, bevor Sie ... bevor man Ihnen ... Ach, Sie wissen, was ich meine. Bevor Sie in Judge Leslies Gerichtsverhandlung durch diese verfluchten Gangster erblindet sind. Zu dumm, dass sie die Säure nicht über sich selbst statt in Ihre Augen geschüttet haben.
Nein, winken Sie nicht ab. Ich komme gleich zum Punkt. Wenn Richter Leslie jemals einen Anwalt benötigt – und das kommt auch bei Juristen vor –, dann würde er sich als allererstes für Sie entscheiden. Sogar vor mir, seinem Kanzleipartner. Ich bin natürlich auch kein Strafverteidiger, auch wenn ich mich ein wenig im Strafrecht auskenne.“
Quinn lachte. „Ich habe von Ihnen gehört. Ihr letztes Berufungsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof war ein Meisterwerk, Charters. Fahren Sie fort. Warum um alles in der Welt sollte Richter Leslie einen Strafverteidiger brauchen?“
„Es geht um Bob. Er hat eine eigene Kanzlei eröffnet und schon einige Erfolge erzielt. Gleichzeitig ist er ein sehr eigensinniger Kauz und weigert sich, sich vom Richter oder auch von mir helfen zu lassen. Nun scheint der junge Bob sich einen Schlamassel eingebrockt zu haben. Wie Sie wissen, hören alle Anwälte Geschichten von ihren Klienten, die einen normalen Menschen zum Schlottern bringen würden. Wie Ärzte und Priester unterliegen wir der Schweigepflicht unseren Klienten gegenüber. Und genauso wie Ärzte und Priester dürfen wir im Zeugenstand nicht zu unseren Klienten befragt werden.