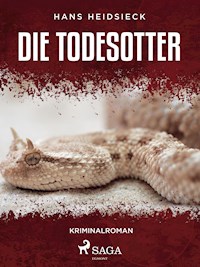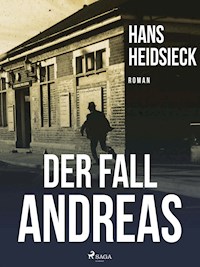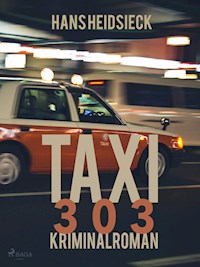Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Den Selbstmord seines Prokuristen Darracot bedauert der vornehme Mr. Cooper sehr. Dass Kommissar Hull aber einen anonym zugeschickten Brief von einer gewissen Ethel zum Anlass für weitere Recherchen nimmt, findet er doch übertrieben. Aber die Dame behauptet, dass Darracot ein Verbrecher gewesen sei. Und es gibt noch weitere verwirrende Umstände: Ein Telefonanruf informiert Hull, dass auf den noch in seinem Haus befindlichen Toten ein Attentat verübt worden sei. Darracots Dienerschaft berichtet von einer verschleierten Frau, die nach den Schüssen über den Garten geflohen sei. Nicht nur die Unbekannte bleibt ein Rätsel. Erstaunlich ist auch der offensichtliche Reichtum, mit dem sich der Prokurist umgeben hat. Inzwischen hat Kommissar Hull die Briefeschreiberin aufgespürt. Ethel Garrick war lange Zeit die Freundin Darracots. Allerdings weiß sie nichts von den unzähligen Frauenbekanntschaften, auf die Hull stößt. Als das Testament eröffnet wird, stellt sich heraus, dass eine gewisse Gloria Holden Alleinerbin ist. Während Hull die junge Dame wie eine Stecknadel im Heuhaufen sucht, macht sich der Bruder des Toten, im Glauben, sein Erbe antreten zu können, aus Südamerika auf den Weg. Überrascht erfährt er von Hull, wer der eigentliche Erbe ist: Es ist das bezaubernde Mädchen, das er auf dem Schiff kennengelernt hat.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Die verschleierte Frau
Kriminal-Roman
Saga
Die verschleierte Frau
German
© 1936 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508749
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Zwei Schatten, spukhaft zusammengeballt, tasteten sich durch den Nebel. Kommissar Hull hielt sich an Cromes Pelerine fest. „Verdammt!“ brummte er, „das ist schon kein Nebel mehr — das ist eine Suppe!“
„Hätten wir nicht doch besser ein Auto genommen?“ wagte Crome einzuwenden. Dabei schielte er nach dem verschwommenen Schattenriß, in den sich sein Vorgesetzter aufgelöst hatte.
Hull lachte rostig auf. „Auto! Auto! Da kämen wir ja noch langsamer vom Fleck, als zu Fuß! Oder wir säßen bereits in irgend einer Schaufensterscheibe.“
„Warum nicht?“ erlaubte sich Crome zu scherzen.
„Wenn es ein Delikateßgeschäft wäre — —!“
Mit seinen aufgeworfenen Lippen, zwischen denen die kräftigen Raffzähne saßen, sah Crome stets wie ein bissiger Köter aus. Dabei war er an sich der gutmütigste und harmloseste Mensch von der Welt — so weit ihn der Dienst nicht zwang, andere Seiten hervorzukehren.
Hull ging auf den Scherz nicht ein. Seine Gedanken schienen zu arbeiten. Fast wäre man eben mit zwei entgegenkommenden Leuten zusammengestoßen.
Auf dem Fahrdamm schlichen die Autos wie Schnecken dahin. Selbst die Nebellichter halfen hier kaum noch. Überall schrillten Signale auf. Die Laternen brannten. Man sah sie erst, wenn man dicht vor ihnen stand.
An Straßenkreuzungen mußte man besonders vorsichtig sein. Aber Hull fand seinen Weg. Mit der gleichen Ruhe und Sicherheit, mit der er seine Kombinationen machte, bewegte sein sportlich gestählter Körper sich in der realen Welt.
Vor dem eisernen Gartentor einer Villa in Kensington machte man halt. Man sah nicht — man fühlte nur mit dem Blick die eisernen Stangen. Dahinter ein graues, dämmriges Nichts. Hull drückte den Klingelknopf.
„Mister Cooper?“ fragte Hull.
„Erwartet die Herren bereits!“ erwiderte der Diener. Die Tür sprang auf.
Mister Cooper stand in der Hall. Er sah blaß aus. Wog ganz leicht, fast unmerklich, den großen, wuchtigen Kopf hin und her. Die sprechenden, hellen Augen waren von Trauer umflort. Irgendwie paßte das nicht ganz zu seiner straffen Erscheinung.
„Es ist schön, daß Sie Wort halten!“ sagte er nach einer schlichten Begrüßung. „Kommen Sie in mein Zimmer. Nehmen Sie Platz!“
Die beiden Beamten folgten seiner Einladung.
„Wir haben den Fall bereits untersucht!“ begann Hull. Er sprach etwas abgehackt. „Ein Mord liegt nicht vor. Darracot hat sich tatsächlich selbst erschossen.“
Cooper betrachtete seine sehnigen Hände. „So — — na und — —?“
Hull fuhr sich mit der Rechten über das vorgetriebene Kinn, das äußerste Energie verriet. „Trotzdem“, erwiderte er, „scheint mir etwas Geheimnisvolles dahinter zu stecken. Etwas — — na — — ein Verbrechen also!“
Crome nahm einen Brief aus der Tasche und reichte ihn Cooper. „Lesen Sie, bitte!“
Cooper las den Brief. Sein heller Blick verfinsterte sich. Endlich reichte er das Schreiben zurück. „Eine Drohung also!“ bemerkte er. „Und wer ist diese Ethel, die den Brief unterzeichnet hat?“
„Sie fragen gleich etwas viel!“ meinte Hull lächelnd. Cooper lehnte sich straff zurück. „Hm — ja — — Verzeihung. Wenn Sie gleich alles wüßten — — Sie wollen den Fall also weiter verfolgen?“
„Ganz recht, Mister Cooper.“
„Und warum, wenn ich fragen darf? Eigentlich haben Sie keine Veranlassung. Oder liegt eine Anzeige vor?“
Hull nahm Crome den Brief ab und schwenkte ihn in der Hand. „Dies ist mir Anzeige genug!“ erwiderte er mit entschlossenem Blick.
Anthony Cooper kniff etwas unwillig seine Augen zusammen. „Aber das ist doch nicht offiziell!“ rief er. „Es ist ein privates Schreiben, das Sie bei einem Toten gefunden haben. Offiziell geht es Sie gar nichts an.“ Ein starker Unwille klang aus seiner Stimme. Hull zog die Schultern hoch. „Offiziell“, erwiderte er, „habe ich den Fall untersuchen müssen. Dieses Schreiben aber hängt aufs engste damit zusammen.“
„Und wenn ich Sie bitte, Herr Kommissar — —“
„Was — bitten?“
„Die Sache auf sich beruhen zu lassen! Sehen Sie — Darracot war der Prokurist meiner Firma — ich habe ihn hochgeschätzt — kann mir auch garnicht denken, daß er, wie man hier in dem Brief anzudeuten beliebt, ein Verbrechen begangen haben soll. Kurzum — ich will mir das Andenken an ihn nicht verschandeln lassen. Wahrscheinlich liegt hier nur eine üble Verdächtigung vor.“
„Wegen einer Verdächtigung erschießt man sich nicht!“ war Hulls trockene Antwort.
„Wissen Sie denn bestimmt, ob er es gerade deswegen getan hat?“
„Der Brief lag neben dem Toten.“
In diesem Augenblick betrat der Diener hastig den Raum, ohne vorher geklopft zu haben. Herr Kommissar Hull, meldete er, werde dringend am Telefon gewünscht.
„Verbinden Sie!“ gebot Cooper und nahm den Hörer des auf dem Tisch stehenden Aapparats. Er drückte ihn Hull in die Hand. „Bitte!“
Der Kommissar legte den Hörer ans Ohr. In seinen Zügen drückte sich ein lebhaftes Erstaunen aus. Man hörte nur, wie er sagte: „Ich komme sofort!“
Er wandte sich, fast triumphierend, wieder dem Hausherrn zu. „Sonderbar!“ murmelte er. „Mister Cooper — was sagen Sie dazu: Auf Darrakot ist soeben ein Attentat verübt worden!“
Cooper sprang auf. Er blickte den Kommissar an, als ob er an dessen Verstand zweifeln müsse. „Auf Darracot?“ rief er. „Aber das ist doch Unsinn! Auf einen Toten macht man kein Attentat!“
„Gewiß hat der Täter noch nicht gewußt, daß er tot war“, gab Hull zur Antwort, der sich mit Crome gleichfalls erhoben hatte. „Näheres weiß ich ja auch noch nicht. Jedenfalls werden Sie zugeben müssen, daß mir nunmehr nichts anderes übrig bleibt, als dieser mysteriösen Angelegenheit auf den Grund zu gehen. Nach meinen bisherigen Ermittlungen muß eine verschleierte Frau mit im Spiele sein.“
„Eine verschleierte Frau?“
„Jawohl. Sie ist mehrfach in Darracots Villa beobachtet worden. Aber verzeihen Sie bitte — ich muß jetzt gehen. Kommen Sie, Crome!“
„Nehmen Sie mich doch mit!“ sagte Cooper.
„Nein!“ erwiderte Hull mit einer abwehrenden Handbewegung. „Das geht leider nicht. Leben Sie wohl, Mister Cooper! Wir werden bald von uns hören lassen!“
Darracots Leiche lag noch so da, wie Hull und Crome sie in seinem Parterrezimmer auf die Couch gebettet hatten. In dem Raum stand jetzt die Dienerschaft, mit ratlos verstörten Gesichtern. Der Kommissar wies die Leute hinaus. Nur William, den Diener des Toten, hielt er zurück.
„Also reden Sie!“ forderte Hull ihn auf. „Was hat sich hier abgespielt?“
Der Diener, ein etwa dreißigjähriger, intelligenter Mensch, starrte völlig verwirrt vor sich hin.
„Herr Kommissar“, setzte er stotternd an, „ich — also — als Sie und der andere Herr da gegangen waren, blieb auf meine Anordnung hin zunächst Mary, das Hausmädchen, bei dem Toten zurück, um Wache zu halten. Aber das dumme Ding hat es irgendwie mit der Angst bekommen — jedenfalls kam sie plötzlich zu mir gelaufen und behauptete, geheimnisvolle Geräusche vernommen zu haben. Sie wollte nicht mehr allein bei der Leiche bleiben. Gerade wollte ich dem Schofför den Auftrag zur Ablösung geben — da krachten unten die Schüsse schon.“
„Hier also — in diesem Raum?“
„Ja. Ich stürzte natürlich sofort herunter — die Tür nach dem Garten stand weit geöffnet, dieser Sessel war umgeworfen — und dann die Einschüsse dort an der Wand —“
„Den Sessel haben Sie wieder aufgerichtet?“
„Jawohl.“
„Das hätten Sie besser nicht getan.“ Hull trat an die Wand, wo dicht über dem Kopf des Toten zwei Kugeln saßen. Eine hatte das Haar des Toten gestreift. Bei näherer Untersuchung konnte auch noch ein Einschuß in den Schädel festgestellt werden. Dieser Schuß wäre unbedingt tötlich gewesen, hätte sich der Getroffene noch am Leben befunden.
„Wieviel Schüsse hörten Sie denn?“ fragte Hull.
„Drei oder vier!“ war die Antwort.
Auch Crome untersuchte jetzt alles noch einmal genau. Er kratzte mit einem stumpfen Messer die beiden Kugeln aus der Mauer heraus. Die eine überreichte er Hull. Die andere nahm er selbst in Augenschein. „Vier-Komma-sieben Trommelrevolver mit Klapplauf!“ murmelte er.
„Stimmt!“ nickte Hull ihm zu. Dann wandte er sich wieder an William. „Also reden Sie mal, werter Freund“, sagte er wohlwollend, „wie erklären Sie sich diese sonderbare Geschichte?“
William blickte ihn offen an. „Der Täter“, begann er, „wußte natürlich nicht, daß Mister Darracot bereits tot war. Er schlich sich, vom Garten kommend, hier in das Zimmer und gab dann auf den für ihn anscheinend Schlafenden rasch hintereinander die Schüsse ab. Dann verschwand er wieder. Der starke Nebel mußte ihm dabei zu Hilfe kommen.“
„Haben Sie ihm nicht zu folgen versucht?“
„Selbstverständlich. Aber man kann ja die Hand nicht vor Augen sehen. Ich rannte von einem Baum gegen den anderen.“
Hull steckte die Kugeln ein. „Fatale Geschichte. — Na, und wer, denken Sie, könnte die Tat hier begangen haben?“
Der Diener zuckte ratlos die Achseln.
„Hat Ihr Herr in der letzten Zeit mit irgend jemandem Streit gehabt?“
William wußte nichts.
„Sie sprachen mir heute morgen von einer verschleierten Frau.“ Der Kommissar ließ nicht locker.
„Wann haben Sie diese Person zum letzten Mal hier gesehen?“
„Ich sah sie lange nicht jedesmal“, erklärte der Diener. „Herr Darracot richtete es häufig so ein, daß niemand im Hause war, wenn sie kam. Auch weiß ich noch nicht einmal, ob es immer dieselbe war.“
„Ja — wieso?“ fragte Hull erstaunt.
„Einmal kam sie mir blond vor, einmal schwarz oder braun.“
„Hm. Herr Darracot hatte viele Damenbekanntschaften, was?“
„Ist nicht abzustreiten, Herr Kommissar. Als Junggeselle legte er sich keinerlei Schranken auf.“
„Sie haben doch gewiß manchen Einblick in sein Leben gewinnen können. Jedenfalls werden Sie wissen, mit wem er besonders häufig zusammenkam?“
Der Diener machte eine bedauernde Armbewegung.
„Herr Darracot“, sagte er, „lebte an sich äußerst zurückgezogen. Ich meine damit: er liebte es, alles, was er tat, zu verschleiern.“
„Daher auch die verschleierte Frau!“ wandte Crome lachend ein. „Vielleicht war sie es, die die Schüsse hier abgab.“
Hull ging auf diese Worte nicht ein. Er fragte weiter den Diener aus. Dabei erfuhr er, daß Darracot sich am Vorabend noch mit irgend jemandem in seinem Zimmer sehr aufgeregt unterhalten hatte. Sein Gesprächspartner war eine Frau. Wer es war, konnte William nicht sagen. Auch die Befragung des übrigen Personals ergab keine Klarheit darüber.
Staatsanwalt Evans spielte mit einer silbernen Zigarettendose. Vor ihm saß Kommissar Hull, der eben Bericht erstattet hatte.
Es handelte sich um die Frage, ob der Fall Darracot weiter bearbeitet werden sollte. Der Kommissar hatte sie aufgeworfen.
Evans, sehr scharf, äußerst gewissenhaft, blickte den Kommissar ernst an. Selbstverständlich — bemerkte er — müsse man diese Angelegenheit weiter verfolgen.
„Ich gehe nicht davon ab, daß hier ein Verbrechen zugrunde liegt, dem ich als Staatsanwalt nachzugehen verpflichtet bin. Von den fesselnden Fragen, die dabei auftauchen, will ich noch nicht einmal reden. Teilen Sie meinen Standpunkt etwa nicht, Kommissar Hull?“
„Doch, Je mehr ich mir den Fall überlege, desto mehr neige ich auch dazu.“
Der Staatsanwalt deutete auf den vor ihm liegenden Brief. „Glauben Sie hieraus schon irgendwelche Schlüsse ziehen zu können?“
Auf der breiten Stirn Hulls erschienen einige Falten.
„Kaum“, erwiderte er; „der Brief ist mit der Maschine geschrieben, und zwar mit einer Remington-Reisemaschine, Modell 32.“
„Das sehen Sie wohl auf den ersten Blick?“
„Hm — immerhin auf den zweiten, Herr Staatsanwalt. Um aber wieder auf diesen Brief zu kommen — inhaltlich läßt er nicht viele Schlüsse zu.“
Evans überflog die Zeilen noch einmal. Unwillkürlich sprach er die Worte leise vor sich hin: „Ich habe Dich gestern belauschen können und weiß nun, welchem Verbrechen Du Dein Riesenvermögen verdankst. Du mußt mich jetzt heiraten, Cyril. Wenn dies nun nicht innerhalb der nächsten vier Wochen geschieht, zeige ich Dich bei der Staatsanwaltschaft an. Ich habe Dich in der Hand. Ethel.“
„Sie sprachen von einer verschleierten Frau“, fuhr Evans jetzt lauter fort. „Ob sie die Schreiberin dieser Zeilen war?“
Hull kritzelte etwas auf einen Aktendeckel, der vor ihm lag. „Darüber läßt sich noch garnichts sagen“, erwiderte er. „Man wird, wie immer, ganz systematisch vorgehen müssen.“
„Ich bin überzeugt, Sie werden die Lösung des Rätsels bald bringen.“
„Allerdings“, entgegnete Hull geschmeichelt; „bisher blieb noch kein Fall unaufgeklärt, den ich in die Hand nahm.“
„Ich werde zunächst verfügen“, erklärte der Staatsanwalt, „daß sämtliches Eigentum Darracots zu beschlagnahmen ist. — Wissen Sie seine Erben?“
„Nein. Aber er soll einen Bruder haben, der wurde bereits durch den Diener benachrichtigt.“
„Hm. Man wird auch feststellen müssen, ob irgend ein Testament besteht.“
„Selbstverständlich. Alles ist für die Aufklärung wichtig. Vor allem will ich einmal die in seinem Besitz aufgefundenen Papiere prüfen. Es gilt zunächst, seinen Bekanntenkreis zu ermitteln.“
„Ja. Tun Sie das! Wie Sie sagten, verkehrte er auch im Hause von Mister Cooper, der wohl sein Chef war?“
„Ja. Darracot trat vor siebzehn Jahren als Buchhalter in die Firma Cooper & Day ein. Vor dreizehn Jahren wurde er Prokurist.“
„Cooper & Day ist ein großes Haus!“
„Ja. Eine Riesenfirma. Handel und Spedition. Läßt eigene Schiffe fahren. Zweighäuser befinden sich in Paris, Rom und New York.“
„Ich sehe, Sie sind genau unterrichtet.“
„Day ist vor drei Jahren verstorben. Cooper besitzt jetzt die Firma allein. Days Witwe soll allerdings noch beteiligt sein.“
„Cooper wird sich nicht gerade freuen über diese Geschichte“, meinte der Staatsanwalt. „Aber wir können ihm leider nicht helfen. Übrigens, Hull — mir kommt ein Gedanke.“ Evans strich sich über die Stirn, als ob er diesen Gedanken dadurch noch rascher hervorlocken könnte. „Wie wäre es, wenn wir — ja, wenn wir trotz allem — wenigstens vor der Öffentlichkeit — von einem Mord sprechen würden?“
„Das wird wohl nicht gehen“, erwiderte Hull bedenklich. „Außerdem habe ich Cooper schon mitgeteilt, daß Darracot sich erschossen hat.“
„Wenn man das aber bekanntgibt, wiegt man den Mörder in Sicherheit!“
„Aber Herr Staatsanwalt — es ist ja gar kein Mörder vorhanden!“
Evans lächelte. „Na gut, Hull — handeln Sie, wie Sie denken. — Verzeihen Sie bitte!“
Das Telefon summte. Ein Besuch wurde angemeldet. Evans erhob sich. Er reichte Hull etwas hastig zum Abschied die Hand.
Cooper und seine Gattin saßen am Frühstückstisch. Das Frühstück wurde im Wintergarten serviert. Lautlos war eben der Diener wieder davongehuscht.
„Good morning, Sir!“ rief der Papagei aus dem goldenen Käfig und schaukelte sich auf der Stange. „Good morning, Sir!“
Seltsam — mochte er denken — heute bekomme ich meinen üblichen Zucker nicht?
Niemand beachtete ihn. Noch einige Male wiederholte er seinen Gruß. Dann zog er sich gekränkt in eine Ecke zurück und plusterte seine Federn auf. Herrchen und Frauchen mochten wieder mal Sorgen haben. Was verstand er davon?
Über dem Ehepaar lastete eine düstere Stimmung. Coper nahm hastig die Times zur Hand, die neben dem Teller lag.
„Hier steht es schon!“ brummte er, nachdem er in die Lokalnotizen Einblick genommen hatte. „Gottseidank nur eine kurze Notiz. Aber es ist doch peinlich für uns — äußerst peinlich. Die ganze Geschichte kommt mir überhaupt äußerst sonderbar vor. Kannst du dir vorstellen, Evelyne, daß Darracot ein Verbrechen begangen hat?“
„Frau Cooper blickte betroffen auf. „Ein Verbrechen? Wie kommst du denn darauf?“
„Na — dieser Hull, weißt du: der Kommissar von Scotland Yard, scheint es anzunehmen. Es wurde ein Brief gefunden — ich habe dir doch erzählt.“
„Pah — Kommissare wittern überall gleich ein Verbrechen. Ich glaube nicht dran. Oder trautest du etwa Darracot so etwas zu?“
„Nein.“
„Na also!“ Frau Cooper führte ihr Sandwich zum Munde. Bevor sie hineinbiß, fuhr sie fort: „Es wird eine Liebesgeschichte dahinterstecken. Cherchez la femme!“
„Na ja. Gewiß — möglich. Aber —“
„Was aber?“
„Er hätte sich doch nicht gleich zu erschießen brauchen. Dir geht es auch nahe — ich sehe es dir an.“
„Selbstversändlich. War Darracot nicht mit unserem Hause sozusagen verwachsen?“
„Daß es so enden mußte, hätte ich nie gedacht. Ganz abgesehen vom rein menschlichen Standpunkt — auch geschäftlich gesprochen, konnte der Fall nicht ungelegener kommen.“
„Wie meinst du das?“
„Na, du weißt doch — er hatte erst kürzlich auf meine Veranlassung hin eine Tochtergesellschaft von uns, die er mit seinem Namen deckte, ins Leben gerufen. Es handelte sich um die Waffentransporte.“
„Waffentransporte? Ja — richtig. Nach Abessinien!“
„Ich hätte sie unter dem Namen unserer Firma nicht wagen dürfen. Nun werde ich doch womöglich noch mein Incognito lüften müssen. Das kann mich aber meine ganzen Geschäftsverbindungen mit den italienischen Firmen kosten.“
„Ja. Eine fatale Geschichte!“
„Evelyne — du mußt mir jetzt helfen, einen neuen Strohmann zu finden, der die Sache sofort in die Hand nehmen kann. Du verstehst etwas vom Geschäft. Wenn du auch lange nicht mehr direkt darin tätig warst — die Geschicklichkeit wird dir geblieben sein.“
Es war, als blickte Frau Cooper in sich hinein. Erinnerungen stiegen in ihr empor. Ja, sie verstand etwas vom Geschäft. War sie nicht früher als Sekretärin in einer Speditionsfirma tätig gewesen — bis Anthony sie vom Fleck weg geheiratet hatte? Sie mußte ihm heute noch dankbar sein. Sonst wäre sie wahrscheinlich ewig Sekretärin geblieben.
Cooper hatte mit dieser Heirat nicht schlecht spekuliert. Sie machte als seine treue Gefährtin die schwierigen Kämpfe mit, die er seinerzeit zu bestehen hatte, bis er sich endlich zu Reichtum und Ansehen emporarbeiten konnte. Daran hatte auch sie ihren Anteil. Jahrelang hatte sie seine Bücher geführt.
Sie sagte also mit Freuden zu. Ja, sie werde ihm helfen, es sei wohl nicht allzu schwer, einen Ausweg zu finden.
Cooper erhob sich freudig, ging zu ihr hin, drückte ihr einen Kuß auf die Stirn.
Als kurz darauf Hull gemeldet wurde, ging Frau Evelyne schweigend hinaus.
„Good morning, Sir!“ sagte der Papagei.
„Good morning!“ erwiderte Hull lachend.
„Sehen Sie!“ meinte Cooper, ebenfalls lächelnd. „Er nimmt mir schon die Begrüßung ab. — Also was bringen Sie, Mister Hull?“
Auf eine Handbewegung Coopers hin nahm Hull ihm gegenüber Platz.
„Ich möchte, Ihr Einverständnis voraussetzend, einige Fragen stellen“, erwiderte der Kriminalkommissar. „Es handelt sich selbstverständlich um Darracot. Daß gestern noch ein Attentat auf ihn verübt worden ist, wissen Sie ja bereits.“
„Aber nichts Näheres.“
Hull berichtete kurz. Cooper hörte ihm aufmerksam zu. Seine sehnigen Hände zitterten etwas. „Merkwürdig — merkwürdig —!“ sagte er nur immer wieder. „Aber nun fragen Sie. Was wollen Sie wissen?“
Hull spielte auf Damenbekanntschaften Darracots an. Cooper schüttelte seinen wuchtigen Kopf dazu. Was er darüber wisse, werde für Hull so gut wie garnichts bedeuten. Ein Frauenverächter sei Darracot freilich nie gewesen, aber er war durch und durch Kavalier: niemals hätte er etwas über seine galanten Abenteuer verlauten lassen. Er, Cooper, habe ihn eigentlich nur zwei, drei mal mit einer Schauspielerin zusammen gesehen. Hull hakte hier sofort ein. Er verlangte den Namen zu wissen. Anthony Cooper glaubte, es könnte die Garrick vom Operettentheater gewesen sein.
„Ah — — Ethel Garrick!“ entfuhr es dem Kommissar.
„Wieso Ethel? Na ja — wie? Ach, richtig!“
Die beiden Männer blickten einander an. Um Hulls Mund ging ein freudiges Zucken.
Weiter wußte Cooper von Darracots Frauen nichts. Hull stellte eine andere Frage:
„Ich möchte nicht indiskret sein, aber vielleicht können Sie mir verraten, was für Bezüge Ihr Prokurist bei Ihnen gehabt hat?“
Cooper nannte die Summe. Sie war zwar anständig, aber garnicht besonders hoch.
„Glauben Sie, daß er damit den riesigen Aufwand bestreiten konnte, den er getrieben hat?“ fragte der Kommissar.
„Aufwand? Wieso?“ fragte Cooper verwundert. „Er wohnte in einer Villa, gewiß. Aber die hatte er nur gemietet.“
„Sie irren sich, Mister Cooper, das Haus war sein Eigentum.“
„So?“
„Ja. Außerdem hatte er eine Yacht, mehrere Rennpferde, sogar ein eigenes Flugzeug.“
Cooper reckte sich jäh empor. Seine hellen, sprechenden Augen öffneten sich bis zur äußersten Weite.
„Ja ja“, sprach Hull weiter. „Ich gestehe, die Feststellungen haben mich selbst überrascht. Darracot führte gewissermaßen ein Doppelleben.“
„Davon hat er mir niemals etwas gesagt!“ entschlüpfte es Cooper.
„Ja also — wo hat er diese Reichtümer her? Wissen Sie vielleicht eine Erklärung dafür?“
„Nein. Allerdings nicht.“
„Sie sehen — der Brief scheint schließlich doch Hand und Fuß zu haben.“
„Richtig. Na — und was werden Sie tun?“
„Weiterforschen. Übrigens noch eine andere Frage. In Ihrem Hause haben auch zwei Italiener verkehrt, nicht wahr?“
Cooper erblaßte etwas. „Was hat das mit der Sache zu tun?“
„Darüber möchte ich Ihnen vorläufig noch keine Auskunft geben. Aber es stimmt, nicht wahr?“
„Woher wissen Sie das, Mister Hull?“
„Geschäftsgeheimnis!“ lächelte der Kommissar.
Cooper erhob sich. Er schritt nervös auf und ab. Hull schien das nicht zu beachten. „Ist Darracot öfter mit diesen Italienern bei Ihnen zusammengetroffen?“ fragte er unbeirrt.
„Selten“, antwortete Cooper verhalten, „jedenfalls habe ich alles Geschäftliche mit diesen Herrn selbst abgemacht, das heißt: nur mit dem einen von ihnen. Er ist der Vertreter verschiedener italienischer Handelshäuser, mit denen ich schon seit Jahr und Tag in Verbindung stehe. Der andere ist sein Sohn, der hier auf die Hochschule geht. — Aber was soll das alles?“ Geradezu ängstlich blickte Cooper dem Kommissar ins Gesicht.
„Oh — es ist mir darum zu tun, vielleicht in den Mordversuch etwas Licht zu bringen. Möglicherweise geht’s auch auf diesem Wege.“
„Ich verstehe Sie nicht!“ stotterte Cooper und hielt sich an einer Tischkante fest.
„Sehen Sie“, fuhr Hull fort, „das wissen Sie vielleicht auch noch nicht: Darracot hat kürzlich eine Firma gegründet, die sich mit Waffenhandel befassen sollte. Es ist bereits ein Transport unterwegs.“
„Ein Transport? Waffen? Wohin?“ fragte Cooper erblassend.
„Nach Abessinien, Herr Cooper.“
„Mein Gott — wie haben Sie das so schnell nur herausbekommen? Sind Sie ein Hexenmeister?“
„Nein. Aber schließlich hat man lesen gelernt. Ich hatte Gelegenheit in die Papiere Darracots Einblick zu nehmen.“
„Ah — und Sie glauben — die Italiener —?“
„Herr Cooper — es ist nur ein Weg von vielen, die ich im Geiste beschritten habe.“
„Wollen Sie etwa behaupten, daß einer der beiden Bellinis zum Mörder wurde?“
Cooper stand zitternd da. Seine Augen glühten. Hull legte ihm beschwichtigend eine Hand auf den Arm.
„Aber ich bitte Sie!“ sagte er. „Behauptet habe ich überhaupt noch nichts. Und übrigens ist ja niemand ermordet worden. Also was wollen Sie?“
„Herr Kommissar“, sagte Cooper, und seine Stimme nahm einen fast flehenden Ausdruck an, „müssen Sie denn diese Dinge weiter verfolgen? Wer hat ein Interesse daran? Gibt es überhaupt einen Kläger? Nein! Also!“
„Oh doch“, wandte Hull ein, „es gibt einen Kläger. Das ist der Staatsanwalt. Er besteht darauf, daß die reichlich sonderbare Angelegenheit aufgeklärt wird.“
Cooper senkte enttäuscht den Kopf. Hier nützte also kein Widerstand, auch kein Bitten mehr. Wie ein ungreifbares Unheil rückte es auf ihn zu. Er betrachtete Hull jetzt wie einen bösen Geist, der seine innere Ruhe aufstören wollte. Etwas Feindseliges regte sich plötzlich in ihm. Der da war unerbittlich — das wußte er. Man mußte sich in sein Schicksal fügen.
Hull spürte deutlich, welche Wandlung sich in Cooper vollzog. Aber auf Stimmungen gab er nichts. Mit einer kühlen Verneigung empfahl er sich.
Die Sonnabendvorstellung war zu Ende. Das Theater leerte sich. Die Straße lag in strahlendem Lichterglanz. Feudale Autos, elegante Toiletten, Gehupe Rufen, Geschrei. Paris bei Nacht — ein seltsam fesselnder Anblick.
Die Schauspielerin Ethel Garrick steigt in den Wagen. Eine frohe Menge umjubelt sie. Zurufen, Grüßen, begeistertes Hüteschwenken.
Nach der Schauspielerin steigt ein Herr ein. Ein eleganter Franzose, klein, beweglich, schwarz, mit funkelndem Blick.
„Aber ich bitte Sie, Herr Marquis — wohin wollen Sie noch mit mir?“ fragte Ethel und setzte sich in dem Auto zurecht.
Der Marquis nahm seinen Zylinder ab und legte ihn vor sich auf den Rücksitz. Dann streichelte er vergnügt über die zarte Hand seiner Begleiterin.
„Nur eine kleine Erfrischung noch, Kindchen — sagen wir Moulin rouge, ja?“ Mit einer geradezu übermütigen Stimme gab er dem Fahrer das Ziel an. Ethel entzog ihm sanft ihre Hand. „Sie machen sich also immer noch Hoffnungen, Herr Marquis?“ fragte sie lächelnd. „Ich dachte, daß Sie sich meiner kaum noch erinnern, seit ich ein Vierteljahr lang in London war.“
„Aber ich bitte — ich bitte Sie!“ rief der Marquis schnaufend aus. „So etwas anzunehmen! Paris war verdunkelt, war eine tote Stadt, seit Sie in London waren. Mit gesenkten Köpfen schlichen die Menschen einher, seit Ihr perlendes Lachen, Ihre göttliche Stimme nicht mehr auf der Bühne erscholl. Dumpfe Resignation fiel über die Menschen — über mich im besonderen. Und da behaupten Sie, Mademoiselle Ethel — — Sie beliebten zu scherzen, nicht wahr?“ Ethel warf einen scheuen Blick auf das kleine, bewegliche Männchen, das sich in überschwänglichen Redensarten gefiel. Putzig war er ja wirklich, der kleine Marquis, von einer rührenden treuen Ergebenheit, das mußte sie zugeben. Vor drei Jahren hatte sie ihn bei einem Gastspiel in Mailand kennengelernt. Seitdem wich er in Paris kaum noch von ihrer Seite, obwohl sie mit ihren Gunstbezeugungen äußerst karg blieb und mehr als eine gewisse burschikose Kameradschaft niemals zustande kam. Er war ein lustiger Förderer froher Stunden, ein kleines menschliches Karussel, mit dem man sich immer wieder harmlos im Kreise drehte. Ihr kleinster Wunsch wurde ihm zum Befehl. Trotz aller Aufdringlichkeit vergaß er doch nie ein gewisses angeborenes Taktgefühl; kein einziges Mal wagte er dreist zu werden, wie so viele der anderen, die sie verachtete.
„Ja ja, ich scherzte natürlich!“ gab sie nach einer Weile auf seine Frage zurück. „Es wundert mich nur, daß Sie ohne mich nicht zugrunde gingen!“
„O—o— jetzt sehe ich, daß Sie wahrhaftig zu scherzen belieben. Was sage ich: scherzen? Nein — bitte, wie sagten Sie eben doch? Nicht zugrunde gingen? Ich sollte zugrunde gehen! Ja, fast wäre ich auch zugrunde gegangen. Hätte Ihr Bild nicht auf meinem Schreibtisch gestanden, wäre es nicht in mein Herz gebrannt! Vor ihm habe ich täglich meine Andacht verrichtet. Ich kniete vor ihm, rief Ihren Namen — umarmte es —“
„Herr Marquis!“ gebot sie ihm lachend halt. „Wenn man Sie reden hört, glaubt man fast, daß man noch einen Schuljungen vor sich hat.“
„Schuljunge! Richtig, richtig!“ griff er das Wort auf.
„So fühle ich mich auch noch, seit ich Sie kennenlernte, — trotz meiner vier und fünfzig. — Übrigens bin ich inzwischen auch zweimal in London gewesen.“
„Sie waren in London?“ fragte die Diva ein wenig hastig.
„Ja. Aber kommen Sie, wir sind da. Wollen uns erst einmal in das Lokal begeben. Da werden wir weiterreden. Nicht wahr?“
Man saß bald gemütlich an einem etwas versteckten Tisch, wo man das bunte Leben und Treiben in aller Ruhe beobachten konnte.
„Ja, also —“ knüpfte der Marquis wieder an, „London — ich sah Sie da. Selbstverständlich. Im Operettentheater. Rangloge, hinter einen Pfeiler gedrückt. Wollte Sie überraschen. Aber es wurde nichts.“
„Ah — und warum nicht?“
Ethel ließ einen bunten Papierfächer durch ihre zierlichen Hände gleiten. Sie war gespannt, was er antworten würde.
Der Marquis blickte sie traurig und leidend an. Aber auch diese Geste schien seiner Art gemäß etwas übertrieben zu sein.
„Oh, liebes Kind! Sie wissen es doch am besten! Ein Glücklicherer kam mir zuvor.“
In Ethels Blick glomm ein Funken auf. „Und warum“, fragte sie, „warum haben Sie den nicht einfach über den Haufen geschossen?“
Marquis de Renard sah betroffen auf, als habe man ihm einen Hieb versetzt. „Wie —“ stotterte er. „Ich — über den — aber wieso denn? Ja ja — ich bin eben doch kein Schuljunge mehr!“
Ein feines Lächeln umspielte den vom Gebrauch vieler Schminke etwas spröden Mund der Schauspielerin. „Oh“, meinte sie, „Sie sind doch ein guter Kerl!“
„Sehen Sie, Mademoiselle, — wenn ich wirklich geschossen hätte — wem hätte ich damit gedient? Dem anderen ganz gewiß nicht; er wäre tot umgefallen. Ihnen noch weniger — Sie hätten mit verbranntem Herzen weitergelebt. Und mir selbst am wenigsten, denn ich hätte mir Ihren Haß zugezogen und würde der edlen Freundschaft auf ewig verlustig gegangen sein.“
„Ich sehe: Sie sind ein Mann von Vernunft, Herr Marquis!“
„Freilich. Alles Rowdyhafte liegt mir nun einmal vollkommen fern. Aber — wie Sie ganz richtig sagten: ein guter Kerl vielleicht doch!“
Ethel hob freundlich ihr Glas. „Stoßen wir darauf an, Herr Marquis. Sie zogen sich also damals in London wieder zurück?“
„Ja, ganz recht — ich zog ab. Wie ein begossener Pudel, wenn man so sagen darf. Beim zweiten Mal ging es mir wieder so.“
Die Schauspielerin sah ihn geradezu mitleidig an. Diese treuherzige Offenheit hatte für sie etwas Rührendes.
„Jedenfalls“, erwiderte sie, „können Sie mir keine Vorwürfe machen. Ich hatte Ihnen bereits früher gesagt —“
„— daß Ihr Herz nicht mehr frei sei. Ganz richtig. Das habe ich mir auch gemerkt. Aber es kann im Leben auch wieder mal anders kommen. Die Hoffnung soll man nie fahren lassen. Es muß auch Idealisten geben.“
Ethel schob nervös die Weinkarte hin und her. An ihrem Ringfinger funkelte ein Smaragd. De Renard starrte in das blitzende Feuer. Jeder blieb für Augenblicke mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Plötzlich fragte der Marquis dumpf: „Wer ist denn der Glückliche?“
Diese Frage erschreckte sie. Unwillkürlich fuhr sie zusammen. Hatte der Mann da ein Recht, so weit in sie zu dringen? War es nur eine rein menschliche Anteilnahme?
Sie blickte ihn lange an und überlegte, ob sie ihm antworten sollte. Die funkelnden, schwarzen Augen des Mannes fraßen sich an ihr fest. Aber es lag nur ein bittendes Hoffen in diesem Blick.
„Wenn Sie es durchaus wissen müssen“, gab sie endlich dem Drängen nach, „es ist ein gewisser Herr Darracot, Prokurist der Firma Cooper and Day. Werden Sie nun wieder ruhiger schlafen können?“
Der Marquis fuhr sich mit der Hand über die gedrungene Stirn, als ob er sich plötzlich auf etwas besinnen müsse. Seine Augen weiteten sich, der Ausdruck seiner Züge wurde merkwürdig starr.
„Darracot —“ wiederholte er, „Darracot! Wenn mich nicht alles täuscht — da hat doch heute noch etwas in der Zeitung gestanden —?“
„Was — in der Zeitung? Von Darracot?“
„Natürlich kann es auch ein anderer sein — oder ein ähnlicher Name vielleicht. Aber irgend etwas muß da passiert sein.“
„Jagen Sie mir keinen Schreck ein, Herr Marquis!“
„Aber durchaus nicht, durchaus nicht. Es war nur eine Erinnerung. Genaueres weiß ich ja auch nicht mehr. Man liest zu viel —“
Ethel befahl dem Kellner, ihr eine Zeitung zu bringen. Sie erhielt den Midi. Sofort begann sie ihn durchzusehen.
Plötzlich stieß sie einen heiseren Schrei aus. Das Blatt fiel zu Boden, ein Glas kippte um. Der Marquis ergriff bestürzt ihre zitternde Hand. „Ja, mein Gott — aber was ist denn?“
Ethel Garrick mußte alle Willenskraft aufbieten, um wenigstens äußerlich einigermaßen ruhig zu erscheinen. „Lesen Sie — also lesen Sie!“ stammelte sie und senkte den Kopf. Aber der Marquis füllte erst rasch noch ein leeres Glas und führte es an ihre blassen, bebenden Lippen.
Dann nahm er die Zeitung auf. Suchte und fand bald die Stelle, an der ihm der Name Darracot in die Augen sprang. Der Name des Mannes, von dem man noch eben gesprochen hatte.
Er war nicht mehr!