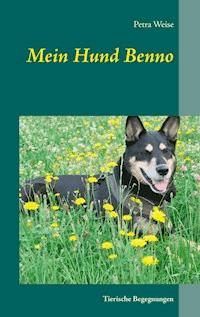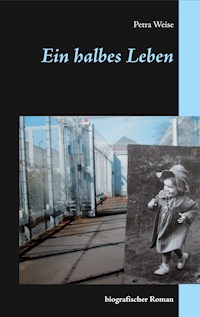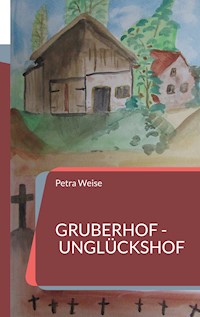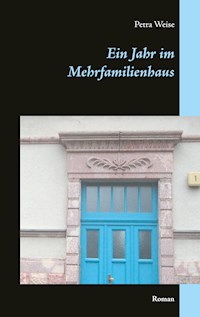Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben ist bunt wie ein Regenbogen; Rot wie die Liebe und die Blumen, grün wie die Hoffnung und das Gras, blau wie die Treue und das Wasser oder gelb wie die Eifersucht und die Sonne. Zu jeder Farbe gibt es in diesem abwechslungsreichen Buch lustige, traurige, dramatische, spannende oder alltägliche Geschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titelfoto: Sven Mehlhorn
„Bunter Schornstein“, Chemnitz
Vorwort
Das Leben ist bunt wie ein Regenbogen: Rot wie die Liebe und die Blumen, grün wie die Hoffnung und das Gras, blau wie die Treue und das Wasser oder gelb wie die Eifersucht und die Sonne.
Zu jeder der dreizehn Farben dachte ich mir Geschichten aus - lustige, traurige, dramatische und alltägliche Geschichten - und fasste sie zu dieser bunten Sammlung zusammen.
Einige dieser Geschichten wurden bereits unter dem Titel „Farbspiel“ im Karina-Verlag, Wien veröffentlicht.
Tausend Farben, tausend Lichter,
tausend Farben und Gesichter.
Und irgendwo dazwischen
Du!
(Philipp Poisel)
Inhalt
Der erste Satz
Schwarz-Weiß
Das Rapsfeld
Das gelbe Baby
Ich hasse Rot
Rotkäppchen
Meine violette Bluse
Das Veilchen
Das blaue Kleid
Das Festmahl (Karpfen blau)
Der blaue Schmetterling
Grün ist meine Lieblingsfarbe
Grüne Wiese – was ist das?
Die falsche Adresse
Eklig braune Haufen
Wunderschön braune Haut
Graue Eminenz
Bunt ziemt sich nicht
Trauer
Das schwarze Ungeheuer
Mein Heimatort
Der bunte Schornstein
Bunter Herbst
Die Glocke aus Bronze
Die Medaille
Silberstadt Freiberg
Silberhochzeit
Der goldene Käfig
Goldmarie
Weiß ist die hellste aller Farben und steht für Reinheit, Unschuld, Hochzeit und Unsterblichkeit.
Ganz in Weiß – so gehst du neben mir
und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir.
Ja, dann reichst du mir die Hand
und du siehst so glücklich aus
ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß.
(Roy Black)
Der erste Satz
Ich weiß, worüber ich schreiben will, natürlich weiß ich das. Ich weiß nur nicht, wie ich anfangen soll, mit welchem Wort, mit welchem Satz. Der erste Satz ist der wichtigste habe ich gelernt. Allein mit diesem ersten Satz entscheidet sich, ob der Leser weiterliest oder meine Geschichte beiseite legt. Der erste Satz soll aufregend und spannend sein, darf sich nicht um das Wetter und auch nicht um so etwas Schnödes wie den Alltag drehen.
Dabei liebe ich ausgerechnet das Alltägliche, das oft gar nicht so alltäglich ist. In jedem Alltag gibt es besondere Momente, worüber ich ganze Geschichten schreiben kann. Ich schreibe sehr gern Geschichten. In allen erzähle ich von Liebe und Hass, Geburt und Tod, Vertrauen und Betrug – es geht um das Leben, das lustig oder traurig, hässlich oder schön ist.
Doch jetzt sitze ich vor einem weißen Blatt Papier, das mir grell vom Bildschirm entgegen blendet. Ich suche nach diesem ersten so wichtigen Satz. Er muss unbedingt außergewöhnlich sein, den Leser beeindrucken, packen und direkt überwältigen. Das ist nicht so einfach, denn ich soll einen Artikel über einen Wettbewerb schreiben, einen Kuchen-Backwettbewerb. Der Initiator des Wettbewerbs ist gleichzeitig mein Auftraggeber und obendrein der beste Bäcker der Stadt – sagt er. Ich kaufe meinen Kuchen lieber bei einem anderen Bäcker oder backe ihn selbst.
Das sollte ich wohl besser nicht schreiben. Dieser Bäcker beschimpft alles, was nicht aus seiner Backstube kommt, als „Dreck“. Sollte sich einer nicht an seine Rezepte halten, wäre es kein wirklicher Kuchen, sondern ein Verstoß gegen die Regeln, der zum Ausschluss führt. Dass sich jeder Kuchenbäcker an vorgegebene Rezepte halten muss, werde ich erwähnen – aber nicht, dass ich selbst nur nach Gefühl backe. Mich würde dieser Bäcker wohl nicht in seiner Gruppe haben wollen. Ich frage zu viel. Dieser Bäcker erträgt keine Fragen, die setzt er mit Zweifel und Widerspruch gleich. Das habe ich gemerkt, als eine Teilnehmerin die Zutaten einfach gleichzeitig in die Schüssel gab. Der Bäcker schlug die Hände über dem Kopf zusammen und schrie: „Um Himmels Willen! Du MUSST zuerst die weiche Butter mit dem Zucker verrühren, bis alles eine weißschaumige Masse ergibt, erst dann kommen nach und nach die Eier dazu, zum Schluss löffelweise das gesiebte Mehl.“
„Ich mache das immer so“, sagte die Frau leise.
„Dann hast du es eben immer falsch gemacht“, schnauzte der Bäcker.
„Aber warum ...“ Weiter kam die Frau nicht.
Der Bäcker lief im Gesicht krebsrot an. „Willst du mich beleidigen? Ständig hast du etwas zu entgegnen! Du bist nicht in der Lage, dich in die Gruppe einzufügen. Du kannst nicht einmal einen Rat annehmen.“
Die Frau war schon älter, viel älter sogar als dieser Bäcker. Sie erzählte mir von ihrer großen Familie mit sechs Kindern, 14 Enkeln und einem Urenkelchen und davon, dass alle an den Wochenenden zusammenkommen. Sie backt deshalb jeden Freitag zwei Kuchen.
Der Bäcker interessierte sich nicht für diese Geschichte. Er ärgerte sich über die Frau, die die Zutaten ohne abzuwiegen in die Schüssel gab. Das wäre ein klarer Regelverstoß und bei einer Wiederholung oder dem nächsten Widerwort würde er sie sofort hinauswerfen.
Die alte Frau blieb ruhig. Ihre Gelassenheit imponierte mir, während ich mich heftig über den Bäcker ärgerte.
Ich schreibe nicht nur gern, ich lese sehr viel und liebe Bücher. Das sieht jeder sofort, der in meine Wohnung kommt. Außer im Bad habe ich in jedem Zimmer Regale bis an die Decke voller Bücher, die ich alle gelesen habe. Doch nicht alle Bücher lesen sich gut. Und kaum eine der Geschichten hat mich vom ersten Satz an begeistert. Keiner dieser Sätze war bedeutsam oder gar spektakulär, nicht einmal verblüffend oder beeindruckend.
Über den ersten Satz mache ich mir sehr wohl Gedanken, aber er hat für mich nicht solch eine schwerwiegende Bedeutung. Meist erzähle ich einfach los und beginne gern mit einem Dialog. Damit kann man seine Helden wunderbar vorstellen, deren Charakter und die Situation beschreiben, in der die Geschichte spielt. Das kann ich gut. Trotzdem sieht der Leser meinen Helden oft ganz anders als von mir geschildert. Wesenszüge, die ich mag, kann er vielleicht nicht ertragen. Er leidet oder freut sich an den „falschen“ Stellen. Immerhin ist er allein mit meinem Text, kann nichts hinzufügen und nichts weglassen. Er nimmt alles so hin wie ich es ihm darbiete, denn zwischen dem Verfasser und dem Leser gibt es nichts, keine Störung.
Schwieriger wird es, wenn meine Geschichte verfilmt wird. Da gibt es außer meinem Text und dem Leser viele Menschen, die die Geschichte verändern. Das beginnt bereits mit der Auswahl der Schauspieler, die möglicherweise anders aussehen und anders sprechen als von mir erdacht. Nein, ein Schauspiel widerspricht vollkommen meinem Ordnungssinn. Ich habe mir meine Geschichte ausgedacht und mit meinen ureigenen bedeutungsvollen Worten aufgeschrieben.
Doch jetzt suche ich nach meinem unvergleichlich eindrucksvollen ersten Satz, mit dem ich meinen Artikel über den Kuchen-Back-Wettbewerb beginne. Ich bin fest entschlossen, bei der Wahrheit zu bleiben, denn es soll keine Werbung für den Bäcker werden, sondern ein Bericht für die lokale Zeitung. Nun weiß ich, dass ich wieder mit einem Dialog beginne:
„Das ist kein Kuchen!“, ruft der Bäcker empört.
Schwarz-Weiß
„Was ist? Warum schimpfst du so?“, will Frank wissen.
„Ach, meine Schwester hat mir Fotos gemailt.“
„Das ist doch schön.“
Sonja schnauft verächtlich. „Die Fotos aber nicht. Die sind alle nur schwarz-weiß.“
Sonjas Schwester Simone ist Fotografin. Keine gewöhnliche Fotografin, sondern eine echte Künstlerin. Und Künstler knipsen nicht wie Sonja drauflos, sondern machen ein richtig gutes Foto. Es dauert immer schrecklich lange, bis Simone endlich auf den Auslöser drückt. Und das Ergebnis ist immer schwarz-weiß.
Auf dem Bild steht Simones Tochter Luise hinter einer großen Torte und versucht, drei Kerzen auszublasen. Die Torte ist grau wie Luises Kleidchen. Auf dem nächsten Foto hält Luise einen großen schwarz-weiß-grauen Blumenstrauß im Arm und lacht in die Kamera. Man sieht die strahlenden Augen, aber man erkennt nicht, dass sie grün sind.
Simone ist davon überzeugt, durch das Entfernen der Farbe Schwerpunkte auf Licht und Schatten, auf Kontraste, Formen und Strukturen zu lenken. Sie meint, der Betrachter würde von Farben abgelenkt.
Deshalb schenkte sie Sonja einen künstlerisch wertvollen Fotokalender. Auf jeder Seite Luise in schwarz-weiß: im Januar auf dem Schlitten, im Februar im Faschingskostüm. Luise trug ein schwarz-graues Clown-Kostüm, ihr Gesicht zeigte einen großen weißen Mund mit schwarzem Rand, um die Augen riesige weiße Ovale mit schwarzen Brauen. Luise auf ihrem Dreirad oder auf einer Wiese inmitten schwarzweißer Blumen, beim Baden im See. Das Dezemberblatt zeigt Luise in einem grauen Kleidchen neben einem schwarzen Weihnachtsmann mit weißem Bart. Sonja mag solch einen Kalender nicht aufhängen, er stimmt sie traurig.
Sonja liebt Fotos. Sie wählt ihre schönsten aus und bestellt per Internet Papierabzüge. Diese klebt sie dann in ein Album und schreibt einen passenden Text dazu. Von Luise klebt sie nur die Bilder ein, die sie bei den seltenen Besuchen selbst knipst. Natürlich in Farbe.
Sonja liebt Farben. Schwarz und Weiß sind keine Farben.
„Ich finde das Foto hübsch“, meint Frank.
„Die kleine Luise ist hübsch“, entgegnet Sonja.
„Das Bild ist grauenhaft, grau wie grauenhaft. Erinnerst du dich an Luises ersten Geburtstag? Sie trug einen weißen Pulli und einen schwarzen Kleiderrock, dazu weiße Strumpfhosen und schwarze Schuhe.“
„Na und? Reine Geschmackssache“, winkt Frank ab.
„Schwarz hat nichts mit Geschmack zu tun. Schwarz steht für Trauer. Allein dafür habe ich eine schwarz-weiße Bluse und schwarze Wäsche im Schrank.“
„Jetzt übertreibst du aber. Und ich sage dir noch etwas: dein Schwarz-Weiß-Denken ist krank.“
„Wie meinst du das?“
„Na, für dich ist eine Sache entweder richtig oder falsch, gut oder böse.“
„Man muss sich entscheiden können. Ja oder nein. Ich mag das oder ich mag das nicht.“
„Und was magst du lieber?“, will Frank wissen.
„Schwarz oder Weiß?“
„Weiß natürlich. Wie ein leeres weißes Blatt, worauf ich etwas schreiben oder malen kann.“
„Dann ist es aber nicht mehr weiß.“
„Eben. Genau deshalb.“
Frank zuckt mit der Schulter. Es hat keinen Sinn, mit Sonja zu streiten. Er steht auf und geht in die Küche. „Ich mache jetzt Kaffee.“ Dann setzt er lachend hinzu: „Willst du deinen Kaffee schwarz oder weiß?“
GELB ist eine warme Farbe, man denkt an Sonne und Licht. Gelb steht für Wachheit, Kreativität und einen schnellen Verstand. Sie wird aber auch mit Neid, Feigheit und Verrat in Verbindung gebracht.
Willst du mir eine Sonne malen?
Schön groß und gelb und rund
mit wunderschönen Sonnenstrahlen
und einem lachend roten Mund.
(Petra Weise)
Das Rapsfeld
„Gelb ist die allerallerschönste Farbe der Welt“, stellt mein Enkel Fabian fest.
„Deshalb malst du wohl so gern die Sonne?“, will ich wissen.
Wenn Fabian malt, malt er zuerst eine dicke gelbe Sonne oben rechts in die Ecke. Und er malt ihr zwei Augen, eine Nase und einen großen lachenden Mund.
„Woher weißt du eigentlich, dass die Sonne lacht?“
„Na, du sagst doch immer: schau, wie die Sonne lacht.“
„Da hast du recht“, stimme ich Fabian zu.
„Und welche gelben Sachen gefallen dir noch?“; nehme ich das Gespräch wieder auf.
„Die schönen Haare von Mama.“
Ich streiche Fabian über seine blonden Locken und gebe ihm einen dicken Kuss.
„Und das Postauto. Und meine gelbe Jacke. Und der Raps.“ Er zeigt auf sein Blatt, das voller gelber Striche und Kreise ist und offenbar ein Rapsfeld darstellen soll.
Rapsfeld. Ich seufze. Früher mochte ich die leuchtend gelben Rapsfelder sehr, doch seit dem furchtbaren Unglück vor vier Jahren kann ich sie nicht mehr ersehen. Mein Neffe fuhr damals die Dorfstraße hinauf, wo gerade wunderbar der Raps blühte. Aus dem Feldweg kam der kleine Ralf auf seinem Fahrrad. Der Raps stand so hoch, dass Ralf das Auto nicht kommen sah und mein Neffe den Jungen nicht. Ralf starb noch am Unfallort. Mein Neffe hat sich von diesem schrecklichen Erlebnis nie ganz erholt. Und ich muss seitdem bei jedem Rapsfeld an meinen Neffen und den kleinen toten Jungen denken.
„Mama? Träumst du?“ Erschrocken schaue ich auf. Vor mir steht meine Tochter Gabi. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich sie gar nicht kommen hörte.
„Alles in Ordnung? Ich nehme Fabian mit.“
„Wollt ihr nicht mit zu Abend essen?“
Meine Tochter schüttelt den Kopf. „Nein, wir haben noch was vor. Das Kindermädchen passt auf den Kleinen auf.“
„Warum lässt du Fabi nicht einfach hier? Er kann hier schlafen und du sagst dem Kindermädchen ab.“
„Juhuu!“, jubelt Fabian. „Ich bleibe bei der Omi! Ich darf hier schlafen.“
Gabi überlegt kurz, doch sie schüttelt wieder den Kopf. „Nein, Mama. Das ist jetzt so abgesprochen.“
Spät am Abend klingelt mein Telefon.
„Fabi ist weg.“ Die Stimme meiner Tochter klingt seltsam fremd.
„Wie spät ist es?“ Ich merke, dass das eine dumme Frage ist.
„Mama, kannst du kommen? Sofort?“
Ich nicke, obwohl Gabi das nicht sehen kann, ziehe mir schnell den Mantel über und fahre die wenigen Kilometer bis zu ihrem Haus. Schon von weitem blinken mir Blaulichter von vielen Polizeiwagen entgegen. Sie beleuchten gespenstisch die schwarzen Uniformen der unzähligen, auf der Straße stehenden Beamten. Ein Polizist versperrt mir den Zugang zum Haus.
„Ich bin die Oma, Fabians Oma, ich muss hinein und meiner Tochter beistehen.“
Jetzt darf ich ins Haus. Im Flur neben dem Telefon sitzt ein Polizist. Neben ihm hockt zitternd Gabi.
„Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht“, murmelt sie immer und immer wieder. Mich bemerkt sie gar nicht. Ich kauere mich neben sie und lege ihr meine Hände auf die Knie. „Mama, was soll ich nur tun?“, schluchzt sie.
Ich streichle über ihre Arme. „Alles wird gut, ganz bestimmt.“
Torsten, mein Schwiegersohn, nimmt mir den Mantel ab und führt mich ins Wohnzimmer. Er berichtet hastig, als wolle er alles schnell hinter sich bringen.
„Als wir nach Hause kamen, schaute Marlene, das Kindermädchen, einen Film. Sie versicherte mir, dass alles in Ordnung wäre und ich gab ihr die zehn Euro fürs Aufpassen. Inzwischen rannte Gabi hoch ins Kinderzimmer. Dort hörte ich sie herumlaufen und schließlich nach Fabi schreien. Sie schrie immer lauter. Er war nicht in seinem Bett und auch nicht im Bad. Wir haben das ganze Haus abgesucht und in alle Schränke geschaut, doch den Jungen fanden wir nicht. Dann habe ich gesehen, dass seine Jacke fehlt und sofort die Polizei angerufen. Die sind recht schnell gekommen und haben am Telefon eine Fangschaltung installiert.“
Verwundert schaue ich Torsten an.
„Falls Fabi entführt wurde und sich jemand mit einer Forderung meldet.“
Jetzt bin ich wirklich erschrocken. Fabian entführt? Gabi und ihr Mann haben nicht mehr Geld als andere Leute auch. Dem Jungen wird langweilig geworden sein und er ist einfach hinaus gegangen. So ein kleiner Frechdachs. Doch an seine Jacke hat er immerhin gedacht. Am liebsten würde ich gleich hinauslaufen und den Jungen suchen. Doch ich kann Gabi unmöglich hier allein lassen.
„Ich werde euch jetzt einen Tee kochen“, verkünde ich und gehe entschlossen in die Küche.
Torsten läuft mir nach. „Bleibst du hier bei Gabi? Ich kann hier nicht herumsitzen, ich will suchen helfen.“
Ich nicke, setze Teewasser auf und gehe zurück in den Flur. Dort kauert Gabi immer noch mit angezogenen Beinen neben dem Polizisten und jammert leise vor sich hin. Ich fasse sie unter dem Ellenbogen und ziehe sie sanft nach oben.
„Komm, mein Kind, wir trinken jetzt einen Tee. Der wärmt uns durch und beruhigt.“
Gabi nickt, doch ihre weit aufgerissenen Augen zeigen mir deutlich, dass sie sich nicht beruhigen würde. Genau in diesem Moment kommt unser Dorfarzt zur Tür herein. Erleichtert grüße ich ihn. Er gibt Gabi eine Spritze und empfiehlt ihr, sich ins Bett zu legen.
„Nein!“, schreit sie hysterisch. „Ich bleibe hier. Ich will nicht schlafen. Was haben Sie mir gegeben?“
„Nur etwas zur Beruhigung.“
Ich nicke dem Arzt zu. Er verabschiedet sich und verspricht, in einer Stunde noch einmal vorbei zu schauen. Ich führe Gabi zum Sofa und drücke ihr die Tasse Tee in die Hand. Sie zittert und ich muss sie halten. Ich setze mich in den Sessel neben sie und streichle wieder ihre Arme. Schließlich schläft Gabi ein.
Nun laufe ich nach draußen und sehe, dass die Polizisten eine breite Kette gebildet haben und über die Wiesen hinunter zum Wald laufen. Der Wald endete am Fluss, der noch Hochwasser von der Schneeschmelze oben im Gebirge führt. Ich darf gar nicht daran denken, dass der kleine Fabian allein in den Wald und vielleicht sogar bis hinunter an den Fluss gelaufen sein könnte. Mir wird sofort schwindlig vor Angst.
Die Leute aus dem Dorf gehen auf der anderen Seite übers Feld den Hang hinauf. Sie bilden keine Kette, sondern kleine Gruppen. Ich eile ihnen hinterher, komme aber mit meinen alten Beinen nicht so schnell vorwärts. Ich höre die Anderen laut nach Fabian rufen, bis die Rufe immer leiser werden und schließlich in der Ferne ganz verschwinden.
Direkt neben dem Rapsfeld bleibe ich stehen und muss verschnaufen. Mir fehlt schnell die Luft, wenn ich mich so beeile. Am liebsten würde ich mich hinsetzen. Doch ich fürchte, nicht wieder hoch zu kommen. Schließlich entdecke ich einen Baumstumpf, auf den ich mich hocke. Ich hatte in der Eile nicht an eine Taschenlampe gedacht, doch es ist trotz der späten Stunde nicht stockdunkel. Ich schaue nach oben. Man kann Wolken erkennen und den Mond. Er leuchtet hell wie eine Laterne und der Raps gibt das Licht fast gespenstisch zurück. Mir ist zum Weinen zumute. Ich mag mir nicht vorstellen, dass dem kleinen Fabian etwas zugestoßen sein könnte. Er ist erst vier Jahre alt. Man muss den Jungen ständig im Auge behalten, er ist unermüdlich auf seinen kleinen Beinen unterwegs und will seine Welt entdecken. Ich liebe ihn sehr und bete in Gedanken, dass er bald gefunden wird.
Plötzlich höre ich ein leises Wimmern. Mir ist ein wenig unheimlich zumute so allein mitten in der Nacht. Doch es ist vermutlich nur irgendein Tier, vielleicht eine Katze. Ich lausche angespannt, doch das Geräusch ist verschwunden. Da höre ich es wieder. Fast klingt es wie Weinen, das Schluchzen eines Kindes. Ich springe auf.
„Fabian! Fabi! Bist du hier?“
Das Weinen wird lauter. Nun bin ich mir sicher, ein Kind zu hören.
„Fabi! Hier ist die Oma. Hörst du mich?“ Ich lege meine Hand wie einen Trichter an mein Ohr. Doch es bleibt still und ich glaube schon, mich narren meine Gedanken und Ängste. Da höre ich es wieder, das Weinen. Ich versuche, genau die Richtung zu finden, in der ich das Weinen vermute und halte nach jedem Schritt immer wieder inne, um mich zu orientieren.
Schließlich stehe ich vor einem gelben Häufchen mitten im Rapsfeld. Ich erkenne sofort Fabians Jacke und kauere mich neben ihn. Ich umfasse das Bündel, nehme es fest in meine Arme und wiege es hin und her - bis das Weinen aufhört.
„Mein kleiner Mann, du musst nicht mehr weinen. Die Oma ist hier und bringt dich zurück zu Mama und Papa.“
Ich drücke Fabian an mich, der schließlich seinen Kopf hebt und die Arme um meinen Hals schlingt. Nun wird alles gut. Ich suche in meinen Taschen nach dem Handy, kann es aber nicht finden. Ich verfluche meine Angewohnheit, es daheim immer sofort aus der Tasche zu nehmen, auszuschalten und ins Schubfach zu legen. Also nehme ich den Jungen auf den Arm und trage ihn aus dem Rapsfeld hinaus auf den Weg, zurück zum Haus und lege ihn neben Gabi aufs Sofa.
Das gelbe Baby
aus „Ein halbes Leben“
29. Februar 1986. „Manfred, ich glaube, es geht los.“ Susi rüttelte an Manfreds Schulter.
„Was?“ Schlaftrunken richtete sich Manfred im Bett auf und schaute auf die Uhr. Drei Uhr mitten in der Nacht.
„Das Baby. Ich glaube, das Baby kommt.“
„Gut. Du ziehst dich in Ruhe an und ich laufe schnell rüber zu meiner Mutter.“
Manfreds Mutter war Hebamme und sollte bei der Geburt helfen.
„In einer halben Stunde bin ich zurück und bringe dich in die Klinik.“
Die nächste Telefonzelle, von der aus man einen Krankenwagen rufen konnte, war weiter entfernt als die Klinik selbst. Also gingen sie zu Fuß und stapften durch den tiefen Pulverschnee, der leicht wie Luft war. Susi krallte sich in Manfreds Arm, um nicht zu fallen.
„Heute ist der 29. Februar. Ist das nicht lustig? Diesen Tag gibt es nur aller vier Jahre. Außerdem ist heute Sonntag. Unser Kind wird ein Sonntagskind, ein glückliches Kind, ein fröhliches Kind, das uns nur Freude macht“, plapperte Susi ohne Pause und versuchte, ihre Angst wegzureden.
Noch vor Sonnenaufgang war die kleine Anett geboren. Anett bedeutet die Anmutige, ein wunderschöner Name. Susi war glücklich und schlief erschöpft ein.
„Wach auf!“ Manfreds Mutter rüttelte an Susis Schulter. „Du musst mir jetzt gut zuhören.“
Susi öffnete lächelnd die Augen und schaute in das ernste Gesicht ihrer Schwiegermutter.
„Ist etwas nicht in Ordnung?“, fragte sie besorgt.
„Wir haben dein Baby in die Kinderklinik geschickt. Das Blut soll ausgetauscht werden“, erklärte Manfreds Mutter.
Susi fuhr hoch. „Warum?“
„Es ist ganz gelb.“
„Mein Kind ist gelb? Was bedeutet das?“
Die Schwiegermutter zuckte unsicher mit der Schulter. Susi geriet in Panik. Plötzlich fiel ihr etwas ein. „Dein Mann und deine Tochter haben auch eine gelbe Haut. Hast du das dem Arzt nicht gesagt?“
Vater und Schwester von Manfred hatten eine auffallend dunkle Hautfarbe, die leicht gelb schimmerte. Für Manfreds Vater war das im Krieg ein großes Glück, denn die Ärzte glaubten an eine Gelbsucht und steckten ihn viele Monate in ein Lazarett. Manfreds Schwester wurde bei jedem Arztbesuch auf ihre gelbe Haut angesprochen und gründlich untersucht. Aber keine dieser Untersuchungen ergaben eine Gelbsucht oder eine andere Leberkrankheit.
„Mein Kind ist nicht krank. Es hat die gelbe Hautfarbe nur geerbt!“ Susi weinte. Sie glaubte nicht daran, dass den Ärzten der Blutaustausch ausreicht. Sie würden weiter nach einer Ursache suchen, die es vielleicht gar nicht gab. Vor ihrem inneren Auge sah sie ihr kleines Baby zwischen großen medizinischen Geräten und fühlte, wie es vor Schmerzen schrie.
Da Sonntag und somit Besuchstag war, durfte Manfred fast eine Stunde lang Susi im Arm halten und trösten. „Alles wird gut“, versprach er, aber seine Stimme hörte sich dünn an.
Die anderen sieben Frauen im Zimmer lachten viel, die Schwestern trugen lustig bunte Papierhütchen, denn es war Fasching.
Daheim schoss die Muttermilch in Susis Brüste, die extrem anschwollen und entsetzlich schmerzten. Susi band die riesigen Brüste mit zwei Windeln nach oben und knotete die Enden hinter dem Hals zusammen. Alles schien ihr auf einmal unerträglich.