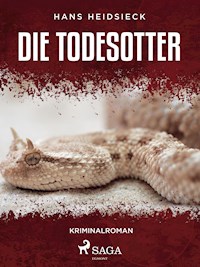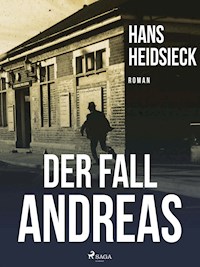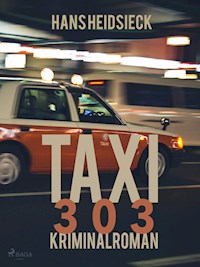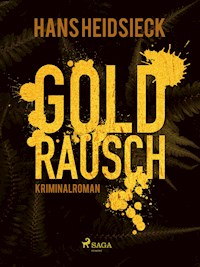
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im südlichen Brasilien liegt das sumpfige, undurchdringliche Urwald- und Buschgebiet des Mato Grosso. Dort wurde überraschend Gold gefunden, und sogleich machen sich allerlei abenteuerliche und zwielichtige Gestalten auf den Weg in die Wildnis, um das schnelle Glück zu finden. Barreto, der Aufkäufer des Gold-Landes tief im Mato Grosso, ist selbst nicht vom Goldrausch erfasst. Er versucht mit eiserner Energie, die Ordnung aufrechtzuerhalten und die Unruheherde einzudämmen. Da jedoch wird sein Bruder Emilio heimtückisch ermordet. Barreto zieht zur Aufklärung den Kommissar Braun hinzu. Es beginnt ein aufregender Wirbel voll drückend heißer Spannung einerseits und kühler und scharfsinniger Überlegung und Kombination andererseits. Und dann spielt da noch die Liebe eine nicht ganz unbedeutende Rolle ... Harry Hoff (alias Hans Heidsieck) ist mit "Gold-Rausch" ein exotischer Krimi gelungen, der den Leser von der ersten bis zur letzten Seite in seinem Bann hält.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Heidsieck
Goldrausch
Kriminalroman
Saga
Goldrausch
German
© 1941 Hans Heidsieck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711508619
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Der Polizeichef von Coyaba fuhr erschrocken zusammen. Ein Mann hatte die Tür aufgerissen und stürmte polternd zu ihm herein. Es handelte sich um einen großen, stämmigen Menschen mit gebräuntem Gesicht und scharfen, verwitterten Zügen. Die klugen, lebhaften Augen waren fest auf den Polizeigewaltigen gerichtet. Dieser erhob sich und trat dem stürmischen Eindringling finster entgegen.
„Was wünschen Sie, Senhor Barreto? Man pflegt bei mir anzuklopfen, bevor man ins Zimmer tritt. Wie konnte man Sie überhaupt ohne Anmeldung zu mir herauflassen?“
Barreto kniff unwirsch die Augen zusammen. „Wie? Was? Herauflassen? Ich habe den Zerberos, der unten am Tor stand, einfach zur Seite gefegt. Mit ihren Anmeldeformalitäten mögen Sie andere schikanieren, Senhor Orechas! Für derartige Spielereien habe ich keine Zeit, auch nicht zum Anklopfen. In diesen Dingen müssen Sie mich schon so hinnehmen, wie ich bin. Pronto. Kommen wir lieber sofort zur Sache.“
Major Orechas trat hinter seinen Schreibtisch zurück, wo er stehenblieb, um ein Aktenstück zuzuklappen, in dem er eben gelesen hatte. Die Falte des Unmuts auf seiner Stirn glättete sich. Er sah wohl ein: bei diesem Mann blieb ihm nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Barreto war nicht der Mann, der sich Vorschriften machen oder durch irgendwelche Formalitäten in seinem Handeln beirren ließ. Er kannte diesen Draufgänger nur zu gut, der etwas von den ehemaligen Konquistadoren des 16. Jahrhunderts an sich hatte, jener tapferen Eroberernaturen, die oft ohne jede staatliche Hilfe die Länder des ehemals spanischen Amerikas unterwarfen. Hatte Barreto nicht sogar einmal behauptet, der Abkömmling eines dieser Männer zu sein?
„Also, was haben Sie?“ fragt Orechas um einen Ton freundlicher. „Ist etwas Besonderes geschehen?“
„Jawohl. Ich komme, um von Ihnen tatkräftige Unterstützung zu fordern. Mein Bruder Emilio ist gestern ermordet worden.“
Der Major horcht betroffen auf. „Ihr Bruder Emilio?“
„Ja!“ erwiderte Barreto dumpf und starrte zu Boden.
„Von wem?“
Barreto lachte verzweifelt. „Wenn ich das wüßte, brauchte ich nicht zu Ihnen zu kommen. Das geht so nicht weiter in meinem Distrikt. Die zehn Polizisten, die Sie mir damals geschickt haben, mögen wohl einigermaßen für Ordnung sorgen. Doch zur Bekämpfung oder zur Aufdeckung eines gemeinen Verbrechens, das sich im Dunkeln abgespielt hat, reicht das noch lange nicht aus. Sie wissen, daß ich ein gerader, offener Mensch bin, Cavalheiro, und daß ich in meinem Gebiet, in dem ich ja auch die Polizeigewalt innehabe, nichts dulde, was gegen die Gesetze verstößt. Es werden Ihnen auch schon genügend Beispiele dafür zu Ohren gekommen sein. Aber schließlich bin ich kein Kriminalkommissar, und es fehlt mir auch wirklich die Zeit dazu, mich mit langen Nachforschungsarbeiten abzugeben. Kurz und bündig: ich verlange von Ihnen, daß mir jetzt auch noch ein kriminalistisch geschulter Beamter zur Verfügung gestellt wird.“
Orechas deutete höflich auf einen Stuhl. „Setzen wir uns. Tja — wenn es sich allerdings so verhält — —“
Er wurde unterbrochen. Es hatte geklopft, und eine junge Dame trat ein, bei deren Anblick Barreto sofort wieder aufstand, während Orechas ruhig sitzenblieb.
„Oh, Verzeihung, ich störe wohl?“ sagte eine liebliche Stimme, „ich wußte nicht, daß du Besuch hast, Onkel Bernardo!“
Der Major machte seine Nichte Eliza mit Barreto bekannt. Sie horchte auf, als sie Barretos Namen hörte. „Sie also sind es?“ sagte sie lebhaft, „der ‚Herr des Goldes‘, wie man Sie überall nennt. Welch ein Zufall, daß wir uns hier schon kennenlernen. Nun werden wir uns ja öfter sehen.“
„Wieso?“ fragte Orechas betroffen und sah seine Nichte an, „was soll das heißen, Eliza?“
Das hübsche Mädchen wiegte sich in den Hüften und lächelte. „Also weißt du noch nicht, daß Papa und ich bald nach Serra Ouro gehen?“
Barreto trat, während sich der Major erst von seinem Staunen erholen mußte, einen Schritt auf das Mädchen zu. „Verzeihen Sie“, sagte er, „aber nach Serra Ouro kommt kein Mensch ohne meine ausdrückliche Genehmigung.“
Elizas Lächeln ging in ein helles, melodisches Lachen über. „Das weiß ich auch, Cavalheiro“, erwiderte sie, „aber Ihre werte Genehmigung haben wir schon.“
Barreto starrte sie an, mehr wohl, weil er über ihre Schönheit betroffen war, als aus Verwunderung. „Ich wüßte nicht“, sagte er.
„Dabei haben Sie gestern erst meinem Vater einen zusagenden Bescheid übermitteln lassen.“
„Wer ist Ihr Vater?“
„Senhor Lobato.“
Barreto fuhr unwillkürlich zusammen. „Wahrhaftig — natürlich. Ja, jetzt entsinne ich mich. Ihr Vater will eine Bank eröffnen. Das ist auch ganz angebracht nach der Entwicklung der letzten drei Monate. Und Sie wollen mit in diese furchtbare Einsamkeit?“
Eliza blickte ihn fragend an. „Ich denke, Sie haben dort eine Stadt aus dem Boden gestampft.“ Barreto lachte rauh auf. „Wenn Sie ein flüchtig zusammengezimmertes Barackenlager eine Stadt nennen wollen, dann haben Sie allerdings recht, Menina. Sie stellen sich das alles wahrscheinlich viel besser und schöner vor, als es ist.“
„Nein, durchaus nicht. Vater hat mir auch schon davon erzählt und hat mich davon abhalten wollen. Aber ich möchte trotzdem hin. Ich möchte etwas erleben.“
Orechas, der bisher nur zugehört hatte, mischte sich ein. „Ich verstehe deinen Vater nicht“, meinte er, „solch ein junges Ding wie du gehört nicht in eine solche Wildnis hinein. Aber er muß schließlich wissen, was er zu tun und zu lassen hat. — Was führt dich nun her, mein Kind?“
„Ich wollte dir eben erzählen — ich wollte dir gerade das sagen, worüber wir eben gesprochen haben.“
Das Telefon klingelte. Der Major nahm den Hörer ab, horchte. „Wie“, rief er in die Muschel hinein. „Senhor Braun ist schon angekommen? Das paßt ausgezeichnet. Schicken Sie ihn zu mir herauf!“
Er wandte sich wiederum seiner Nichte zu. „Nun mußt du entschuldigen, wenn ich dich bitte, uns wieder allein zu lassen, Eliza!“ bemerkte er, „wir haben noch wichtiges zu besprechen. Sage dem Vater, daß ich ihn grüßen lasse, und daß ich euch heute abend noch aufsuchen werde. Lebe wohl, mein Kind!“
Eliza trat auf Barreto zu, um sich von ihm zu verabschieden. In ihrem Blick lag eine stille Bewunderung, als sie ihm in die Augen blickte. Er drückte kräftig ihre zierliche Hand. „Leben Sie wohl, Menina. Und auf ein frohes Wiedersehen in Serra Ouro!“
Sie glaubte dem Ton seiner Stimme entnehmen zu können, daß dieser Wunsch nicht nur eine Phrase war.
Barreto war von der Tür, die er für Eliza geöffnet hatte, zurückgetreten und sagte zu dem Major mit erstaunter Stimme: „Wenn ich recht vernahm, lassen Sie jemanden zu sich kommen, ohne daß unsere Angelegenheit inzwischen erledigt wäre. Ich verstehe das nicht —“
Orechas lächelte und machte eine beschwichtigende Armbewegung. „Senhor Braun, der gleich eintreten wird“, sagt er, „ist der richtige Mann für Sie! Jedenfalls habe ich bisher nur Lobenswertes über diesen Kommissar zu hören bekommen.“
„Ach so — ein Kommissar?“
„Ja. Ein Deutsch-Brasilianer, den ich mir eigentlich selber verschrieben hatte. Da aber hier in Cuyaba augenblicklich nichts Besonderes vorliegt, werde ich Ihnen diesen Herrn überlassen. Wie ich schon andeutete, ist er von deutscher Abstammung, und die Deutschen sind gründlich, das wissen Sie.“
Barretos Züge hellten sich merklich auf. „Sie sind also bereit, meinen Wunsch zu erfüllen?“
Der Major lachte. „Wunsch? Das ist gut! Vorhin war es noch eine entschiedene Forderung! — Aber wo bleibt nur der Herr? Er müßte doch eigentlich längst schon hier oben sein.“
„Vielleicht wurde er unterwegs aufgehalten.“
„Möglich — Da ist er ja!“
Es hatte geklopft, und Braun trat ein. Er war ein schlanker, stattlicher Mensch mit frischem, hübschem Gesicht und offenen Zügen. Sein blondes, seidiges Haar war nach hinten zurückgestrichen. Barreto war sofort für ihn eingenommen.
Braun trat auf Orechas zu und meldete sich in vorschriftsmäßiger Weise, nachdem er Barreto freundlich grüßend zugenickt hatte.
„Nehmen Sie Platz, Kommissar!“ sagte Orechas und forderte auch Barreto auf, sich wieder hinzusetzen. Sie kommen uns wie gerufen, Herr Braun. Ich sage uns. Senhor Barreto hatte mich gerade gebeten, ihm einen tüchtigen Kommissar zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, daß Ihnen die Aufgabe, die ich Ihnen gleich übertragen möchte, willkommen sein wird.“
„Worum handelt es sich, Herr Major?“
„Der Bruder von Herrn Barreto ist gestern ermordet worden. Aber nicht hier, sondern in Serra Ouro, was soviel wie ‚der goldene Berg‘ bedeutet. Sie haben wohl von dieser Märchenstadt schon gehört?“
„Märchenstadt ist gut gesagt!“ fiel Barreto ein. „Wenn Sie es genau wissen wollen: ein elendes Barackenkonglomerat. Märchenhaft ist nur ihre Entstehungsgeschichte und alles, was drum und dran hängt.“
„So habe ich es ja auch gemeint“, sagte Orechas und strich sich über den kurzen Bart, „sicherlich hat man auch schon in Sao Paulo etwas davon zu hören bekommen, was, Braun?“
„Gewiß, Herr Major“, erwiderte der Kommissar, „dort laufen die tollsten Gerüchte um. Wenn es sich so verhält, wie erzählt wird —“
„Was erzählt man sich denn?“
„Daß im Quellgebiet des Rio Xingu ungeheure Goldfunde gemacht worden sind, daß aber alle Leute bitter enttäuscht worden seien, die geglaubt hatten, dort ohne große Mühe ihr Glück machen zu können.“
„So. Und warum?“ fragte Orechas.
„Ein kühner Unternehmer soll sofort das ganze Gebiet von der Regierung gepachtet haben und dort nur diejenigen zulassen, die ihm genehm sind.“
„Richtig. Und dieser Mann übt dort die höchste Gewalt aus. Sie sehen ihn vor sich: Senhor Barreto!“
Der Kommissar trat auf Barreto zu und drückte ihm kräftig die Hand. „Es freut mich, Sie kennenzulernen, Cavalheiro. Das war ein guter Gedanke von Ihnen. Wahrscheinlich bleibt dadurch Tausenden von Leuten eine bittere Enttäuschung erspart.“
„Und was noch erfreulicher ist“, meinte Orechas, unsere Provinz bleibt dadurch von einer Überschwemmung mit dem übelsten Gesindel aus aller Welt verschont. Ich besinne mich noch genau, wie es damals war, als in der Gegend von Diamantino die ersten großen Diamanten gefunden wurden. Da setzte ein Sturm ein — — es ist kaum zu beschreiben. Von überall kamen sie her — und was für welche! Glücksritter, Abenteurer, entwichene Sträflinge — man kann schon sagen: der Abschaum der Menschheit. Aus den Salpeterminen von Taracapa kamen sie, aus den Kupferminen von Chuquicamata und Serro de Pasco, aus den Ölfeldern von Maracaibo, Gesindel aus Rio, aus Montevideo, aus allen größeren Städten, zerlumpt, verkommen. Die ganze Habe der meisten war das, was sie auf dem Leibe trugen. Und so wollten sie mühelos reich werden allesamt ...“
Barreto nickte ernst. „Es ist ihnen übel bekommen“, bemerkte er, „viele sind unterwegs schon zugrundegegangen, fielen dem Klima, dem Hunger, Krankheiten und Schlangen zum Opfer. Ganze Trupps wurden von Indianern gestellt und bis zum letzten Mann aufgerieben. Unter den wenigen, die ihr Ziel erreichten, regierten Habsucht und Neid. Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung. Ein geregeltes und gesittetes Leben gab es nicht. Es gab nur das Recht des Stärkeren. Sehen Sie, meine Herren, eine Wiederholung solcher Zustände sollte diesmal vermieden werden. Der Einsicht einer hohen Regierungsstelle habe ich es zu verdanken, daß es bis zu einem gewissen Grade auch gelungen ist. Um so furchtbarer war es mir, als nun doch dieser Mord, und zudem noch an meinem eigenen Bruder, geschah. Hoffen wir, daß es Ihnen gelingt, Herr Kommissar, diesen Fall bald und vollkommen aufzuklären.“
„Haben Sie jemanden in Verdacht?“ fragte Braun und blickte Barreto forschend an.
„Nein. Eben nicht. Und doch muß sich unter den Leuten ein Mensch befinden, der aus Habsucht zum Mörder geworden ist.“
„Aus Habsucht?“
„Ja. Denn mein Bruder hatte gerade tags zuvor einen großen Goldklumpen entdeckt.“
„Dieses Gold ist verschwunden?“
„Ja.“
Braun sann einen Augenblick nach. Dann meinte er lebhaft: „Ich werde alles daran setzen, um den Mörder Ihres Herrn Bruders bald der strafenden Gerechtigkeit zuführen zu können.“
„Das freut mich, Herr Braun!“ erwiderte Barreto mit einem dankbaren Blick. „Wenn es Ihnen recht ist, können wir gleich zusammen zum Flugplatz fahren. Ich habe hier weiter nichts mehr zu tun.“
„Aber ich möchte doch noch einige Vorbereitungen treffen. Mein Gepäck befindet sich noch an der Bahn.“
„Das werden wir gleich mit abholen.“
Braun wurde verlegen. „Ich habe auch noch eine private Besprechung.“
„Ach — Verzeihung — — das ist etwas anderes. Wann können Sie frühestens auf dem Flugplatz sein?“
„Sagen wir — in anderthalb Stunden.“
„Gut. Einverstanden!“
Eliza hatte wie eine Träumende das Polizeigebäude verlassen. Sie wollte nach Hause fahren. Nein — wollte sie das? Hatte sie nicht versprochen —?
Sie vermochte ihre Gedanken nicht mehr richtig zu fassen. Dort, gegenüber in dem kleinen Caféhaus, hatte der Herr gesagt, möchte sie warten. Wer war dieser Herr? Wie war das alles gekommen? Warum hatte sie ihren Blick kaum von ihm abwenden können, als er ihr auf der Treppe begegnet war? Ihre Hände hatten gezittert, die Handtasche war ihr zu Boden gefallen. Er hatte sich rasch gebückt, alles aufgehoben und ihr dann lächelnd die Tasche gereicht.
„Oh — danke sehr, Cavalheiro. Ich weiß nicht — ich habe wohl diese Säule gestreift.“
„Glückliche Säule!“ hatte er schelmisch gesagt und sie so forsch dabei angeschaut, daß sie über und über errötet war. Sie hatte sich hastig entfernen wollen; aber sie war wie gebannt, es war, als ob sie durch seinen Blick gefesselt wäre. Plötzlich fragte sie: „Sind Sie etwa Herr Braun?“
Sie bemerkte, daß er maßlos erstaunt war. Woher kannte sie seinen Namen?
„Ja, ich bin Braun“, erwiderte er, „woher wissen Sie — —?“
„Sie wollen zu Herrn Major Orechas. Eine Treppe, vierte Tür links. Der Major erwartet Sie.“
„Ja, gewiß — aber — — darf ich Sie bitten — — hier gegenüber ist ein Café, wie ich eben bemerkt habe. Ich werde dorthin kommen, wenn ich hier fertig bin. Werden Sie dort sein?“
Seine Frage war mehr ein flehendes Bitten. Sie suchte den Blick von ihm zu lösen, doch es gelang ihr nicht. Endlich erwiderte sie mit kaum hörbarer Stimme: „Vielleicht!“
Braun nickte ihr strahlend zu. Hastig schritt er weiter die Treppe hinauf.
Nun stand Eliza auf der Straße und dachte an ihr „Vielleicht“. Es war keine Zusage. Bestimmt nicht. Sie hatte ihr Schicksal noch in der Hand. Oder doch schon nicht mehr —?
Sie überquerte gemessenen Schrittes den Fahrdamm und betrat das Café.
Barreto begab sich nach der Besprechung mit dem Major und Braun zu einem Bekannten, der Advokat war. Er tat dies eigentlich nur noch, um die Zeit auszufüllen. Aber dann fiel ihm ein, daß er gleichzeitig auch einige juristische Fragen aufrollen konnte, die sich für ihn aus dem Tode seines Bruders ergaben.
Doktor da Silva bewohnte eine sehr hübsche, moderne Villa am Rande der Stadt. Hier lebte er mit seiner Frau und seinen sechs Kindern als begehrter Jurist und zufriedener Ehemann. Barreto fühlte sich bei ihm stets wie zu Hause; das Glück des Familienlebens, das diese Menschen einspann, übte auch auf ihn stets eine erfrischende und belebende Wirkung aus.
Oft genug hatte da Silva ihn schon halb scherzend, halb ernst gefragt, ob er denn nicht endlich auch heiraten wolle. Ja — heiraten. Das war leicht gesagt — — wenn doch kein Mädel da ist, das einem so ganz gefällt! Er, Barreto, war eben sehr wählerisch. Außerdem war er stets so mit Arbeit und Plänen ausgefüllt — mein Gott —, schließlich hatte er allein sozusagen einen kleinen Staat ins Leben gerufen, nein, er hatte bisher wahrhaftig andere Sorgen gehabt. Bisher?
Während er mit dem Freunde den unvermeidlichen Kaffee schlürfte, kam er auf Lobato zu sprechen. „Der Mann wird in Serra Ouro ein Bankgeschäft aufmachen. Kennst du ihn auch?“
„Selbstverständlich“, erwiderte Silva, während er genießerisch an seiner Zigarre saugte. „Für ihn habe ich kürzlich erst einen Prozeß gewonnen. Ist ein tüchtiger Bankier. Vor einem Jahr starb seine Frau. Das ist ihm wohl recht nahe gegangen; denn seitdem lebt er ziemlich zurückgezogen.“
„Hat er nicht auch eine Tochter?“
„Eine? Vier. Und zwei Söhne. Aber außer der einen Tochter sind alle fort, bei Verwandten, teils in Rio, teils in Sao Paulo, soviel ich weiß. Übrigens sind seine Töchter alle recht hübsche Mädels. Zwei von ihnen haben sich glänzend verheiraten können. Der eine Sohn ist Marineoffizier. Der andere besucht die technische Hochschule.“
„Er ist mit dem hiesigen Polizeichef Orechas verwandt, nicht wahr?“
„Das ist möglich. Davon weiß ich allerdings nichts. Übrigens die Eliza, die eine Tochter, die sich noch hier befindet — das wäre tatsächlich eine Frau für dich!“
Barreto blickte an seinem Freund vorbei durchs Fenster hinaus. „So — meinst du?“
Da Silva wunderte sich, daß Barreto nicht gleich wieder ablenkte, wie er es sonst gewöhnlich tat, wenn auf diese Frage die Rede kam. „Ja“, meinte er lebhaft, „die müßtest du kennenlernen. So was von fraulicher Anmut und häuslichem Wesen habe ich wirklich selten kennengelernt — — oh, da, paß doch auf, deine Asche fällt ab!“
Barreto blickte erschrocken hoch. Seine Hand zitterte etwas, während er die Zigarre gerade noch abstreifen konnte. Er erhob sich. „Wahrscheinlich“, bemerkte er, „wird Senhor Lobato seine Tochter ja mitnehmen, und dann werde ich nicht versäumen, ihre nähere Bekanntschaft zu machen. — Aber jetzt muß ich eilen. Kommissar Braun erwartet mich auf dem Flugplatz.“
Die große Maschine, die Barreto zum regelmäßigen Verkehr zwischen Cuyaba, der Hauptstadt von Matto Grosso, und Serra Ouro eingesetzt hatte, zog brummend über die unendlichen Wälder hin, die das zu überfliegende Gebiet bedeckten. Aus größerer Höhe sah das wie ein riesiger grüner Teppich aus.
Die Luft war zum Ersticken heiß und von Feuchtigkeit durchsetzt. Man mußte sich immer wieder den Schweiß von der Stirn wischen.
Es ging auf den Abend zu. Bald mußte es dunkel werden, und die Dunkelheit fiel hier immer ganz plötzlich über das Land herein.
Braun saß neben Barreto und unterhielt sich mit ihm. Der Kommissar war sehr wißbegierig. Er hatte bisher nur in Sao Paulo und in Rio gelebt, wollte nun aber möglichst viel von den anderen Provinzen kennenlernen. Bevor er abreiste, hatte er sich nur oberflächlich über Matto Grosso unterrichtet. Er wußte, daß dies zwar der zweitgrößte, aber der am dünnsten bevölkerte Staat Brasiliens ist. Daß der Name „Matto Grosso“, was „dichter Wald“ bedeutet, zu Recht bestand, das hatte er jetzt augenscheinlich vor sich. Die Hauptstadt Cuyaba mit ihren fünfundvierzigtausend Einwohnern hatte er zwar, da er gleich weiter mußte, nur sehr flüchtig kennengelernt. Aber das war schließlich nachzuholen.
Auch das hier im nördlichen Teil der Provinz tropische Klima sollte er ja schon gleich gründlich kennenlernen. Teufel ja — war das hier eine Glut! Daran würde man sich erst gewöhnen müssen. Er entsann sich, gelesen zu haben, daß sich Matto Grosso über nicht weniger als sechzehn Längen- und Breitengrade erstreckt, und daß es dadurch schon in diesem einzelnen Staat die verschiedensten Klimaverhältnisse gab. Ein südlicheres wäre ihm lieber gewesen.
„Sie wollen also näheres über die Entdeckung des Goldberges wissen?“ fragte Barreto und bot dem Kommissar aus seiner Thermosflasche ein erfrischendes Eisgetränk an. „Nun, diese Entdeckung hat ein Tropeiro gemacht, einer jener Eselkarawanenführer, wie sie mit ihren Tieren hier allerwärts durch das Land ziehen, da es nur sehr wenige andere Transportmöglichkeiten gibt. Die auf dem Plateau von Matto Grosso entspringenden Flüsse sind in ihrem oberen Teil wegen der vielfachen Stromschnellen und Wasserfälle nicht schiffbar. Gerade jenes Gebiet, in das wir uns jetzt begeben, ist außerordentlich abgelegen.“
„Wohnen dort nicht die Bakairi?“
„Richtig — ein Indianerstamm aus der Gruppe der Karaiben.“
„Haben Sie keine Schwierigkeiten mit diesen Rothäuten?“
„Es sah erst so aus, als ob sie uns das Leben schwer machen wollten. Aber jetzt stehe ich mich mit ihrem Häuptling recht gut — nachdem ich erst einmal Feuer vom Himmel fallen ließ.“
„Bitte erklären Sie!“
„Als ich mit der ersten Expedition zum Goldberg kam — es war immerhin eine Strecke von über fünfhundert Kilometern durch teilweise dichtesten Urwald zurückzulegen — — kurzum, da haben sich die Bakairi zunächst ziemlich feindselig gezeigt. Wir sahen uns damals gezwungen, uns regelrecht zu verschanzen. Fünf meiner Leute sind durch giftige Pfeile getötet worden. Eine Maschinenpistole, die ich wohlweislich mitgenommen hatte, flößte jedoch den Leuten schon einen großen Respekt ein. Trotzdem verharrten sie zunächst in ihrer feindseligen Haltung und hielten uns eingeschlossen. Wir befanden uns wirklich in einer sehr kritischen Lage.“
„Und wie schlugen Sie sich wieder heraus?“
„Wir wären wahrscheinlich verloren gewesen, wenn ich nicht alles vorausgedacht und auch einen Funk-Sendeapparat mitgenommen hätte. Aber lassen Sie mich der Reihe nach erzählen. Ich knüpfte zunächst durch einen Dolmetscher Verhandlungen mit dem Häuptling der Indios an. Diese Verhandlungen gipfelten in einer furchtbaren Drohung meinerseits: wenn die Leute nicht nachgäben und uns friedlich abziehen ließen, würde ein großer metallener Vogel kommen und Feuer vom Himmel herabwerfen, das dann ihr ganzes Lager vernichten werde.
„Ah! Ich verstehe schon!“
„Ich trat also durch Funk mit meinem Bruder Emilio, der in Cuyaba zurückgeblieben war, in Verbindung und veranlaßte ihn, mir mit meinem Flugzeug zu Hilfe zu kommen. Die Indios hatten meinen Drohungen keinen Glauben geschenkt. Sie hatten wohl auch kaum jemals in ihrem Leben ein Flugzeug gesehen. Kurzum, als die Maschine donnernd über ihren Häuptern zu kreisen begann — wir hatten unser Lager durch eine Rauchwolke kenntlich gemacht — da brach unter ihnen eine furchtbare Panik aus.“
„Das kann ich mir vorstellen“, sagte Braun und lächelte in sich hinein.
„Mein Bruder warf über den Hütten der Indios nur eine einzige Brandbombe ab, die keinen größeren Schaden anrichtete, aber doch ihre Wirkung tat. Die Rothäute waren plötzlich wie umgewandelt, bekamen einen Heidenrespekt vor uns und wagten es vorläufig nicht mehr, auch nur in unsere Nähe zu kommen. So gelangten wir alle unbehelligt nach Cuyaba zurück. — Inzwischen habe ich mit dem Häuptling, der ‚Großen Feder‘, einen regelrechten Vertrag geschlossen. Heute zähle ich viele seiner Leute zu meinen treuesten und ergebensten Arbeitern.“
„Sie wollten noch von der Entdeckung des Goldberges sprechen. Ein Tropeiro, sagten Sie, war der Glückliche —? Haben dem denn die Indios nichts getan?“
„Nein. Er kam ja nur mit seinen paar Treibern und hatte sie durch alle möglichen Geschenke zu gewinnen verstanden. Durch diese wenigen Menschen fühlten sich die Indianer auch nicht bedroht; als dann aber meine große Expedition kam, glaubten sie wohl, daß ihnen der Garaus gemacht werden sollte.“
„Also der Tropeiro entdeckte das Gold —?“
„Ja. Ich war deshalb auch sofort für ihn eingenommen und sorgte dafür, daß die Entdeckung weiterhin ein Geheimnis blieb. Da der Mann, den ich schon seit längerer Zeit kannte, mir volles Vertrauen schenkte, und ich durch verschiedene Umstände in der Lage war, eine größere Expedition auszurüsten, taten wir uns beide zusammen. Heute ist er dort in Serra Ouro meine rechte Hand. Ja, ich möchte behaupten: wir sind sogar sehr gute Freunde geworden. Sie werden ihn kennenlernen Natürlich ist er schon ein schwerreicher Mann.“
„Das kann ich mir denken. Und Sie wohl auch, Senhor Barreto?“
Barreto schaute ernst vor sich nieder. „Ich kann es nicht abstreiten. Aber Sie irren sich, wenn Sie glauben, daß ich von einer Art Goldrausch erfaßt worden wäre. Das liegt nun einmal nicht in meiner Natur. Ich freue mich nur deshalb über den Reichtum, weil er mir die Möglichkeit gibt, weiterhin meinen Willen auf große Ziele zu richten und vieles zu schaffen, was mir sonst wohl kaum möglich gewesen wäre. Ich baue nun sozusagen dort mitten im Urwald eine neue Kultur auf; und das Erfreulichste ist, daß ich dabei die volle Unterstützung des Staates gefunden habe.“
„Sie sind also dort eine Art Generalgouverneur?“
Barreto lächelte abweisend. „Nein, ich bin nur ein kleiner Pächter und habe an die Regierung prozentuale Abgaben zu entrichten. Im übrigen läßt man mir allerdings vorerst völlig freie Hand. Mag schon sein, daß man mir organisatorisch allerlei zutraut. Ich darf wohl auch, ohne mich damit rühmen zu wollen, behaupten, daß es mir gelungen ist, auf diesem Gebiet allerlei zu leisten. — Aber das werden Sie ja sehen, wenn wir da sind.“
„Ich kann mir schon vorstellen, daß es zum Beispiel nicht leicht war, dort einen Flugplatz einzurichten.“
„Richtig. Das war wirklich nicht einfach. Aber es mußte geschehen, um eine brauchbare, rasche und sichere Verbindung mit der Außenwelt herzustellen.“
„Ganz recht.“
„Sehen Sie — mittlerweile ist es dunkel geworden. Aber wir können auch bei Dunkelheit sicher landen, da der Platz nachts hell erleuchtet ist. Sogar elektrisch.“
„Sie haben also auch schon ein Kraftwerk angelegt?“
„Alles. So primitiv wie früher in solchen Lagern geht es jetzt nicht mehr zu. Wir haben uns die moderne Technik zunutze gemacht. — In einer halben Stunde werden wir dort sein. Schauen Sie mal hinaus!“
Braun blickte durch das Fenster in eine schwarze, unabsehbare Tiefe. Doch oben am Himmel leuchteten die Sterne in einem flimmernden Glanz.
Barreto schaltete in der Kabine das Licht aus. „Gewöhnen Sie Ihr Auge erst an die Dunkelheit“, sagte er, „dann werden Sie noch etwas sehen.“
„Ja“, sagte Braun lebhaft, „dort drüben — ein kleiner Feuerschein.“
„Richtig. Das ist wohl ein Lagerfeuer. Nun schauen Sie einmal ein wenig weiter nach rechts. Da entdecken Sie einen schwachen silbernen Streifen.“
„Ein Flußlauf?“
„Ja, das ist einer der Flüsse, die hier entspringen. Und wenn Sie jetzt die Tür zum Führerstand öffnen und nach vorne blicken, werden Sie schon den Scheinwerfer entdecken, der uns die Richtung zeigt.“
Zwanzig Minuten später lief die Maschine auf dem Rollfeld des Flugplatzes aus. Geschäftige Männer sprangen herzu und halfen den Reisenden aus der Kabine. Andere begannen sofort, die Ladung aus dem Frachtraum zu löschen: Lebensmittelkisten, Maschinenteile, Medikamente und vieles andere.
Zwei Indios nahmen den beiden Herren das Gepäck ab. Bald darauf langte man vor dem Blockhaus Barretos an. Braun wurde hier als Gast aufgenommen.
Am folgenden Morgen setzte Kommissar Braun sogleich mit seinen Ermittlungen ein. Er ließ sich von dem Sergeanten, der bisher die zehn Polizisten angeführt hatte, den Tatort zeigen. Das war „Odowaldos Bar“, ein langgestrecktes einstöckiges Holzgebäude, in dem sich die Goldgräber abends nach getaner Arbeit bei einem Glase Bier, Wein oder Caxaxa (Schnaps) zu stärken pflegten, soweit sie die verschiedenen erfrischenden Eisgetränke aus Fruchtsäften nicht vorzogen.
Braun wurde durch den Sergeanten Berto Alimas mit Odowaldo, dem Besitzer der Bar, bekanntgemacht. Odowaldo war ein untersetzter Mulatte mit pergamentener, bräunlicher Haut. Seine rechte Backe war durch eine große, von einem Unfall herrührende Narbe in zwei Teile geteilt, so daß sein Gesicht einen verzerrten Eindruck machte.
„Nun erzählen Sie bitte mal, wie das gewesen ist“, sagte Braun. „Senhor Emilio hatte also in Ihrem Lokal gegessen.“
„Ja. Dann ging er einmal hinaus. Als er nach einer langen Weile nicht wiederkam, wurden wir unruhig und begannen, draußen Umschau zu halten. Wir leuchteten mit einem Taschenscheinwerfer den Hof ab. Da fanden wir ihn hinter dem Schuppen liegen, neben der Regentonne. Er hatte eine Schußwunde in der Stirn.“
„In der Stirn?“
„Ja, er war tot.“
„Ist er durch einen Arzt untersucht worden?“
„Gewiß. Dr. Marcello, der sich ebenfalls hier befand, untersuchte ihn auf der Stelle. Er konnte auch nur den Tod feststellen.“
„Sie sagten vorhin: wir suchten nach ihm. Wer ist noch mit Ihnen hinausgegangen?“
Odowaldo nannte verschiedene Männer, die, wie er behauptete, dem Ermordeten nahegestanden hatten. Braun stellte weitere Fragen und sah sich die Stelle an, wo Emilio, als man ihn fand, gelegen hatte. Er merkte bald, daß sich seine Nachforschungen sehr schwierig gestalten würden. Hier stand ihm kein großer Fahndungsapparat zur Verfügung, wie dies in den Städten der Fall war, ja, selbst an den einfachsten Hilfsmitteln fehlte es. Niemand war auf den Gedanken gekommen, die Leiche am Tatort zu fotografieren. Auch eine Sektion hatte nicht stattgefunden. Sergeant Alimas, der sich wohl als Kriminalist betätigen wollte, hatte die wenigen Spuren, die etwa vorhanden gewesen waren, eher verwischt als zutage gefördert. Aus den von Alimas vorgenommenen Zeugenvernehmungen ging nicht das Geringste hervor, was auf den Täter hinweisen konnte.
Angeblich hatte niemand mit dem Ermordeten zugleich oder auch kurz nach ihm das Lokal verlassen. Wichtig erschien dem Kommissar die Feststellung, daß Senhor Emilio seinen Freunden den Goldklumpen, der etwa Faustgröße besaß, gezeigt und sich schmunzelnd dieses schönen Fundes gerühmt hatte. Während Braun in dieser Handlung eine große Unvorsichtigkeit, wenn nicht gar einen bodenlosen Leichtsinn erblicken wollte, wurde er durch Odowaldo und auch durch den Sergeanten dahingehend belehrt, daß man eigentlich nichts dabei finden könne; denn es sei allen Goldsuchern geradezu zur Gewohnheit geworden, abends von ihren Funden zu erzählen und diese, wenn sie besonders ergiebig waren, auch vorzuzeigen.
Braun ersah daraus, daß hier mit ganz anderen Maßstäben gemessen wurde als anderswo. Er sah sich in eine ihm fremde Welt versetzt, die ihre eigenen Gewohnheiten und Gesetze besaß. Das Gold spielte hier nicht die Rolle, wie er es sich vorgestellt hatte. Gewiß drehte sich alles darum, aber trotzdem oder gerade deshalb, weil hier genug vorhanden war, spielte es an Ort und Stelle keine große Rolle. Die meisten trugen es in mehr oder weniger großen Körnern und Stücken lose in der Tasche herum. Man brauchte den Nachbarn nicht zu beneiden, man hatte ja selber genug davon, und täglich wurde neues gefunden. Wenn jemand — wie kürzlich Emilio — einen besonders großen Brocken entdeckt hatte, beglückwünschte man ihn neidlos dazu in dem Gedanken und in der frohen Erwartung, daß einem morgen selbst das gleiche Glück blühen könnte.
Aus dieser den Kommissar zunächst ganz sonderbar anmutenden Einstellung erwuchs für ihn eine Aufgabe, die nicht so leicht zu bewältigen war. Die Annahme eines Raubmordes erschien ihm wesentlich abgeschwächt. Andererseits: war nicht wirklich der Klumpen verschwunden, den Emilio bei sich getragen hatte? Er hatte ihn, bevor er die Stube verließ, wieder zu sich gesteckt.
Braun sah ein, daß er bei seiner Nachforschungsarbeit sehr weit ausgreifen mußte. Vorläufig stand er vor einem Nichts. Niemand hatte den Mörder gesehen, niemand konnte verdächtigt werden. Hätte er vielleicht schon seit längerer Zeit unter diesen Menschen gelebt, dann würde sich für ihn möglicherweise schon ein Anhaltspunkt ergeben haben. Vorläufig aber war ihm alles noch fremd und neu. Die anderen machten sich wenig Gedanken darüber. Nur die Empörung über das gemeine Verbrechen war allgemein. Daraus wiederum konnte der Kommissar entnehmen, daß er es hier nicht mit einer Gesellschaft von haltlosen und demoralisierten Abenteurern zu tun hatte, wie sie an solchen Stätten sonst immer zu finden waren. Es mußte sich tatsächlich so verhalten, daß Barreto die Menschen, die er hierherkommen und hier arbeiten ließ, gründlich ausgewählt hatte. Natürlich befanden sich auch viele Abenteurernaturen darunter, aber nur solche, gegen die man — ihrem Vorleben nach — nichts einwenden konnte. Ein Besuch in Barretos „Zentralbüro“ sollte den Kommissar bald überzeugen, mit welcher Strenge und Genauigkeit hier vorgegangen wurde. Barreto selbst zeigte ihm die ausgedehnte Kartothek, die von zwei jungen Stenotypistinnen verwaltet und auf dem laufenden gehalten wurde. Dazu gab der „Gouverneur“, wie er hier scherzhaft genannt wurde, folgende Erklärungen ab: