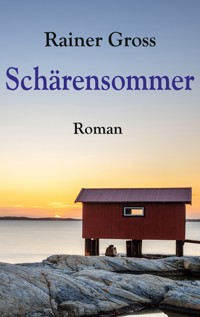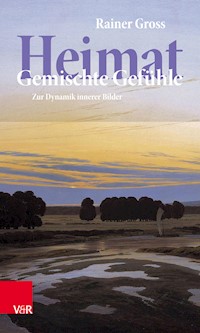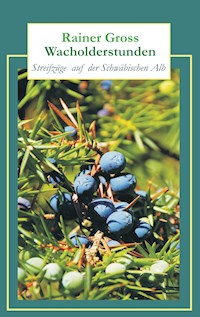Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Da ist ein Mann, geschieden, Mitte vierzig, Privatkundenberater in einer Genossenschaftsbank, der sein unauffälliges Leben in der Großstadt lebt. Eines Morgens hört er im Autoradio ein Lied, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht, das Lied von einer namenlosen Insel, die ihn willkommen heißt. Er kauft sich ein Südsee-Poster und hängt es zuhause auf. Er recherchiert über Polynesien und merkt, dass er sein ganzes Leben einen Traum gehegt hat: den Traum von einem anderen Leben, von Palmeninsel und Sandstrand, von einem Leben wie in den Ferien. Er fasst einen Entschluss und beginnt, Pläne zu schmieden. Er hält sich bedeckt und lässt sich nichts anmerken, aber sein Alltag ist nicht mehr derselbe. Die Pläne werden immer konkreter, bis er erkennt, dass ihm das nötige Geld fehlt. Doch auch das lässt sich beschaffen, wenn man nur entschlossen genug ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Da ist ein Mann, geschieden, Mitte vierzig, Privatkundenberater in einer Genossenschaftsbank, der sein unauffälliges Leben in der Großstadt lebt.
Eines Morgens hört er im Autoradio ein Lied, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht, das Lied von einer namenlosen Insel, die ihn willkommen heißt. Er kauft sich ein Südsee-Poster und hängt es zuhause auf. Er recherchiert über Polynesien und merkt, dass er sein ganzes Leben einen Traum gehegt hat: den Traum von einem anderen Leben, von Palmeninsel und Sandstrand, von einem Leben wie in den Ferien.
Er fasst einen Entschluss und beginnt, Pläne zu schmieden. Er hält sich bedeckt und lässt sich nichts anmerken, aber sein Alltag ist nicht mehr derselbe. Die Pläne werden immer konkreter, bis er erkennt, dass ihm das nötige Geld fehlt. Doch auch das lässt sich beschaffen, wenn man nur entschlossen genug ist.
Rainer Gross, Jahrgang 1962, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Er lebt mit seiner Frau seit 2002 als freier Schriftsteller bei Hamburg.
Bisher veröffentlicht: Grafeneck (Pendragon 2007, Glauser-Debüt-Preis 2008); Weiße Nächte (Pendragon 2008); Kettenacker (Pendragon 2011); Kelterblut (Europa 2012).
Bei BoD u.a. erschienen: Die Welt meiner Schwestern (2014); Das Glücksversprechen (2014); Yūomo (2014); Haus der Stille (2014); Abendzug nach Blankenese (2014); Schrödingers Kätzchen (2015); Drei Tage Wicklow (2015); Haut (2015); Der Traum der Delphine (2015); Halleluja (2015); Das Herz ist ein Reisender – Liebesgeschichten (2015); My sweet Lord (2016).
Für meinen Bruder
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1. Kapitel
Er fährt mit dem Wagen nach Hause. Halb sieben abends, es ist schon dunkel, die Lichter der Stadt leuchten auf. Der Himmel ist bedeckt und man sieht keine Sterne. Stockender Verkehr auf den feuchten Straßen, das Hupen der Autos dringt zu ihm ins Wageninnere. Abgasgeruch aus der Lüftung. Laubhaufen bedecken an manchen Stellen das gelbe Gras. Eine Großbaustelle und ihre riesigen Stahlgerüste, Umleitungen, Warnlampen, abgestellte Fahrzeuge wie Blechklötze, der Abend ist so trostlos wie jede Nacht in dieser Stadt. Passanten eilen, dick in Mäntel und Schals vermummt, vorbei, Atemwolken vor ihren Mündern, mit schnellen oder langsamen Schritten zu ihrem Ziel unterwegs oder ohne Ziel. Ein Labyrinth aus abendlicher Verlassenheit.
Im Radio wird eine Hitparade gespielt. Auf Platz zwei steht das Lied einer deutschen Rockband. Am Anfang Gitarrenmusik und Gesang. Englisch. Lass mich dich weit fort bringen. Du wünschst dir Ferien. Holiday. Das Lied gefällt ihm. Er dreht lauter. Sei willkommen auf der Insel ohne Namen. Die Heizung surrt, im Wagen ist es warm, sodass die beschlagenen Seitenfenster wieder frei werden. Er wartet geduldig, bis es weitergeht, nur um wieder zu stoppen. Laufender Motor, eine gewohnheitsmäßige Zigarette im Mundwinkel und hinter sich sein bisheriges Leben.
Halb sieben, wie immer, wie seit zwanzig Jahren. Seit zehn Jahren lebt er allein, geschieden, Kinder haben sie keine. Sonntags ist er manchmal zu ihr gefahren, sie haben Kaffee getrunken und über früher geredet. Später zog sie mit einem Anderen zusammen, seither sehen sie sich nicht mehr. Manchmal irren seine Gedanken ab, er sieht Bilder in seinem Kopf, wie jetzt, während das Lied läuft. Doch er will damit warten, bis er Ruhe hat. Manchmal denkt er an das Geld, das sich mit jeder Stunde seiner Arbeit auf seinem Konto anhäuft, nutzloses Geld, gedruckte Zahlen auf einem Zettel, der jeden Monat in seinem Briefkasten liegt und am Ende des Monats wieder so viel aufweist wie am Anfang. Manchmal kann er ein wenig sparen, zu wenig. Alles geht in Zeitdehnung vor sich, nur er verliert rasend.
Die Nutzlosigkeit holt ihn ein, jeden Augenblick seines Lebens aufs Neue, und er weiß, dass man Zeit nicht kaufen kann und er kein Geld hätte, sie zu bezahlen. Er hat nur Geld für diese Stadt und eine Ferienfahrt, an die Nordsee oder nach Südfrankreich oder sonst wohin im Umkreis von drei Wochen. Für seine heimlichen Wünsche bleibt nichts, ist nie etwas geblieben. Er kennt sie gar nicht, diese Wünsche. Er weiß nur, dass es sie gibt.
Die Fahrt geht weiter, zögernd, durch enge Nebenstraßen, Einfahrt, Hof, Garage. Der kalte Treppenflur, der Aufzug mit der zerkratzten Tür. Noch immer wartet er, erledigt notwendige Verrichtungen, bewegt sich willenlos von selbst. Vierter Stock, helles Licht von viereckigen Neonlampen, Linoleumboden. Dann die Tür mit dem braunen Holz der anderen Türen, die Nummer 42 am Türschild, klein der Name daneben, zu klein. Ein klirrender Schlüsselbund in seinen Händen, mit dem er die Tür aufschließt.
Die Wohnung ist kalt und dunkel. Er hat die Heizung nur auf Frostschutz stehen, wenn er nicht da ist. Der vergangene Morgen empfängt ihn mit dem Frühstücksgeschirr und dem nicht gemachten Bett. Er lässt das Bett morgens so, wie es ist, wenn er aufsteht. Er fragt sich oft, warum er etwas verändern sollte. Es wird doch alles immer wieder gleich. Die Morgen und die Abende sind so unveränderlich wie das Nichtsein nach dem Tod.
Im Wohnzimmer tickt die nachgemachte Standuhr, auf dem Weg dorthin schaltet er alle Lichter an. Er zieht sich um, hängt den Anzug auf den Bügel, das Hemd, das er morgen noch einmal anziehen kann. Er weiß nicht mehr, warum er die Kleider aufhängt, sorgfältig, gewissenhaft, er hat es vergessen. Er tut es, weil er es immer tut.
Ohne nachzudenken schaltet er den Fernseher ein, schaut in der Küche, ob er etwas zu essen findet. Macht sich ein Wurstbrot und nimmt es mit ins Wohnzimmer. Die Luft ist schal und abgestanden, er geht zur Balkontür und öffnet sie. Die kalte Luft, die hereinkommt, riecht nach dem Heizungsrauch aus den Schornsteinen der Nachbarhäuser. Nach dem Lüften dreht er die Heizung hoch, bis er es rauschen hört. Dann lässt er sich erschöpft in den Ledersessel fallen, starrt auf den Bildschirm, die wechselnden Bilder, die fahl auf seinem Gesicht widerleuchten, betrachtet die elektronischen Schemen, die sich dort hin und her bewegen und Menschen darstellen, die Dinge tun, Sätze sagen, Gefühle zeigen, hört die Stimmen wie von einem weit entfernten Radiosender aus einem fremden Land. Manchmal versteht er einen Satz, nimmt ihn auf, dreht und wendet ihn, aber der Sinn, den er darin vermutete, weicht schnell.
Jetzt ist er allein. Jetzt braucht er nicht mehr zu warten. Er denkt an das Lied und will es vor sich hin summen, aber er hat die Melodie vergessen. Holiday. Sei willkommen auf der Insel.
Für ihn sind seine Träume wichtig. Manchmal hat er das Gefühl, sie sind wichtiger als das Leben, das er gerade führt. Sie beweisen ihm, dass es ein anderes Leben für ihn gibt, ein besseres, auf das er wartet. Manchmal hat er Angst, es zu verpassen, wenn er weiter so wartet. Aber er weiß nicht, was er sonst tun soll. Vor dem Fernseher sitzen und seine Gedanken treiben zu lassen, das ist wenigstens besser als sich den Kopf füllen zu lassen von der Arbeit oder dem Leben in dieser Stadt. Trotzdem weißt er: Am Ende zählen nur Taten. Gedanken und Träume bereiten Taten vor und dürfen kein Leben füllen.
Manchmal denkt er an die Anderen, die auch leben. Menschen vor oder hinter ihm in der Autoschlange, neben ihm im Fahrstuhl, seine Kollegen in der Bank. Er fragt sich, ob sie so leben wie er. Er lebt so wie sie, von außen betrachtet. Aber er kann so nicht leben, er ist anders als die Anderen oder genau gleich. Er träumt und hat aufgegeben, mit jedem Klingeln des Weckers am Morgen ein Stück mehr.
Der Abend geht zu Ende. Es ist Nacht, zehn Uhr, halbelf. Er steht auf, schaltet den Fernseher aus, bringt Teller und Bierglas in die Küche, schaltet die Lichter aus, lässt das dunkle Wohnzimmer zurück wie einen Operationssaal, der erst morgen Abend wieder gebraucht wird. Fremde Welten sind dort aufgeführt worden, Welten und Geschehnisse, die ihn nichts angehen, die vielleicht nur zeigen, was möglich gewesen wäre. Er merkt nicht, dass ihn das Gesehene mutlos macht.
Er zieht sich aus, wäscht sich im Badezimmer, schaut noch einmal, ob beim Wecker der Alarm eingestellt ist, und legt sich dann in das muffige, zerwühlte Bett. Manchmal wünscht er sich, in ein frisches Bett mit kühlen Laken zu schlüpfen, das ihm jemand gemacht hat. Er selbst kann sich dazu nicht aufraffen. Er denkt, dass es sich nicht lohnt, im Kreislauf der Dinge etwas zu verändern. Der Tag ist gelebt. Wieder ein Schritt näher auf dem Weg zum Ziel. Aber das Ziel kennt er nicht.
Er löscht die Nachttischlampe.
2. Kapitel
Eines Morgens ist er vor dem Klingeln des Weckers wach. Von einem Moment auf den anderen. Er liegt mit der Wange auf dem Kissen und starrt auf das Ziffernblatt des Weckers, die Zahlen fluoreszieren im Dunkeln. Er kann den Sekundenzeiger sehen, wie er seine Runden dreht, abgehackt, stetig. Nichts hält ihn auf, es ist, als würde er die großen Zeiger füttern, damit sie sich weiterdrehen können.
Es ist ein Kreislauf. Es wird heute sechs Uhr dreißig werden, und morgen auch, und alle Tage, die kommen werden. Die Tage aber, die Wochen und Monate und Jahre, sind gezählt. Das hat er schon oft gedacht, aber heute wird ihm zum ersten Mal klar, dass diese begrenzte Frist, die heruntergezählt wird, seine eigene ist. Es ist sein Leben, das der Zeiger herunterzählt. Es ist sein eigenes Ende, nicht das der Anderen.
Endlich steht er auf und lässt sich in den gewohnten Tageslauf hinein. Waschen, anziehen, frühstücken, zum Auto gehen, díe Fahrt zur Arbeit.
Er ist pünktlich wie immer. Zwischen den Zähnen hat er noch Reste von Ei und Toast, die er mit der Zunge herauspult. Die Augenlider sind schwer, manchmal kann er den müden Blick nicht scharfstellen, er kennt das Gefühl wie alle Anderen auch. Er kommt gut durch den Stau. Der Tag dämmert noch, der Himmel bedeckt und grau, wie am Abend zuvor.
Er denkt, dass das Leben eine Reihe von einzelnen Tagen ist. Jeder könnte es ändern, aber da alle gleich sind, ändert sich nie etwas. Es müsste ein Tag kommen, der völlig anders wäre, dann könnte man neu anfangen. Vielleicht kann man sich selbst dazu entschließen, dass ein Tag anders ist. Aber er weiß nicht wie.
Er fährt zur Filiale der Genossenschaftsbank in einem Vorort, parkt seinen Wagen im Hof und mischt sich unter seine Kollegen. Sein Schreibtisch mit dem Schild Privatkunden-Berater empfängt ihn genauso wie die Ordnung der Arbeitsmaterialien, der Computer, der Bildschirm, die Papiere. Er begrüßt die Kollegen und den Chef, telefoniert, redet, lacht, raucht draußen eine Zigarette, schreibt, führt Gespräche, bedient den Computer, ist unzufrieden, erleichtert, ängstlich, zuversichtlich, während die Stunden vergehen und die Sonne noch nicht hervorgekommen ist.
In der Mittagspause fährt er in die Stadt und lässt sich in einem Musikgeschäft die CD mit dem Lied der deutschen Rockband heraussuchen, das er im Radio gehört hat. Es ist das letzte Lied auf der Scheibe, er hört mit den Kopfhörern hinein, um sicherzugehen, und kauft die CD. Mit einem Imbiss vom Metzger ist die Pause schnell vorüber, der Himmel bezieht sich dunkel, ohne dass je die Sonne gescheint hätte.
Er ist den Tag über nicht allein und fühlt sich wohl unter Menschen. Mit den Kollegen versteht er sich gut, die Kunden mögen ihn. Er ist eigentlich froh, dass er nicht mehr verheiratet ist. Das gibt ihm ein Gefühl von Freiheit, auch wenn er nicht weiß, wozu das gut ist. Es gibt eine Unterredung mit dem Chef, Kritik, Ermahnung, nichts Besonderes. Der Tag bleibt harmlos und gewöhnlich, er fühlt sich nicht schlecht oder leidet unter etwas Unerträglichem, aber es ist trotzdem kein Tag, den er als lebenswert bezeichnen würde. Leben muss etwas Anderes sein. Manchmal sieht er auf seine Armbanduhr oder die große Uhr, die in der Filiale hängt, dann fällt ihm ein, dass er mit jeder Sekunde verliert, immer mehr aufgibt und dass seine Träume daran nichts ändern.